
Mann und Weib
Sechster Band.
Neunundfünfzigstes Kapitel - Mondlicht auf dem Fußboden
Was war während der Nacht geschehen? Das war Anne’s erster Gedanke, als die Sonne am nächsten Morgen in ihr Zimmer schien und sie weckte. Sie erkundigte sich sofort bei der Magd, die aber nur über das berichten konnte, was sie selbst erlebt hatte. Es war aber nichts vorgefallen, was sie, nachdem sie zu Bett gegangen war, gestört hätte. Ihr Herr sei, wie sie glaube, noch in seinem Zimmer und Mrs. Dethridge sei in der Küche beschäftigt. Anne ging in die Küche hinunter.
Hester war, wie gewöhnlich um diese Zeit, damit beschäftigt, das Frühstück herzurichten. Die leisen Spuren von Erregung, welche Anne, als sie diese zuletzt gesehen, an ihr wahrgenommen hatte, waren verschwunden. Ihre starren Augen blickten wieder stumpf vor sich hin, ihre ganze Haltung war wieder von der gewöhnlichen, leblosen Unbeweglichkeit. Auf Anne’s Frage, ob während der Nacht irgend etwas vorgefallen sei, schüttelte sie langsam mit dem Kopf und machte mit der Hand langsam eine verneinende Bewegung.
Aus der Küche tretend, sah Anne Julius im Vordergarten und ging zu ihm.
»Ich glaube«, sagte er, »ich habe es Ihrer rücksichtsvollen Schonung zu verdanken, daß ich heute Nacht einige Stunden der Ruhe pflegen konnte.«
»Es war fünf Uhr heute Morgen, als ich erwachte. Ich hoffe, Sie haben keine Ursache gehabt, es zu bereuen, daß Sie mich haben schlafen lassen. Ich war in Geoffrey’s Zimmer und fand ihn unruhig; eine zweite Dosis der Medicin beruhigte ihn wieder, das Fieber hat ihn verlassen. Er sieht schwächer und blässer aus als gewöhnlich, im Uebrigen aber doch wieder wie er selbst. Ich komme aus Geoffrey’s Gesundheit gleich zurück, möchte aber zunächst über eine Veränderung mit Ihnen reden, welche vielleicht in Ihrem Leben hier eintreten wird.«
»Hat er sich mit der Trennung einverstanden erklärt?«
»Nein, er widersetzt sich derselben noch ebenso eigensinnig wie gestern; ich habe ihm die Sache aus allen denkbaren Gesichtspunkten plausibel zu machen gesucht. Er verweigert noch immer in ganz positiver Weise die Annahme einer Jahresrente, die ihn für seine Lebensdauer zu einem unabhängigen Manne machen würde.«
»Ist es die Jahresrente, Lord Holchester, die er erhalten haben würde, wenn ——?«
»Wenn er Mrs. Glenarm geheirathet hätte? Nein. Es ist mir, in Rücksicht auf meine Pflichten gegen meine Mutter, und gegen die Stellung, in die mich der Tod meines Vaters versetzt hat, unmöglich, ihm ein Vermögen wie das Mrs. Glenarm’s zu bieten. Gleichwohl ist es ein schönes Einkommen, welches er thöricht genug ist abzulehnen. Ich werde aber nicht müde werden es ihm aufzudrängen, er soll und muß es annehmen.«
Anne fühlte sich durch diese letzten Worte nicht zu neuen Hoffnungen berechtigt. Sie lenkte das Gespräch aus einen andern Gegenstand.
»Sie wollten mit mir noch über etwas reden«, sagte sie, »Sie sprachen von einer Veränderung.«
»Jawohl! Die Wirthin hier ist eine höchst sonderbare Person und thut höchst sonderbare Dinge. Sie hat Geoffrey geschrieben, er müsse die Wohnung hier räumen.«
»Geschrieben, er müsse die Wohnung räumen?« wiederholte Anne erstaunt.
»Ja. In einem ganz formellen Brief; sie überreichte mir denselben diesen Morgen, als ich eben aufgestanden war, offen. Es war mir unmöglich irgend eine nähere Erklärung von ihr zu erlangen. Alles, was aus der armen stummen Person heraus zu bringen war, waren die auf ihre Tafel geschriebenen Worte: »Er kann sein Geld wieder bekommen, wenn er will, aber er muß fort.« Zu meiner großen Ueberraschung weigert sich Geoffrey, trotz seines entschiedenen Widerwillens gegen die Frau, die Wohnung zu verlassen, bis seine Miethezeit abgelaufen sein wird. Vorläufig habe ich für heute Frieden zwischen ihnen hergestellt. Mrs. Dethridge hat sich sehr ungern dazu verstanden, ihm noch vier und zwanzig Stunden zuzugestehen, und so steht die Sache für den Augenblick.«
»Was kann sie nur für Gründe haben?« sagte Anne.
»Es ist vergebens, sie danach zu fragen, es ist offenbar nicht recht richtig mit ihr; soviel aber ist klar. Geoffrey kann Sie nicht lange mehr hier behalten. Die bevorstehende Veränderung wird es Ihnen möglich machen, diesen trübseligen Aufenthalt zu verlassen. Damit ist immer schon etwas gewonnen, und ich halte es für ganz möglich, daß eine andere Umgebung und neue Eindrücke einen guten Einfluß auf Geoffrey üben. Sein sonst ganz unerklärliches Benehmen ist vielleicht die Folge einer Störung seines Nervensystems der vielleicht durch ärztliche Hülfe abzuhelfen ist. Ich kann es weder mir selbst noch Ihnen verhehlen, daß mir Ihre Lage hier höchst beklagenswerth erscheint. Aber bevor wir an der Zukunft verzweifeln, lassen Sie uns doch wenigstens sehen, ob nicht die Gesundheit meines Bruders eine Erklärung für sein Benehmen bietet. Ich habe über das nachgedacht, was der Arzt mir gestern Nacht gesagt hat. Das erste, was wir zu thun haben, ist, uns den besten ärztlichen Rath für Geoffrey’s Fall, der irgend zu erlangen ist, zu verschaffen. Was denken Sie davon?«
»Ich darf nicht sagen was ich denke, Lord Holchester. Ich will es versuchen, meine Lage mit Ihren und nicht mit meinen Augen anzusehen. Der beste ärztliche Rath, den Sie erlangen können, ist der des Herrn Speedwell. Er war es, der zuerst die Entdeckung machte, daß die Gesundheit Ihres Bruders erschüttert sei.«
»Das ist also gerade der Mann, den wir brauchen, ich werde ihn veranlassen, heute oder spätestens morgen her zu kommen. Kann ich sonst irgend etwas für Sie thun? Ich werde Sir Patrick sehens sobald ich zur Stadt komme. Haben Sie mir irgend etwas an ihn aufzutragen?«
Anne zauderte. Julius, der sie scharf beobachtete, bemerkte, daß sie bei der Erwähnung von Sir Patrick’s Namen erröthete.
»Wollen Sie«, erwiderte sie, »die Güte haben, ihm zu sagen, daß ich ihm für den Brief, welchen Lady Holchester gestern Abend die Freundlichkeit hatte, mir von ihm zu bringen, herzlich danke, und wollen Sie ihn dringend von mir bitten, sich nicht um Meinetwillen dem auszusetzen, was« —— sie zauderte wieder und sagte die folgenden Worte mit zu Boden gesenkten Blicken —— »was geschehen möchte, wenn er herkäme und darauf bestände, mich zu sehen.«
»Schlägt er Ihnen vor, das zu thun?«
Sie zauderte abermals. Das leichte nervöse Zucken ihres einen Mundwinkels machte sich mehr als gewöhnlich bemerklich.
»Er schreibt mir«, antwortete sie leise, »daß ihn eine entsetzliche Angst für mich verfolge und daß er entschlossen sei, mich zu sehen.«
»Er ist, glaube ich, der Mann, seine Entschlüsse auszuführen«, erwiderte Julius. »Als ich Sir Patrick gestern sah, sprach er von Ihnen in Ausdrücken der Bewunderung.«
Er hielt inne. Die hellen Thränen rannen Anne über die Wangen. Eine ihrer Hände spielte krampfhaft mit etwas unter ihrem Kleide Verborgenem, vielleicht Sir Patricks Brief.
»Ich bin ihm unendlich dankbar«, sagte sie mit leiser zitternder Stimme, »aber es ist besser wenn er nicht herkommt.«
»Möchten Sie ihm nicht schreiben?«
»Es wäre mir lieber, wenn Sie die Güte haben wollten, ihm meinen Auftrag mündlich auszurichten.«
Julius begriff, daß er bei diesem Gegenstande nicht länger verweilen dürfe. Sir Patricks Brief hatte ersichtlich einen Eindruck auf Anne hervorgebracht, den sich ihre feine Natur nicht eingestehen wollte. Beide traten wieder in’s Haus. An der Thür trafen sie, zu ihrer Ueberraschung, Hester Dethridge im Begriff, zu dieser ungewohnten Morgenstunde auszugehen.
»Wollen Sie jetzt schon nach dem Markt?« fragte Anne.
Hester schüttelte den Kopf.
»Wann kommen Sie wieder?«
Hester schrieb auf ihre Tafel: »Nicht vor Abend.«
Ohne ein Wort weiter zur Erklärung ihres Ausgehens hinzuzufügen, zog sie ihren Schleier über das Gesicht und ging durch den Garten nach der Pforte. Den Schlüssel hatte Julius, nachdem er den Arzt hinausgelassen hatte, in’s Speisezimmer gelegt. Jetzt hatte Hester denselben in der Hand, öffnete die Pforte damit und ließ den SchlüsseL nachdem sie die Thür hinter sich geschlossen hatte, im Schlüsselloch stecken. In dem Augenblicke, wo die Pforte Zuschlag, erschien Geoffrey auf dem Vorplatz.
»Wo ist der Schlüssel?« fragte er, »wer ist da fortgegangen?«
Sein Bruder beantwortete seine Frage. Geoffrey ließ seine Blicke argwöhnisch zwischen Julius und Anne hin und her schweifen. »Was hat sie um diese Tageszeit auszugehen?« fragte er. »Hat sie das Haus verlassen, um mich zu meiden?«
Julius erklärte das für das Wahrscheinlichste. Geoffrey ging verdrossen nach der Pforte, schloß sie, zog den Schlüssel ab, steckte denselben in die Tasche und kehrte wieder zu Julius und Anne zurück.
»Ich muß gut auf die Pforte Acht geben«, sagte er. »Es wimmelt hier in der Gegend von Bettlern und Herumtreibern. Wenn Du auszugehen wünschest«, fügte er zu Anne gewandt in einem sehr absichtlich klingenden Tone hinzu, »so stehe ich Dir, wie es einen guten Ehemann zukommt, ganz zu Diensten.«
Nach einem eilig eingenommenen Frühstück machte sich Julius auf. »Ich nehme Deine Ablehnung meines Anerbietens nicht an«, sagte er vor dem Fortgehen in Anne’s Gegenwart zu Geoffrey. »Ich werde wieder herkommen!«
Geoffrey beharrte eigensinnig auf seiner Ablehnung und erwiderte: »Du kannst gern alle Tage herkommen, ich bleibe doch dabei« Darauf ging Julius.
Anne zog sich wieder auf ihr einsames Zimmer zurück.
Geoffrey ging in’s Wohnzimmer, legte die Bande des Newgate-Kalender auf den Tisch vor sich hin und nahm die Lectüre, die er am Abend zuvor fortzusetzen unfähig gewesen war, wieder auf. Stundenlang arbeitete er sich beharrlich durch eine Reihe von Mordfällen durch. Er hatte über die Hälfte dieses abscheulichen Magazin’s von Criminalprocessen durchgelesen, bevor seine Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit zu concentriren nachließ. Da zündete er seine Pfeife an und ging in den Garten, um weiter über das Gelesene nachzudenken. Wie sehr die Verbrechen, von denen er gelesen hatte auch in andere Beziehungen von einander abweichen mochten, in einem schrecklichen Punkt, an den er nicht gedacht hatte, glichen sie sich alle.
Früher oder später, immer hatte der Körper des Gemordeten durch Spuren von Gift und Gewaltthätigkeit sein stummes Zeugniß gegen das an ihm begangene Verbrechen abgelegt. Geoffrey ging langsam auf und ab, immer noch über das Problem brütend, das sich ihm zuerst aufgedrängt hatte, als er damals im Vordergarten stillstehend nach Anne’s Fenster aufgeblickt hatte.
»Wie?« das war die Frage gewesen, die ihn von dem Augenblicke an beschäftigt hatte, wo der Advocat durch seinen Ausspruch seine Hoffnung auf eine Scheidung vereitelt hatte. Und diese Frage blieb auch jetzt noch zu lösen. Weder in seinem eigenen Kopfe, noch in dem Buche, das er zu Rathe gezogen hatte, fand sich eine Antwort auf diese Frage. Alles lag günstig für ihn, wenn er nur gewußt hätte »wie?« Dank seiner Weigerung das ihm von Julius angebotene Geld anzunehmem war das verhaßte Weib da oben ganz in seiner Hand! Dank seinem Entschluß, selbst nach dem beleidigenden Räumungsbefehl seiner Wirthin in dem Hause zu bleiben, war sein Aufenthalt ein nach allen Seiten hin gegen jede Beobachtung von außen völlig abgeschlossener Platz! Alles hatte er für den einen Zweck vorbereitet, Alles dafür geopfert und doch war die Möglichkeit, diesen Zweck zu erreichen, noch immer in dasselbe undurchdringliche Dunkel für ihn gehüllt! Was waren seine Aussichten, wenn er auf seinen Zweck verzichtete? Er mußte das Anerbieten, das ihm Julius gemacht hatte, annehmen, mit anderen Worten der Befriedigung seiner Rache an Anne und der glänzenden Zukunft, welche ihm Mrs. Glenarm’ treue Ergebenheit noch immer verhieß, für immer entsagen.
Nimmermehr wollte Er seine Zuflucht noch einmal zu den Büchern nehmen. Er hatte sie ja noch nicht ganz durchgelesen. Der leiseste Wink, den ihm die noch nicht gelesenen Blätter vielleicht zu geben vermochten, konnte ja seinem trägen Hirn einen Anstoß geben, die rechte Fährte weiter zu verfolgen. Vielleicht, daß er darin noch einen Weg fand, sich ihrer zu entledigen, ohne daß irgend ein lebendes Wesen in oder außer dem Hause Verdacht schöpfen könnte.
Aber, fragen wir uns, war es denkbar, daß ein Mann in Geoffrey’s Lebensstellung in so brutaler Weise so erbarmungslos handeln konnte? Mußte sich nicht bei dem Gedanken an das, was er jetzt vorhatte, sein Gewissen regen? Halten wir einen Augenblick inne und werfen eine Blick auf seine Vergangenheit.
Hatte sich sein Gewissen auch nur im Mindesten geregt, als er in dem Garten in Windygates auf den an Arnold betrübten Verrath sann? Die Empfänglichkeit für Gewissensregungen war ihm fern. Seine jetzige Denkart war nur die natürliche Consequenz seiner ursprünglichen Sinnesweise. Der ganze Unterschied bestand darin, daß er sich jetzt durch eine viel ernstere Versuchung gedrängt fand, ein viel ernsteres Verbrechen zu begehen. Woher sollte er die Widerstand-Kraft nehmen? Konnte ihm, wie Sir Patrick es einmal ausgedrückt hatte, seine Geschicklichkeit im Rudern, seine Schnelligkeit im Rennen, seine bewunderungswürdige Fähigkeit und Ausdauer in anderen körperlichen Uebungen dazu helfen, einen rein moralischen Sieg über seine Selbstsucht und seine Grausamkeit zu erringen?
Nein!
Die von der materiellen Richtung seiner ganzen Umgebung beförderte sittliche und geistige Vernachlässigung seiner selbst, gab ihn den schlechtesten Instincten seiner Natur, den niedrigsten und gefährlichsten Trieben des natürlichen Menschen widerstandslos preis. Wenn diese Geistes- und Gemüthsverfassung bei der Mehrzahl seiner Genossen keine ungewöhnlich verderblichen Folgen herbeigeführt hatte, so lag das daran, daß keine ungewöhnliche Versuchung an sie herangetreten war. Mit ihm aber stand es anders, an ihn war eine ungewöhnliche Versuchung herangetreten. Und wie fand dieselbe ihn vorbereitet, ihr zu widerstehen?
Sie fand ihn, wozu ihn seine Erziehung und seine ausschließliche Beschäftigung mit körperlichen Uebungen gemacht hatte, als einen gegen jede kleine oder große Versuchung völlig ungewaffneten Menschen.
Geoffrey kehrte in’s Haus zurück. Auf dem Vorplatz fragte ihn die Magd, um welche Zeit er zu Mittag zu essen wünsche Anstatt ihr zu antworten, fragte er ärgerlich nach Mrs. Dethridge; die Magd erwiderte, daß Mrs. Dethridge noch nicht wieder nach Hause gekommen sei. Es war bereits spät am Nachmittage, und sie war schon früh Morgens ausgegangen. Das war noch nie vorgekommen. Ein vager Argwohn nach dem andern, einer immer ungeheuerlicher als der andere, fing an sich in Geoffrey gegen Hester Dethridge zu regen. Er wußte von Julius, daß er während der Nacht phantasirt habe. Hatte er in seinen Phantasien etwas verrathen? Hatte Hester es gehört und war das etwa der eigentliche Grund ihrer langen Abwesenheit und ihrer Räumungsordre? Er beschloß, ohne Hester merken zu lassen, daß er Verdacht gegen sie hege, sich darüber Gewißheit zu verschaffen sobald sie nach Hause zurückgekehrt sein würde.
Es wurde Abend; es war nach neun Uhr, als sich wieder ein Klingeln an der Pfortenglocke vernehmen ließ. Die Magd kam zu Geoffrey, ihn um den Schlüssel zu bitten. Geoffrey stand auf, um selbst nach der Pforte zu gehen, besann sich aber, noch ehe er das Zimmer verlassen hatte, wieder anders. Wenn es Hester war, die draußen auf Einlaß wartete, so konnte es ihren Verdacht rege machen, wenn er ihr selbst die Pforte öffnete, während doch die Magd da war, um es zu thun. Er gab der Magd den Schlüssel und hielt sich so, daß Hester beim Eintritt in’s Haus seiner nicht ansichtig werden konnte.
»Todtmatt!« dachte die Magd, als sie ihre Herrin bei dem Schein der Lampe an der Pforte erblickte.
»Todtmatt!« murmelte Geoffrey vor sich hin, als er Hester auf ihrem Gange über den Vorplatz nach ihrem Zimmer durch die angelehnte Thiir des Wohnzimmers argwöhnisch beobachtete.
»Todtmatt!« dachte auch Anne, als sie Hester auf dem oberen Vorplatz traf, und einen von Blanche adressirten Brief, den der Postbote der Herrin des Hauses an der Pforte übergeben hatte, aus ihren Händen entgegennahm.
Hester zog sich in ihr Schlafzimmer zurück.
Geoffrey schloß die Thür des Wohnzimmers, in welchem die Kerzen angezündet waren, und ging in das völlig dunkle Speisezimmer. Er ließ die Thür angelehnt, um Hester, wenn sie zu ihrem Abendessen in die Küche hinuntergehen werde, abzufassen.
Matt und müde schloß Hester ihre Thür, zündete ihre Lichter an und stellte Feder und Tinte auf den Tisch. Dann mußte sie sich einige Minuten lang niedersetzen, um ihre Kräfte zu sammeln und wieder zu Athem zu kommen. Erst nach einer Weile fühlte sie sich im Stande, Hut und Shawl abzulegen. Sie zog aus der geheimen Tasche ihrer Schnürbrust das »Mein Bekenntniß« überschriebene Manuskript, schlug wieder die letzte Seite auf und schrieb unter die am vorigen Abend gemachte Auszeichnung Folgendes:
»Heute Morgen habe ich ihm angezeigt, daß er das Haus räumen müsse und habe ihm angeboten, ihm, wenn er es haben wolle, sein Geld wiederzugeben. Er weigert sich zu gehen. Morgen muß er gehen, oder ich stecke ihm das Haus über dem Kopf an. Den ganzen Tag über bin ich außer dem Hause gewesen, um ihm aus dem Wege zu gehen. Ich finde keinen Schlaf und keine Ruhe. Ich trage mein Kreuz demüthig, so lange mir meine Kraft nicht versagt.«
Als sie diese Worte geschrieben hatte, entsank die Feder ihrer Hand. Ihr Kopf fiel auf die Brust herab.
Plötzlich aber raffte sie sich wieder auf. Sie fürchtete den Schlaf wie einen Feind, denn der Schlaf brachte ihr Träume. Sie öffnete die Fensterladen und sah in die Nacht hinaus. Friedlich leuchtete der Mond über dem Garten. Der klare Nachthimmel war schön anzusehen und wirkte besänftigend auf ihre Seele. Wie! Ging der Mond schon wieder unter? Zogen Wolken an ihm vorüber und verdunkelten ihn? Nein! Sie war schon wieder beinahe eingeschlafen.
Abermals raffte sie sich auf. Unbewölkt stand der Mond noch immer am Himmel und beleuchtete den Garten so hell wie vorher. Aber jetzt vermochte sie den Schlaf, der sie überwältigte, nicht länger zu bekämpfen.
Sie schloß die Fensterladen wieder, ging nach ihrem Bett und legte ihr »Bekenntniß« an seinen gewöhnlichen Platz während der Nacht, unter ihr Kopfkissen. Sie blickte im Zimmer umher und schauderte. Jeder Winkel desselben war mit den fürchterlichen Erinnerungen der vorigen Nacht angefüllt. Sie mußte fürchten, daß, wenn sie von quälenden Träumen erwachte, die Erscheinung an ihrem Bette vor ihr stehen würde. Gab es denn kein Mittel dagegen? Keinen heiligen Schutz, unter dem sie sich ruhig dem Schlafe überlassen könnte? Plötzlich fuhr es ihr durch den Kopf. Es gab ein solches Mittel: Das gute Buch, die Bibel. Wenn sie mit der Bibel unter dem Kopfkissen schlief, so durfte sie auf einen ruhigen Schlaf hoffen. war nicht der Mühe Werth, das Kleid und die Schnürbrust, die sie bereits ausgezogen hatte, wieder anzuziehen Sie konnte sich ja mit ihrem Shawl hinreichend bedecken. Auch das Licht brauchte sie nicht mitzunehmen. Unten würden die Fensterladen noch nicht geschlossen sein, und wenn sie es wären, so konnte sie die Bibel an ihrem Platz auf dem Büchergestell, im Dunkeln finden Sie zog das »Bekenntniß« wieder unter dem Kopfkissen hervor. Auch nicht für einen Augenblick konnte sie sich entschließen, dasselbe in einem Zimmer zu lassen, das sie selbst verließ. Das zusammengefaltete Manuscript in der Hand verbergend, ging sie langsam wieder die Treppe hinunter. Ihre Kniee wankten Sie mußte sich mit der freien Hand am Treppengeländer festhalten.
Geoffrey beobachtete sie vom Speisezimmer aus, als sie die Treppe hinunterkam. Er wartete, was sie thun würde, bevor er sich ihr zeigte und mit ihr spräche. Anstatt nach der Küche zu gehen, trat sie gleich von der Treppe in das kleine Wohnzimmer. Das war wieder verdächtig! Was konnte sie zu dieser späten Stunde ohne Licht in diesem Zimmer wollen? Sie trat an das Büchergestell, in ihrer dunklen Gestalt in dem Mondlicht, das in das kleine Zimmer schien, für Geoffrey vollkommen sichtbar. Sie strauchelte und fuhr sich mit der Hand nach dem Kopf, allem Anschein nach hatte sie ein durch gänzliche Erschöpfung bewirkter Schwindel befallen. Darauf erholte sie sich wieder und nahm ein Buch aus dem Gestell; mit demselben in der Hand lehnte sie sich dann aber gegen die Wand, wahrscheinlich weil sie zu ermattet war, um ohne eine kleine Rast die Treppe wieder hinaufzusteigen. Dicht neben ihr stand ihr Lehnstuhl; wenn sie sich einen Augenblick auf denselben niederließ, konnte sie sich doch besser ausruhen, als wenn sie sich stehend an die Wand lehnte. Mit schweren Gliedern setzte sie sich auf den Lehnstuhl und legte das Buch auf ihren Schooß. Die Hand des einen Armes, den sie über die Lehne hängen ließ, war geschlossen, augenscheinlich weil sie etwas hielt. Sie ließ den Kopf auf die Brust sinken, raffte sich wieder einen Augenblick auf und lehnte sich dann sanft an das an der Rücklehne befestigte Kissen. War sie eingeschlafen? Fest eingeschlafen. Nach wenigen Augenblicken wurden die Muskeln der über die Lehne hängenden geschlossenen Hand schlaff und es glitt, vom Mondschein beleuchtet, etwas Weißes auf den Boden.
Geoffrey zog seine schweren Schuhe aus und ging auf seinen Strümpfen leise in das Zimmer, er hob das am Boden liegende weiße Ding auf und fand, das es eine Lage von mehreren dünnen, zierlich zusammengefalteten und eng beschriebenen Bogen Papier war. Etwas Geschriebenes, daß sie, so lange sie wachend war, in der Hand versteckt gehalten hatte.
Warum versteckt?
Hatte er in der vorigen Nacht in seinen Fieberphantasien etwas ihn Compromittirendes verrathen? Und hatte sie das etwa niedergeschrieben um es gegen ihn zu benutzen?
Für Geoffrey’s schuldbewußtes Gemüth konnte selbst ein so ungeheuerlicher Gedanke etwas Wahrscheinliches haben. Geräuschlos, wie er gekommen war, verließ er das Zimmer wieder und ging nach dem erleuchteten großen Wohnzimmer, entschlossen, das Manuscript, das er in der Hand hielt, näher zu untersuchen.
Nachdem er die gefalteten Blätter zuvor sorgfältig auf dem Tisch geglättet hatte, nahm er die erste Seite zur Hand und las was folgt.
Vorheriges
Kapitel
Nächstes
Kapitel
Inhaltsverzeichnis
für diese Geschichte
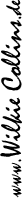
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung
Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung