
Fräulein Minna und der Reitknecht
XI.
Er trat ein und wartete bescheiden an der Tür.
Nachdem ich ihn einen Stuhl hatte nehmen lassen, sagte ich ihm, dass ich von seinem Anliegen Kenntnis erhalten hätte, dass ich mich aber nach dem Rate meines Oheims der Einmischung in die Frage enthalten müsste, ob er seine Stelle aufgeben solle oder nicht. Nachdem ich so einen Grund, ihn kommen zu lassen, vorgeschützt hatte, spielte ich zunächst auf den Verlust an, den er erlitten hatte, und fragte ihn, ob er diejenige Person ausfindig zu machen hoffe, die sein Zimmer in seiner Abwesenheit betreten habe. Als er dies verneinte, sprach ich von den ernsten Folgen, die die Vernichtung jener Gegenstände für ihn haben werde. „Die letzte Hoffnung, Ihre Eltern zu ermitteln“, sagte ich, „ist grausam zerstört worden.“ Er lächelte betrübt. „Sie wissen schon, gnädiges Fräulein, dass ich niemals hoffte, sie zu ermitteln.“
Ich wagte mich ein wenig dem Ziele näher, das ich im Auge hatte. „Denken Sie niemals an Ihre Mutter?“ fragte ich. „Bei ihrem Alter könnte sie noch am Leben sein. Können Sie alle Hoffnung aufgeben, sie noch zu finden, ohne dass es Ihrem Herzen Schmerzen bereitet?“
„Wenn ich ihr darin unrecht getan hätte, dass ich glaubte, sie hätte mich verlassen“, antwortete er, „so ist das Herzweh nur ein armseliges Mittel, die Gewissensbisse kundzugeben, die ich fühlen würde.“
Ich wagte mich noch näher. „Selbst wenn Sie recht hätten“, fing ich wieder an - „selbst wenn jene Sie verlassen hätte-“ Er unterbrach mich mit ernster Miene. „Ich würde nicht einmal die Straße überschreiten, um sie zu sehen“, sagte er. „Eine Frau, die ihr Kind verlässt, ist ein Ungeheuer. Verzeihen Sie mir, gnädiges Fräulein, dass ich so spreche! Wenn ich gute Mütter und ihre Kinder sehe, macht es mich wahnsinnig, wenn ich daran denke, wie meine Kindheit gewesen ist.“
Als ich diese Worte hörte und ihn aufmerksam betrachtete, während er sprach, konnte ich sehen, dass mein Stillschweigen eine Barmherzigkeit für ihn, nicht aber ein Verbrechen sein würde. Ich beeilte mich, von etwas anderem zu reden. „Wenn Sie sich entschließen, uns zu verlassen“, fragte ich, „wann werden Sie dann gehen?“
Seine Augen nahmen augenblicklich einen sanfteren Ausdruck an. Immer mehr verschwand die Farbe aus seinem Gesicht, als er mir antwortete.
„Der General sagte mir freundlich, als ich vom Aufgeben meiner Stelle sprach“ - hier stockte seine Stimme und er machte eine Pause, um ihr wieder die nötige Sicherheit zu geben. „Der Herr sagte“, fuhr er fort, „dass ich meinen neuen Dienstherrn nicht warten zu lassen brauche, indem ich noch den üblichen Monat hier bliebe, vorausgesetzt – vorausgesetzt, dass Sie bereit wären, mich von meinem Dienste zu entbinden.“
Bis jetzt war es mir gelungen, mich zu beherrschen. Bei dieser Antwort aber fühlte ich meine Standhaftigkeit wanken. Ich sah, wie er litt; ich sah, wie mannhaft er kämpfte, dies zu verbergen.
„Ich bin nicht bereit“, sagte ich, „es tut mir leid – sehr, sehr leid, Sie zu verlieren. Aber ich will etwas tun, was zu Ihrem Besten dient. Mehr kann ich nicht sagen.“
Er erhob sich plötzlich, als wenn er das Zimmer verlassen wollte, bemeisterte aber seine Aufregung und stand einen Augenblick schweigend da, indem er nach mir hinsah – alsdann blickte er wieder weg und sprach seine Abschiedsworte.
„Wenn es mir in meiner neuen Stellung glückt, Fräulein Miina – wenn ich mich zu besseren Verhältnissen emporringe – ist es – ist es zu viel gewagt, zu fragen, ob ich eines Tages – vielleicht wenn Sie allein ausreiten – ob ich mit Ihnen sprechen dürfte – nur um zu fragen, ob Sie sich wohl befinden und glücklich sind-“
Er konnte nicht weiter sprechen. Ich sah Tränen in seinen Augen; ich sah ihn von krampfhaften Atemzügen erschüttert, die sich aus dem Manne in den seltenen Augenblicken herauspressen, wenn er weint. Und dann selbst unterdrückte er sie. Er verneigte sich gegen mich, als wenn er nur mein Diener wäre und als wenn er zu tief unter mir stünde, meine Hand zu ergreifen, selbst in diesem Augenblicke! Ich hätte alles andere ertragen können; ich glaube, dass ich mich unter allen anderen Umständen noch bezwungen hätte. Es ist aber jetzt wenig daran gelegen; mein Geständnis muss erfolgen, was man auch immer von mir denken möge. Ich flog wie ein wahnsinniges Geschöpf auf ihn zu – ich schlang meine Arme um seinen Hals – ich rief: „O Michael, wissen Sie denn nicht, dass ich Sie liebe?“ Und dann legte ich meinen Kopf an seine Brust und hielt ihn fest und sprach nichts mehr.
In diesem Augenblicke des Schweigens wurde die Tür des Zimmers geöffnet. Ich erschrak und blickte auf. Frau Claudia stand auf der Schwelle.
Ich sah ihr am Gesicht an, dass sie gelauscht hatte – sie musste ihm gefolgt sein, als er auf dem Wege zu meinem Zimmer war. Diese Überzeugung stärkte mich. Ich nahm seine Hand in die meinige und stellte mich an seine Seite, indem ich darauf wartete, dass sie zuerst spreche. Sie blickte nach Michael, nicht nach mir. Sie tat einige Schritte vorwärts und sprach ihn an: „Es ist möglich, dass Sie noch Gefühl für Anstand haben. Verlassen Sie das Zimmer!“
Diese wohlüberlegte Beleidigung war alles, was ich brauchte, um mich vollständig zur Herrin meiner selbst zu machen. Ich sagte Michael, er solle einen Augenblickw warten, und öffnete mein Schreibpult. Ich schrieb auf ein Couvert die Adresse einer treuen alten Dienerin in London, die meine Mutter in ihren letzten Stunden gepflegt hatte. Ich gab sie Michael. „Sprechen Sie morgen früh dort vor“, sagte ich. „Ich werde Sie erwarten.“ Er blickte nach Frau Claudia, offenbar nicht gewillt, mich mit ihr allein zu lassen. „Fürhcten Sie nichts“, sagte ich, „ich bin alt genug, um selbst auf meiner Hut zu sein. Ich habe dieser Dame nur ein Wort zu sagen, ehe ich das Haus verlasse.“ Damit nahm ich seinen Arm, ging mit ihm zur Tür und sagte ihm beinahe ebenso ruhig den Abschiedsgruß, als wenn wir schon Mann und Frau gewesen wären.
Frau Claudias Augen folgten mir, als ich die Tür wieder schloss, und blickten dann durch das Zimmer nach einer zweiten Tür, die in mein Schlafzimmer führte. Dann trat sie plötzlich auf mich zu, gerade als ich im Begriff war, mein Zimmer zu betreten, und legte ihre Hand auf meinen Arm.
„Was bedeutet deine Miene?“ - sie richtete die Frage ebenso sehr an sich selbst wie an mich – indem sie die Augen aufmerksam forschend auf die meinigen richtete.
„Du sollst es sofort erfahren“, antwortete ich. „Lass mich nur erst meinen Hut und meinen Mantel nehmen.“
„Hast du vor, das Haus zu verlassen?“
„Ja, das will ich.“
Sie zog die Schelle. Ich kleidete mich ruhig an, um auszugehen. - Der Diener erschien, als ich in das Wohnzimmer zurückkehrte.
„Sagen Sie Ihrem Herrn, dass ich ihn augenblicklich zu sehen wünsche“, sagte Frau Claudia.
„Der Herr ist ausgegangen, gnädige Frau.“
„In seinen Klub?“
„Ich glaube, gnädige Frau.“
„Ich werde Sie mt einem Brief zu ihm schicken. Kommen Sie zurück, wenn ich wieder schelle.“ Sie wandte sich zu mir, als der Diener sich entfernt hatte. „Weigerst du dich wirklich, hier zu bleiben, bis der General zurückkehrt?“
„Ich werde glücklich sein, den General zu sehen, wenn du meine Adresse in den Brief an ihn einschließen willst.“
Indem ich dies erwiderte, schrieb ich meine Adresse zum zweitenmal. Als ich sie ihr gab, erkannte Frau Claudia sehr wohl, dass ich mich in ein achtbares Haus begab. Die Frau, die es innehatte, hatte mich gepflegt, als ich noch ein Kind war.
„Noch eine letzte Frage“, sagte sie. „Soll ich dem General sagen, dass du die Absicht hast, deinen Reitknecht zu heiraten?“
Der Ton ihrer Worte reizte mich zu einer Antwort, die ich schon in dem Augenblicke bedauerte, als sie über meine Lippen kam.
„Du kannst es einfacher ausdrücken, wenn du willst“, erwiderte ich. „Du kannst dem General sagen, dass ich die Absicht habe, deinen Sohn zu heiraten.“
Sie war in der Nähe der Tür und im Begriff, mich zu verlassen. Bei meinen Worten wandte sie sich mit einem geisterhaften, entsetzten Blicke um – griff mit den Händen um sich, als wenn sie in der Dunkelheit nach etwas fassen wollte, und fiel zu Boden.
Ich forderte augenblicklich Hilfe. Die weiblichen Dienstboten trugen sie zu meinem Bett. Während diese sie wieder zu sich selbst brachten, schrieb ich einige Zeilen, worin ich der elenden Frau mitteilte, wie ich ihr Geheimnis entdeckt hatte.
„Die Ruhe deines Gatten“, fügte ich hinzu, „ist mir ebenso teuer als meine eigene. Was deinen Sohn betrifft, so weißt du, was er von der Mutter denkt, die ihn verlassen hat. Dein Geheimnis ist sicher bei mir aufbewahrt – sicher vor deinem Gatten, sicher vor deinem Sohne bis an das Ende meines Lebens.“
Ich versiegelte diese Zeilen und gab sie ihr, als sie wieder zu sich selbst gekommen war. Niemals erhielt ich von ihr eine Antwort. Auch sah ich sie nie mehr seit dieser Zeit. Sie weiß, dass sie sich auf mich verlassen kann.
Und was sagte mein guter Oheim, als wir uns demnächst begegneten? Ich möchte lieber berichten, was er tat, als er von meiner beabsichtigten Heirat hörte und seine ersten Gefühle von Ärger und Überraschung bezwungen hatte. Er willigte ein, uns an unserem Hochzeitstage zu empfangen und übergab meinem Gatten die Mittel, die uns beiden eine unabhängige Lebensstellung gewährten. Aber er hatte doch seine Besorgnis. Er wehrte es ab, als ich ihm zu danken versuchte.
„Kommt nach einem Jahr wieder“, sagte er. „Ich will auf den Dank warten, bis die Erfahrung in eurem ehelichen Leben mir sagt, dass ich diesen Dank verdient habe.“
Das Jahr ging vorüber, und der General empfing den Ausdruck meienr aufrichtigen Dankbarkeit. Er lächelte und küsste mich; aber es lag doch etwas in seinem Gesicht, das mir andeutete, dass er noch nicht ganz befriedigt war.
„Glaubst du, dass ich aufrichtig gesprochen habe?“ fragte ich.
„Ich glaube es fest“, antwortete er – und dann hielt er inne.
Eine klügere Frau hätte den Wink verstanden und den Gegenstand fallen lassen. Meine Torheit bestand darauf, noch eine Frage zu stellen:
„Sage mir, Oheim: habe ich nicht bewiesen, dass ich recht hatte, als ich meinen Reitknecht heiratete?“
„Nein, meine Teure. Du hast nur bewiesen, dass du ein Glückskind bist!“
ENDE
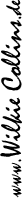
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung
Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung