
Der Polizist und die Köchin
Zunächst ein Wort für mich.
Ehe der Arzt mich eines Abends verließ, fragte ich ihn, wie lange ich voraussichtlich noch zu leben habe. Er antwortete mir: »Das ist nicht leicht zu sagen; Sie können sterben, ehe ich morgen zu Ihnen zurückkommen kann, Sie können aber auch bis zu Ende des Monats leben.«
Ich war am nächsten Morgen noch kräftig genug, an die Bedürfnisse meiner Seele zu denken, und, da ich ein Glied der römisch-katholischen Kirche bin, einen Geistlichen kommen zu lassen.
Die Geschichte meiner Sünden, die ich in der Beichte erzählte, enthielt eine tadelnswerte Vernachlässigung der Pflicht, die ich gegen die Gesetze meines Vaterlandes hatte.
Nach der Meinung des Geistlichen — und ich stimmte mit ihm überein — war ich verpflichtet, ein öffentliches Eingeständnis meiner Schuld abzulegen, als einen Akt der Buße, wie er sich für einen katholischen Engländer geziemt.
Wir beschlossen deshalb, eine Teilung der Arbeit zu versuchen. Ich erzählte die einzelnen Umstände, während Seine Hochwürden die Feder nahm und dem Stoffe die Form gab.
Hier folgt, was daraus entstand:
I.
Als ich ein junger Mann von fünfundzwanzig Jahren war, wurde ich Mitglied der Londoner Polizeimannschaft.
Nach einer beinahe zweijährigen Probezeit in diesem verantwortungsvollen und dabei schlecht bezahlten Berufe befand ich mich zum ersten Mal in der ernsten Lage, eine amtliche Untersuchung zu führen, welche auf nichts Geringeres als einen Mord sich bezog. Die näheren Umstände waren folgende:
Ich war damals einer Station im nördlichen London zugeteilt, die ich nicht näher bezeichnen möchte. An einem Montage kam die Reihe zum Nachtdienste an mich. Bis 4 Uhr des Morgens kam im Polizeigebäude nichts Außergewöhnliches vor. Es war damals Frühling und bei Gaslicht und Feuer im Zimmer ziemlich heiß. Ich ging an die Tür, um frische Luft zu schöpfen, sehr zur Verwunderung unseres diensthabenden Inspektors, der kühler veranlagt war. Es fiel ein feiner Regen, und ein hässlicher Nebel in der Luft veranlasste mich, an den Kamin zurückzukehren. Ich glaube nicht, dass ich länger als eine Minute wieder gesessen hatte, als die Tür heftig aufgestoßen wurde. Eine Frau, die sich wie wahnsinnig gebärdete, stürzte herein und schrie: »Ist dies das Polizeigebäude?«
Unser Inspektor, sonst ein tüchtiger Beamter, hatte zufolge einer Laune der Natur bei seiner Kühle in körperlicher Beziehung ein hitziges Temperament. »Himmel« sagte er, »sehen Sie denn nicht, dass dies das Polizeigebäude ist? Um was handelt es sich denn?« »Um einen Mord!« stieß sie hervor. »Um Gottes willen, kommen Sie mit mir! Es ist in der Pension der Frau Großcapel, Hochstraße Nr. 14. Eine junge Frau hat diese Nacht ihren Gatten erstochen! Mit einem Messer, mein Herr! Sie glaubt, wie sie sagt, es im Schlafe getan zu haben.«
Ich gestehe, dass ich erschrocken war, und der dritte im Dienste, ein Polizeidiener, schien dasselbe Gefühl zu haben. Das Frauenzimmer hatte nur nachlässig seine Kleider übergeworfen, da es anscheinend eben erst aus dem Schlafe aufgeschreckt worden war. Es war jung und selbst in dem gegenwärtigen Zustande eine hübsche Erscheinung.
Ich selbst war von hoher Gestalt, und sie hatte, wie man sagte, meine Statur. Ich stellte ihr einen Stuhl hin; der Polizeidiener schürte das Feuer. Was den Inspektor anlangte, so konnte ihn nichts aus der Fassung bringen. Er verhörte sie so kaltblütig, als wenn es sich um einen geringfügigen Diebstahl gehandelt hätte.
»Haben Sie den Ermordeten gesehen?« fragte er.
»Nein, mein Herr!«
»Oder die Frau?«
»Nein! Ich wagte nicht, das Zimmer zu betreten. Ich hörte nur davon.«
»Und wer sind Sie? Einer von den Mietern?«
»Nein, Herr Inspektor, ich bin die Köchin.«
»Ist denn kein Hausherr da?«
»Ja, aber er ist vor Schrecken außer sich, und das Hausmädchen ist nach dem Arzt gegangen. Dies alles fällt natürlich auf die armen Dienstboten. O, warum setzte ich jemals einen Fuß in dieses schreckliche Haus?«
Die arme Person stieß einen Seufzer aus und zitterte am ganzen Körper. Der Inspektor schrieb die von ihr dargestellten Umstände nieder und ersuchte sie dann, das Protokoll zu lesen und zu unterschreiben Der Zweck dieses Vorgehens war der, sie in seine Nähe zu bringen, um ihren Atem zu prüfen.
»Wenn Leute außergewöhnliche Erklärungen abgeben,« sagte er nachher zu mir, »bewahrt es Sie vor manchen Verdruss, wenn Sie sich überzeugen, dass sie nicht betrunken sind. Ich habe einzelne gekannt, die wahnsinnig waren, aber nicht viele. Sie werden dies in der Regel an ihren Augen merken.«
Die Frau erhob sich und zeichnete ihren Namen: Priscilla Thurlby. Die von dem Inspektor vorgenommene Prüfung ergab, dass sie nüchtern, und ihre Augen überzeugten ihn, wie ich glaube, dass sie nicht wahnsinnig war, denn diese, von lieblicher, hellblauer Farbe, blickten ohne Zweifel sanft und freundlich, wenn sie nicht starr von Furcht oder von Weinen gerötet waren.
Zunächst übertrug er mir die Angelegenheit.
Ich sah, dass er auch jetzt noch nicht an die Richtigkeit der Sache glaubte. »Gehen Sie mit ihr nach Hause!« sagte er, »es wird eine dumme Finte oder aufgebauschter Streit sein. Überzeugen Sie sich selbst und hören Sie, was der Arzt sagt. Wenn die Sache ernst ist, benachrichtigen Sie mich sofort und lassen Sie niemand im Hause ein- und ausgehen, bis wir kommen. Halt! Sie kennen ja die Form, wenn zu einer Protokollaufnahme Veranlassung sein sollte.«
»Ja, Herr Inspektor! Ich werde die Leute darauf aufmerksam machen, dass alles, was sie aussagen, niedergeschrieben wird und gegen sie geltend gemacht werden könne.«
»Ganz recht! Sie werden bald einmal selbst Inspektor sein.«
»Nun also, Fräulein!« Und damit entließ er sie unter meiner Begleitung. Die Hochstraße war nicht sehr weit, ungefähr zwanzig Minuten von dem Polizeigebäude entfernt.
Ich war der Ansicht, wie ich gestehe, dass der Herr Inspektor ein wenig grob gegen Priscilla gewesen war. Sie war natürlich deshalb ärgerlich über ihn. »Was meint er,« sagte sie, »mit der Finte? Ich wünschte, er wäre so erschrocken, wie ich es bin. Es ist das erste Mal, mein Herr, dass ich in fremdem Dienste bin, und ich dachte, eine anständige Stelle gefunden zu haben.«
Ich sprach sehr wenig mit ihr, da ich mich, die Wahrheit zu sagen, bei dem mir gewordenen Auftrag ein wenig ängstlich fühlte. Als wir das Haus erreichten, wurde die Tür von innen geöffnet, ehe ich anklopfen konnte. Es trat ein Herr heraus, der sich als der herbeigerufene Arzt zu erkennen gab. Er blieb stehen, sobald er mich sah. »Sie müssen vorsichtig sein, Schutzmann!« sagte er. »Ich fand den Mann, auf dem Rücken liegend, tot im Bette. Das Messer, mit dem er getötet wurde, steckte noch in der Wunde.«
Als ich dies hörte, fühlte ich mich verpflichtet, sogleich eine Meldung nach der Polizeistation zu machen.
Aber wo konnte ich einen zuverlässigen Boten finden?
Ich nahm mir die Freiheit, den Arzt zu fragen, ob er bei der Polizei das nochmals erklären wolle, was er mir bereits gesagt habe. Das Polizeigebäude war nicht weit von seinem Heimwege entfernt. Er gewährte mir freundlich meine Bitte.
Die Hauswirtin, Frau Großcapel, kam herzu, als wir noch miteinander sprachen. Sie war eine noch junge Frau und, soweit ich sehen konnte, nicht leicht zu erschrecken, selbst nicht durch einen in ihrem Hause begangenen Mord. Ihr Gatte stand hinter ihr im Türeingang. Er sah alt genug aus, um ihr Vater zu sein, und zitterte vor Schrecken so sehr, dass mancher ihn für den Schuldigen hätte halten können.
Ich nahm den Schlüssel der Haustür an mich, nachdem ich sie verschlossen hatte, und sagte der Hauswirtin, dass niemand das Haus verlassen und niemand es betreten dürfe, ehe der Inspektor komme.
Ich müsste die ganze Liegenschaft untersuchen, um zu sehen, ob jemand etwa einen Einbruch verübt habe.
»Hier ist der Schlüssel zur Tür der Lauftreppe,« sagte sie daraufhin zu mir. »Sie wird immer verschlossen gehalten. Kommen Sie wieder herab und überzeugen Sie sich selbst.« Priscilla ging mit uns. Ihre Herrin beauftragte sie alsdann, das Feuer in der Küche anzuzünden.
»Eins oder das andere von uns dürfte sich bei einer Tasse Tee wohler befinden,« äußerte Frau Großcapel. Ich bemerkte ihr, dass sie unter den vorliegenden Umständen die Dinge zu leicht nehme, worauf sie mir erwiderte, dass die Besitzerin einer Londoner Fremdenherberge es nicht fertig bringe, den Kopf zu verlieren, was auch vorfallen möchte.
Ich fand die Tür verschlossen und die Läden des Küchenfensters verriegelt. Die innere Seite der Küche und die Hintertür waren in derselben Weise gesichert. Nirgends war jemand verborgen. Nachdem wir wieder hinausgegangen waren, untersuchte ich das Vorderfenster des Salons. Auch dort bürgten die verriegelten Laden für die Sicherheit dieser Räumlichkeit. Durch die Tür des hinteren Salons hörten wir eine schnarrende Stimme. »Der Polizeibeamte kann hereinkommen,« sagte sie, »wenn er versprechen will, nicht nach mir zu sehen.«
Ich wendete mich um Auskunft an die Hauswirtin. »Es ist die Mieterin meines hinteren Salons, Fräulein Mybus« sagte sie »eine sehr achtbare Dame.« Nachdem ich das Zimmer betreten hatte, sah ich eine Gestalt, aufrechtsitzend und in die Bettvorhänge eingewickelt. Fräulein Mybus hatte sich in dieser Weise sittsam verhüllt. Nachdem ich mich so über die Sicherheit des unteren Teils des Hauses vergewissert und die Schlüssel wohlverwahrt in der Tasche hatte, war ich bereit, hinaufzugehen.
Auf unserem Wege zu dem oberen Teile des Hauses fragte ich, ob irgendwelche Besucher am vorhergehenden Tage dagewesen seien. Ich erfuhr, dass deren nur zwei, und zwar Freunde von Mietern, vorgesprochen hätten und von Frau Großcapel selbst wieder hinausgeleitet worden seien. Meine nächste Erkundigung bezog sich auf die Mieter selbst.
Im Erdgeschoß wohnte Fräulein Mybus. Im ersten Stock bewohnte ein Herr Barfield die beiden Zimmer. Er war ein alter Junggeselle und auf dem Comptoir eines Kaufmanns beschäftigt. Im zweiten Stock bewohnten das vordere Zimmer Johann Zebedäus, der Ermordete, und seine Frau. Im hinteren Zimmer war ein Herr Deluc, als Zigarren-Agent bezeichnet und vermutlich ein Kreole von Martinique.
In der vorderen Dachstube wohnten Herr und Frau Großcapel, in der hinteren die Köchin und das Hausmädchen. Dies waren die zu den Bewohnern des Hauses gerechneten Personen. Ich erkundigte mich nach den Dienstboten. »Beide sind vortreffliche Personen,« sagte die Hauswirtin, »sonst würden sie nicht in meinem Dienste sein.«
Wir gelangten nun den zweiten Stock und fanden das Hausmädchen auf Wache vor der Tür des vorderen Zimmers. Sie war nicht so hübsch wie die Köchin und natürlich sehr erschrocken. Ihre Herrin hatte sie dorthin gestellt, um Lärm zu schlagen, falls Frau Zebedäus, die im Zimmer verschlossen gehalten wurde, zu entweichen versuchen sollte. Meine Ankunft befreite sie von weiterer Verantwortlichkeit. Sie eilte zu ihrer Dienstgenossin in die Küche hinab.
Ich fragte Frau Großcapel, wie und wann zuerst über den Mord etwas laut geworden sei. Frau Großcapel erzählte: »Bald nach drei Uhr diesen Morgen wurde ich durch das Geschrei der Frau Zebedäus geweckt. Ich fand sie hier außen auf der Treppe, und ebenso Herrn Deluc in großer Aufregung, der sie zu beruhigen versuchte. Da er im nächsten Zimmer schlief, hatte er, als ihr Geschrei ihn weckte, nur seine Tür zu öffnen. »Mein lieber Johann ist ermordet; ich bin das elende Geschöpf, das es im Schlafe tat.« Diese wahnsinnigen Worte wiederholte sie ein über das andere mal, bis sie in Ohnmacht sank. Ich und Herr Deluc trugen sie in das Schlafgemach. Wir beide glaubten, dass das arme Geschöpf durch irgend einen furchtbaren Traum irrsinnig geworden wäre. Aber als wir in die Nähe des Bettes kamen, fragen Sie mich nicht, was wir sahen; der Arzt hat ihnen davon schon erzählt. Ich war einst Pflegerin in einem Krankenhause und als solche an schreckliche Anblicke gewöhnt. Dennoch überlief mich ein Schauder, und es schwindelte mir. Was Herrn Deluc betrifft, so dachte ich, er würde gleich in Ohnmacht fallen. Hierauf fragte ich, ob Frau Zebedäus irgend etwas Ungewöhnliches gesagt oder getan habe, seitdem sie Mieterin bei Frau Großcapel sei. »Sie denken wohl, sie sei wahnsinnig?« sagte die Hauswirtin, »und jeder würde Ihrer Meinung sein, wenn eine Frau sich selbst der Ermordung ihres Gatten im Schlafe anklagt. Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich bis zu diesem Morgen keinem stilleren, vernünftigeren, braveren Weibchen als der Frau Zebedäus begegnet bin. Kaum erst verheiratet, war sie für ihren unglücklichen Gatten so eingenommen, wie es eine Frau nur sein kann. Ich hätte sie in ihren Verhältnissen ein Musterpaar nennen mögen.« Mehr war auf der Treppe nicht zu sagen. Wir schlossen die Tür auf und gingen in das Zimmer.
II.
Der Ermordete lag auf dem Rücken, wie der Arzt angegeben hatte; das Blut auf der Leinwand links an seinem Schlafrocke, gerade über dem Herzen, redete seine schreckliche Sprache. Soweit man urteilen konnte, wenn man wider Willen ein totes Angesicht betrachtet, musste er zu seinen Lebzeiten ein schöner junger Mann gewesen sein. Es war ein Anblick, welcher einen jeden aus das tiefste ergreifen musste, aber ich glaube, den schmerzlichsten Eindruck machte es, als meine Augen daneben auf sein unglückliches Weib sich richteten. Sie kauerte auf dem Fußboden in einer Ecke des Zimmers: eine kleine schwarze Frau, in lebhafte Farben gekleidet. Ihr schwarzes Haar und ihre großen braunen Augen ließen die entsetzliche Blässe ihres Gesichtes noch greller erscheinen, als sie in Wirklichkeit vielleicht war. Sie starrte uns grade an, ohne dass es schien, als wenn sie uns sähe. Wir redeten sie an, aber sie antwortete kein Wort. Man hätte sie für tot halten können wie ihren Gatten, wenn sie nicht fortwährend an den Fingern gepickt und dann und wann ein Schauer sie überlaufen hätte, als wenn sie friere.
Ich ging zu ihr und versuchte, sie aufzurichten. Sie sank mit einem Schrei zusammen, der mich fast in Schrecken versetzte, nicht weil er laut, sondern weil er dem Schrei eines Tieres ähnlicher als demjenigen eines menschlichen Wesens war. Wie vernünftig sie sich auch während ihres bisherigen Aufenthaltes bei der Hauswirtin betragen haben mochte, jetzt war sie nicht bei Verstand. Sei es nun, dass ich durch ein natürliches Mitleiden gerührt war, oder sei es, dass mein Gemüt vollständig in Verwirrung geraten war, so viel weiß ich nur, dass ich mich von ihrer Schuld nicht überzeugen konnte. Ich sagte sogar zu Frau Großcapel: »Ich glaube nicht, dass sie es getan hat.« Während ich sprach, klopfte es an der Tür. Ich ging sogleich hinab und öffnete zu meiner großen Erleichterung dem Inspektor, der von einem unserer Beamten begleitet war. Er wartete unten, um meinen Bericht zu hören, und billigte, was ich bereits getan hatte. »Es sieht aus, als wenn der Mord von jemand im Hause begangen worden sei« sagte er, ließ den ihm folgenden Beamten unten und ging mit mir in den zweiten Stock hinauf. Als er kaum eine Minute im Zimmer sich befand, entdeckte er einen Gegenstand, der meiner Wahrnehmung entgangen war. Es war das Messer, mit welchem die Tat begangen worden war. Der Arzt hatte es in dem Leichnam steckend gefunden, es herausgezogen, um die Wunde zu untersuchen, und hatte es alsdann auf den in der Nähe des Bettes stehenden Tisch gelegt.
Es war eins von jenen praktischen Messern, welche eine Säge, einen Pfropfenzieher und andere ähnliche Werkzeuge enthalten. Die große Klinge wurde, wenn offen, durch eine Sprungfeder festgehalten Das Messer war, die blutbefleckte Stelle ausgenommen, so glänzend, als wenn es erst gekauft worden wäre. Eine kleine Metallplatte war auf dem Hornstiel befestigt, welche eine Inschrift enthielt. Dieselbe war nur zum Teil eingraviert und begann: »Dem Johann Zebedäus von —«; das folgende fehlte seltsamerweise. Wer oder was hatte die Arbeit des Graveurs unterbrochen? Jede Vermutung war unmöglich. Nichtsdestoweniger wurde der Inspektor dadurch ermutigt. »Dies könnte uns helfen,« sagte er; dann hörte er aufmerksam dem zu, was Frau Großcapel ihm zu sagen hatte, indem er währenddem nach dem armen Geschöpf in die Ecke blickte. Nachdem die Hauswirtin mit ihrem Berichte zu Ende war, erklärte er, dass er nun den Mieter sehen müsse, welcher in dem anstoßenden Zimmer geschlafen habe. Herr Deluc erschien, indem er sich in die Tür des Zimmers stellte und mit Entsetzen den Kopf von dem sich ihm darbietenden Anblicke abwendete. Er war in einen prächtigen blauen Schlafrock mit goldenem Gürtel und Besatz eingehüllt. Seine Gesichtsfarbe war gelb; seine grünlich-braunen Augen waren von der Art der sogenannten Glotzaugen; es schien, als wenn sie aus dem Gesichte fallen könnten, wenn man einen Löffel unter sie hielt. Sein Schnurrbart und sein Geißbart waren schön parfümiert und, um seine Ausrüstung zu vervollständigen, hatte er eine lange dunkle Zigarre im Munde. »Es ist nicht Gefühllosigkeit bei diesem schrecklichen Auftritte,« erklärte er; »meine Nerven sind zerrüttet, Herr Polizei-Inspektor, und ich kann nur auf diesem Wege das Unglück wieder gut machen. Entschuldigen Sie mich gütigst und haben Sie Mitgefühl für mich.«
Der Inspektor verhörte diesen Zeugen scharf und genau. Er war nicht der Mann, sich durch den Schein irreführen zu lassen, aber ich konnte sehen. dass er weit davon entfernt war, an Herrn Deluc Gefallen zu finden oder ihm gar zu glauben. Nichts kam bei der Untersuchung heraus außer dem, was Frau Großcapel mir im wesentlichen schon mitgeteilt hatte.
Herr Deluc kehrte in sein Zimmer zurück. »Wie lange wohnt er bei Ihnen?« fragte der Inspektor, sobald Deluc ihm den Rücken gekehrt hatte.
»Beinahe ein Jahr,« antwortete die Hauswirtin.
»Gab er Ihnen Referenzen?«
»So gut als ich sie wünschen konnte.« Darauf nannte sie die wohlbekannte Firma einer Zigarrenhandlung in der Altstadt. Der Inspektor notierte die Auskunft in seinem Notizbuche.
Ich möchte lieber im einzelnen nichts erzählen, was sich zunächst zutrug. Es ist zu peinlich, dabei zu verweilen. Lassen Sie mich nur sagen, dass die arme geisteskranke Frau in einer Droschke nach dem Polizeigebäude gebracht wurde. Der Inspektor nahm selbst das Messer und ein Buch in Verwahrung, das auf dem Fußboden gesunden wurde und »Die Welt des Schlafs« betitelt war. Die Reisetasche, die das Gepäck enthielt, wurde verschlossen und dann die Türe des Zimmers verwahrt, indem die Schlüssel von beiden meiner Obhut überlassen wurden. Meine Instruktion ging dahin, im Hause zu bleiben und niemand zu erlauben, es zu verlassen, bis dass ich in Kürze wieder etwas von dem Inspektor hörte.
III.
Die amtliche Leichenschau wurde ausgesetzt und die gerichtliche Untersuchung vertagt, da Frau Zebedäus nicht in dem Zustande war, um das eine oder das andere Verfahren zu verstehen.
Der Gerichtsarzt sagte aus, dass sie durch eine Nervenerschütterung vollständig niedergeschmettert sei.
Als er gefragt wurde, ob er glaube, dass sie eine geistig gesunde Frau gewesen sei, ehe der Mord ausgeführt wurde, lehnte er es ab, hierauf zur Zeit eine bestimmte Antwort zu geben.
Eine Woche war vergangen. Der Ermordete war begraben. Sein alter Vater hatte dem Leichenbegängnis beigewohnt. Ich besuchte gelegentlich Frau Großcapel und ihre beiden Bediensteten in der Absicht, diejenige weitere Auskunft zu erlangen, die mir noch wünschenswerter erschien. Sowohl die Köchin als auch das Hausmädchen hatten von dem monatlichen Kündigungsrechte Gebrauch gemacht, um den Dienst zu verlassen, indem sie, wie sie sagten, im Interesse ihres guten Rufes es ablehnten, in einem Hause zu bleiben, welches der Schauplatz eines Mordes gewesen war.
Der Zustand seiner Nerven veranlasste auch Herrn Deluc zum Ausziehen; seine Ruhe wurde durch schreckliche Träume gestört. Er zahlte die verwirkte Buße und verließ das Haus ohne Kündigung.
Herr Barfield, der Mieter des ersten Stockes, behielt seine Zimmer, aber er bekam von seinen Prinzipalen einen Urlaub und flüchtete mit einigen Freunden auf das Land.
Fräulein Mybus allein blieb in den Salons. »Wenn ich mich wohl befinde,« sagte die alte Dame, »so bringt mich in meinem Alter nichts von der Stelle. Ein Mord zwei Stiegen höher ist beinahe dasselbe wie ein Mord im nächsten Hause. Sie sehen, die Entfernung allein macht den ganzen Unterschied.« Es war der Polizei wenig daran gelegen, was die Mieter taten. Wir hatten Geheimpolizisten, die das Haus Tag und Nacht bewachten. Jedem, welcher das Haus verließ, folgte man im geheimen, und die Polizei des Bezirks, in welchen er sich begab, wurde ersucht, ein wachsames Auge auf ihn zu haben. So lange wir nicht in der Lage waren, die außergewöhnliche Erklärung der Frau Zebedäus in irgendeiner Weise auf ihre Richtigkeit zu prüfen — geschweige dass unsere Bemühungen, den Käufer des benutzten Messers zu ermitteln, bis jetzt von Erfolg gewesen wären — waren wir verpflichtet, keine Person, die in der Nacht des Mordes unter dem Dache Großcapel gewohnt hatte, durch die Finger schlüpfen zu lassen.
IV.
In weiteren vierzehn Tagen hatte sich Frau Zebedäus soweit erholt, dass sie die notwendige Erklärung abgeben konnte, nachdem die Vorsichtsmaßregeln vorausgegangen waren, die bei Personen in solcher Lage angewendet zu werden pflegen. Der Gerichtsarzt war jetzt nicht mehr unschlüssig, sie für eine geistig gesunde Frau zu erklären. Häuslicher Dienst war ihre Stellung im Leben gewesen. Sie hatte zuletzt vier Jahre lang als Kammerzofe bei einer Familie gelebt, welche in Dorsetshire wohnte. Das einzige Bedenken, das gegen sie erhoben werden konnte, war ein zeitweiliges Nachtwandeln, das es notwendig machte, dass ein anderer weiblicher Dienstbote in demselben Zimmer schlief, die Tür verschlossen hielt und den Schlüssel unter seinem Kopfkissen liegen hatte.
In jeder anderen Hinsicht wurde die Kammerzofe von ihrer Herrin als »vollkommenes Kleinod« beschrieben.
In den letzten sechs Monaten ihres Dienstes trat ein junger Mann namens Johann Zebedäus, mit einem schriftlichen Zeugnis versehen, als Bedienter in das Haus ein. Er verliebte sich alsbald in die nette kleine Kammerzofe und diese erwiderte aufrichtig seine Liebe.
Sie hätten wohl jahrelang warten müssen, ehe sie in der finanziellen Lage waren, sich zu verheiraten, wenn Zebedäus nicht bei dem Tode seines Oheims ein kleines Vermögen von 2000 Pfund als Erbe zugefallen wäre. Sie waren nun für Leute ihres Standes reich genug, um vergnügt zu leben, und sie verheirateten sich aus dem Hause weg, in welchem sie beide gedient hatten, wobei die kleinen Töchter der Familie als Brautjungfern mitwirkten, um der Frau Zebedäus ihre Zuneigung zu beweisen.
Der junge Gatte war ein vorsichtiger Mann; er beschloss, sein kleines Kapital in der Weise vorteilhaft anzulegen, dass er in Australien die Pachtung einer Schafzüchterei übernahm. Seine Frau machte keinen Einwand. Sie war bereit, ihm überallhin zu folgen. Demgemäß brachten sie ihre kurz bemessenen Flitterwochen in London zu, um selbst das Fahrzeug zu besichtigen, in welchem sie ihre Überfahrt machen wollten. Sie begaben sich in die Pension der Frau Großcapel, weil Zebedäus’ Oheim dort sich gewöhnlich aufgehalten hatte, wenn er nach London kam. Erst nach 10 Tagen sollte die Einschiffung stattfinden. Dies gewährte dem jungen Paare willkommene Feiertage und die Aussicht, sich nach Herzenslust an den Sehenswürdigkeiten dieser großen Stadt zu ergötzen. Am ersten Abend ihrer Anwesenheit in London gingen sie ins Theater. Sie waren beide an die frische Landluft gewöhnt und daher nahe daran, bei der hier herrschenden Hitze und dem Dunste des Gases zu ersticken. Indessen hatten sie an der ihnen neuen Unterhaltung ein solches Vergnügen, dass sie am nächsten Abend ein anderes Theater besuchten. Dort fand Zebedäus die Hitze unerträglich. Sie verließen das Theater und kehrten gegen 10 Uhr in ihre Wohnung zurück.
Ich will das übrige in den eigenen Worten der Frau Zebedäus erzählen. Sie sagte:
»Wir saßen kurze Zeit in unserem Zimmer und plauderten miteinander. Das Kopfweh meines Mannes wurde immer schlimmer. Ich überredete ihn, zu Bette zu gehen, und damit er um so schneller einschlafen möchte, löschte ich das Licht aus, da ja das Feuer im Kamin hinreichende Helle verbreitete, sich dabei zu entkleiden. Aber mein Mann war zu aufgeregt, um zu schlafen. Er bat mich, ihm etwas vorzulesen. Bücher machten ihn zu jeder Zeit schläfrig. Ich selbst hatte noch nicht begonnen, mich auszukleiden. Ich zündete das Licht wieder an und schlug das einzige Buch auf, welches ich besaß. Mein Mann wurde an einem Bücherstande des Bahnhofs auf dasselbe durch den Titel »Die Welt des Schlafes« aufmerksam. Er pflegte mit mir darüber zu scherzen, dass ich eine Nachtwandlerin sei, und mit den Worten: »Hier ist etwas, was dich sicherlich interessiert,« machte er mir das Buch zum Geschenk.
Ehe ich ihm noch eine halbe Stunde vorgelesen hatte, war er fest eingeschlafen. Da ich zum Schlafe keine Neigung verspürte, las ich für mich weiter. Das Buch interessierte mich in der Tat. Es enthielt eine schreckliche Geschichte, welche sich meines Gemütes bemächtigte, die Geschichte eines Mannes, welcher nachtwandelnd seine eigene Frau erstach. Ich dachte, das Buch wegzulegen, dann aber wurde ich wieder anderen Sinnes und las weiter. Die nächsten Kapitel waren nicht so interessant; sie waren voll von gelehrten Abhandlungen darüber, warum wir einschlafen, was unser Gehirn in diesem Zustande tut, und dergleichen mehr. Die Sache endigte damit, dass ich in meinem Lehnsessel am Kamin ebenfalls einschlief. Ich weiß nicht, wie viel Uhr es war, als der Schlaf kam; ich weiß auch nicht, wie lang ich schlief, oder ob ich träumte oder nicht.
Das Licht und das Feuer im Kamin waren beide abgebrannt, und es war außerordentlich dunkel, als ich erwachte. Ich kann nicht einmal sagen, warum ich erwachte, wenn nicht die Kälte des Zimmers die Ursache war. Auf dem Kamingesims befand sich noch der Rest einer Kerze. Ich suchte nach der Zündholzbüchse und zündete ein Licht an. Alsdann wendete ich mich zum erstenmal nach dem Bette um und sah — —«
Sie sah den toten Körper ihres Gatten, der ermordet wurde, während sie bewusstlos an seiner Seite sich befand — und das arme Geschöpf fiel bei der bloßen Erinnerung daran in Ohnmacht.
Das Gerichtsverfahren wurde wieder vertagt. Sie erhielt alle mögliche Pflege und Aufmerksamkeit, der Geistliche und der Gerichtsarzt waren um ihren Zustand besorgt.
Ich habe noch nichts von dem Zeugnis der Hauswirtin und ihrer Dienstboten gesagt. Es wurde für eine bloße Förmlichkeit gehalten. Das Wenige, was sie wussten, bewies nichts gegen Frau Zebedäus. Die Polizei machte keine Entdeckungen, die ihre erste wahnsinnige Selbstanklage unterstützen konnten. Ihr letzter Dienstherr und seine Frau sprachen von ihr in den schmeichelhaftesten Ausdrücken. Wir befanden uns in einem vollständigen Stillstand.
Man hatte bis jetzt für das Beste gehalten, Herrn Deluc nicht dadurch in Unruhe zu versetzen, dass man ihn als Zeugen vorlud. Die Tätigkeit des Gesetzes war indessen in diesem Falle durch eine vertrauliche, gelegentliche Mitteilung beschleunigt worden, die wir von dem Geistlichen erhalten hatten. Nachdem er Frau Zebedäus zweimal gesehen und mit ihr gesprochen hatte, war der ehrwürdige Herr überzeugt, dass sie nicht mehr als er selbst mit der Ermordung ihres Gatten zu tun hatte; er hielt es indessen nicht für gerechtfertigt, eine ihm gemachte vertrauliche Mitteilung weiter zu sagen — er wollte nur empfehlen, dass Herr Deluc aufgefordert werden möchte, bei der nächsten gerichtlichen Verhandlung zu erscheinen. Dieser Rat wurde befolgt.
Die Polizei hatte noch kein Beweismaterial gegen Frau Zebedäus, als die Untersuchung wieder aufgenommen wurde. Damit sie der Schlussverhandlung beiwohne, wurde sie auf die Zeugenbank verwiesen. An dem Umstande, dass sie zuerst die Wahrnehmung von der Ermordung ihres Gatten machte, als sie in früher Morgenstunde erwachte, wurde so schnell wie möglich vorübergegangen. Nur drei Fragen von Wichtigkeit wurden an sie gestellt.
1. (nachdem ihr das erhobene Messer vorgelegt worden war) »Haben Sie jemals dieses Messer in dem Besitze Ihres Gatten gesehen?« »Niemals!« »Wussten Sie etwas von demselben?« »Durchaus nichts!«
2. »Verschlossen Sie oder Ihr Gatte die Tür des Schlafzimmers, als Sie aus dem Theater heimkehrten?« »Nein!« »Verschlossen Sie selbst etwa später die Tür?« »Nein!«
3. »Haben Sie irgendwelchen Grund anzugeben, der vermuten ließe, dass Sie Ihren Gatten in einem Zustande des Nachtwandelns ermordet haben?« »Keinen Grund, wenn nicht denjenigen, dass ich damals nicht bei Sinnen war, und dass das erwähnte Buch mir den Gedanken dazu eingegeben haben könnte.«
Darauf wurden die anderen Zeugen veranlasst, aus dem Gerichtssaal abzutreten. Nunmehr wurde über den Inhalt der Mitteilung des Geistlichen verhandelt. Frau Zebedäus wurde gefragt, ob irgendetwas Unangenehmes zwischen ihr und Herrn Deluc vorgekommen sei. »Ja.« Sie sagte, er habe sie allein auf der Treppe des Gasthauses erfasst und die Kühnheit gehabt, ihr seine Liebe zu erklären; ja er habe die Beleidigung so weit getrieben, dass er versucht habe, sie zu küssen. Sie habe ihm darauf das Gesicht zerschlagen und ihm erklärt, dass ihr Gatte davon erfahren würde, falls seine üble Ausführung sich wiederholen sollte. Deluc war wütend, dass er das Gesicht zerschlagen hatte, und drohte: »Sie werden dies noch zu bedauern haben!«
Nach stattgefundener Beratung und auf das Ansuchen unseres Inspektors wurde beschlossen, Herrn Deluc für jetzt über die Aussage der Frau Zebedäus noch im Ungewissen zu lassen. Als die Zeugen zurückgerufen wurden, machte er dieselbe Aussage, die er schon vor dem Inspektor gemacht hatte. Dann wurde er befragt, ob er etwas von dem Messer wisse. Er betrachtete dasselbe, ohne dass irgendein Anzeichen der Schuld auf seinem Gesichte erschien, und schwur, dass er dasselbe bis zu diesem Augenblicke nicht gesehen habe. Die wieder aufgenommene Untersuchung nahm ihr Ende, und noch war nichts entdeckt worden.
Aber wir hielten ein wachsames Auge auf Herrn Deluc. Unsere nächste Aufgabe bestand darin, zu versuchen, ob wir ihn nicht mit dem Ankaufe des Messers in Verbindung bringen könnten. Aber es schien in dieser Sache wirklich eine Art Verhängnis zu sein, denn auch hier wieder kamen wir zu keinem verwendbaren Resultat. Es war ja leicht, die Großfabrikanten herauszufinden, die das Messer in Sheffield angefertigt hatten, an dem Fabrikzeichen, das sich auf der Klinge befand.
Aber dieselben verfertigten zehntausende solcher Messer und gaben dieselben an Einzelverkäufer über ganz Großbritannien hin weiter – vom Auslande zu geschweigen. Um aber die Person ausfindig zu machen, welche die unvollständige Inschrift angefertigt hatte, so konnten wir, da wir nicht wussten, wo und von wem das Messer gekauft wurde, ebenso gut nach der sprichwörtlichen Nabel im Heubündel suchen. Unser letztes Hilfsmittel war, das Messer, die mit der Widmung versehene Seite oben, photographieren zu lassen und Abdrücke davon an jede Polizeistation des Königreichs zu senden.
Zu gleicher Zeit rechneten wir noch mit Herrn Deluc, indem wir Nachforschungen über sein vergangenes Leben anstellten, mit der Möglichkeit zu erfahren, ob er und der Ermordete sich gekannt und ob sie vielleicht früher einen Streit oder eine Nebenbuhlerschaft wegen einer Frau miteinander gehabt hatten. Keine Entdeckung der Art belohnte unsere Anstrengungen. Wir vermuteten zwar, dass Deluc ein liederliches Leben geführt hat und in schlechter Gesellschaft verkehrt hatte, doch hatte er sich so verhalten, dass ihn das Strafgesetz nicht erreichen konnte.
Es kann ein Mann ein verdorbener Landstreicher sein, er kann eine Frau beschimpfen und ihr in dem ersten empfindlichen Schmerz, den ihm ein zerschlagenes Gesicht verursacht, Drohworte entgegengeschleudert haben, aber aus diesen Charakterblößen folgt noch nicht, dass er den Gatten der Frau in der Stille der Nacht ermordet hat.
Als wir nochmals aufgefordert wurden, Bericht zu erstatten, konnten wir noch keine Beweismittel beibringen. Die Verschickung der Photographie führte nicht dazu, den Eigentümer des Messers zu ermitteln und dessen unfertige Inschrift zu erklären.
Der armen Frau Zebedäus wurde gestattet, sich zu ihren Freunden zu begeben, unter der ausdrücklichen Zusage von ihrer Seite, wieder zu erscheinen, wenn sie dazu aufgefordert werde. Zeitungsartikel fingen an zu untersuchen, wie viele Mörder wohl zu entkommen pflegen, indem sie die Polizei irreführen.
Die Staatsbehörde setzte eine Belohnung von hundert Pfund für die zur Ermittelung des Täters führende Auskunft fest. Aber Wochen gingen vorüber, und niemand machte auf diese Belohnung Anspruch. Unser Inspektor war nicht der Mann, der leicht zu schlagen war. Weitere Nachforschungen und Untersuchungen folgten. Aber es ist unnötig, etwas über sie zu sagen. Wir unterlagen in allen unseren Anstrengungen, und so hatte die Sache ihr Ende, soweit sie die Polizei und das Publikum betraf.
Die Ermordung des armen jungen Mannes entschwand bald wie so mancher andere unentdeckte Mord der allgemeinen Aufmerksamkeit.
Nur eine unbedeutende Person war töricht genug, in ihren Mußestunden beharrlich die Lösung der Frage zu versuchen: Wer hat den Zebedäus ermordet? Er hatte das Gefühl, dass er zu der höchsten Stellung im Polizeidienste sich emporschwingen könne, wenn er da einen Erfolg erringe, wo ältere und bessere Leute nichts ausgerichtet hatten, und er hielt an seinem eigenen kleinen Ehrgeiz fest, obgleich ihn jedermann verlachte. In deutlichem Englisch gesprochen: Ich war dieser Mann.
V.
Ohne es zu wollen, bin ich bei meiner Erzählung undankbar gewesen. Denn es gab zwei Personen, welche in meinem Entschlusse, die Nachforschungen auf eigene Hand fortzusetzen, nichts Lächerliches fanden. Die eine war Fräulein Mybus, die andere die Köchin Priscilla Thurlby.
Was zunächst Fräulein Mybus betraf, so war sie über die geduldige Ergebung, mit welcher die Polizei ihre Niederlage aufnahm, sehr ungehalten. Sie war ein kleines, helläugiges, lebhaftes Frauenzimmer, das seine Meinung immer freimütig aussprach. »Das geht auch mich an,« sagte sie, »denn wenn ich ein oder zwei Jahre zurückblicke, kommen mir zwei Fälle ins Gedächtnis, wo zu London Personen ermordet aufgefunden wurden und von den Mördern nie eine Spur aufgefunden worden ist. Ich bin auch eine Person und ich frage mich, ob nicht demnächst die Reihe an mich kommt. Sie sind ein netter Bursche, und Ihr Blut und Ihre Ausdauer gefällt mir. Kommen Sie hierher, so oft Sie es für gut finden, und sagen Sie, Sie wollten mich besuchen, wenn man Schwierigkeiten macht, Sie einzulassen.« »Noch etwas! Ich habe nichts Besonderes zu tun, und ich bin nicht auf den Kopf gefallen; hier in meinen Zimmern sehe ich jeden, der in das Haus kommt, und jeden, der es verlässt. Lassen Sie mir Ihre Adresse hier; ich kann vielleicht noch irgendeine Aufklärung für Sie erlangen.«
Mit dem besten Willen fand jedoch Fräulein Mybus keine Gelegenheit, mir zu helfen. Von den beiden Genannten schien Priscilla Thurlby von größerem Nutzen für mich zu sein. Zunächst war sie schlau und tätig, und sie war Herr ihrer Entschlüsse, da ihre Bemühungen, eine andere Stelle zu bekommen, bis jetzt ohne Erfolg geblieben waren. Sodann war sie ein Frauenzimmer, auf das ich mich verlassen konnte. Ehe sie ihre Heimat verließ, um in London sich im häuslichen Dienste zu versuchen, gab ihr der Pfarrer ihres Kirchspiels ein schriftliches Zeugnis, von welchem ich eine Abschrift hier beifüge. Sie lautet:
Ich empfehle Fräulein Priscilla Thurlby gerne für jede anständige Stelle, die sie zu übernehmen imstande sein sollte. Ihre Eltern sind gebrechliche alte Leute, die kürzlich eine Verminderung ihres Einkommens erlitten haben, und sie haben noch eine jüngere Tochter zu ernähren. Da sie ihren Eltern nicht zur Last sein will, geht Priscilla nach London, um einen häuslichen Dienst zu suchen und ihren Lohn zur Unterstützung ihrer Eltern zu verwenden. Dieser Umstand spricht für sich selbst. Ich kenne die Familie seit vielen Jahren, und ich bedauere nur, dass ich keine freie Stelle in meinem eigenen Haushalt habe, welche ich diesem tüchtigen Mädchen anbieten könnte.
gez. Heinrich Derrington,
Pfarrer.
Nachdem ich diese Zeilen gelesen hatte, konnte ich Priscilla ohne Bedenken bitten, mir bei der Wiederaufnahme der Nachforschungen über den geheimnisvollen Mord zu helfen, um sie zu einem guten Ende zu führen. Mein Gedanke war der, dass das Verhalten der Leute im Hause der Frau Großcapel noch nicht sorgfältig genug untersucht worden sei. Im Verlaufe meiner Nachforschungen fragte ich Priscilla, ob sie mir irgendetwas mitteilen könnte, was das Hausmädchen im Bunde mit Herrn Deluc erscheinen lasse. Sie war nicht gewillt, mir zu antworten.
»Ich könnte vielleicht Verdacht auf eine unschuldige Person werfen,« sagte sie; »außerdem war ich nur eine so kurze Zeit mit dem Mädchen im Dienste. —« »Sie schliefen in demselben Zimmer mit ihr,« bemerkte ich, »und Sie hatten deshalb Gelegenheit, ihr Verhalten gegen die Mieter zu beobachten. Wenn man Sie bei dem gerichtlichen Verhöre gefragt hätte, was ich Sie jetzt frage, würden Sie sicherlich als rechtschaffene Frau geantwortet haben.« Dieser Folgerung gegenüber gab sie nach. Ich hörte von ihr gewisse Umstände, welche neues Licht auf Herrn Deluc und auf die Angelegenheit im allgemeinen warfen. Auf diese Auskunft hin handelte ich. Infolge der Ansprüche, die der regelmäßige Dienst an mich stellte, war es zwar nur langsame Arbeit, aber mit Priscillas Hilfe rückte ich sicher gegen das Ziel vor, das ich im Auge hatte. Außerdem hatte ich noch eine Verpflichtung gegen Frau Großcapels hübsche Köchin.
Das Geständnis muss ja früher oder später gemacht werden, und ich kann es ebensogut auch jetzt machen. Durch sie erfuhr ich damals zuerst, was Liebe ist, von ihr erhielt ich köstliche Küsse; und wenn ich fragte, ob sie mich heiraten wolle, sagte sie nicht nein. Sie sah ja, ich muss es gestehen, ein wenig traurig aus und erwiderte: »Wie können zwei so arme Leute, wie wir sind, jemals hoffen zu heiraten?« Darauf antwortete ich ihr: »Es wird nicht lange dauern, so werde ich meine Hand auf den Faden legen, den mein Inspektor nicht hat finden können. Wenn diese Zeit kommt, werde ich, meine Teuere, in der Lage sein, dich zu heiraten.«
Bei unserer nächsten Zusammenkunft sprachen wir von ihren Eltern. Ich war nun ihr Verlobter. Nach den Schritten anderer Leute in meiner Lage zu urteilen, schien es mir nur richtig zu sein, nunmehr mit ihren Eltern bekannter zu werden. Sie stimmte ganz mit mir überein und schrieb an diesem Tage noch den Eltern nach Hause, dass sie uns am Ende der Woche erwarten möchten. Ich übernahm Nachtdienst und gewann so freie Zeit für den größten Teil des nächsten Tages. Ich legte einfache bürgerliche Kleidung an, und wir nahmen an der Bahn Billets nach Yateland, der nächsten Station bei dem Dorfe, in welchem Priscillas Eltern wohnten.
VI.
Der Zug hielt wie gewöhnlich bei der wichtigen Stadt Waterlank. Priscilla, die sich ihren Lebensunterhalt durch Näharbeit verschaffte, da sie noch nicht wieder eine Stellung erlangt hatte, war noch spät in der Nacht an ihrer Arbeit gewesen; sie war müde und durstig. Ich verließ deshalb den Wagen, um ihr etwas Sodawasser zu bringen. Das einfältige Mädchen im Wirtszimmer war nicht imstande, den Korkstopfen aus der Flasche zu ziehen, und wollte auch nicht, dass ich ihr half. Sie nahm einen Pfropfenzieher und gebrauchte ihn verkehrt. Ich verlor die Geduld und nahm ihr die Flasche aus der Hand. Grade als ich den Korkstopfen herauszog, läutete die Glocke auf dem Perron zur Abfahrt. Ich verweilte nur noch so lange, um ein Glas mit Sodawasser zu füllen, aber der Zug setzte sich eben in Bewegung, als ich das Wirtszimmer verließ.
Die Bahnbeamten hielten mich zurück, als ich versuchte, auf den Wagentritt zu springen. So war ich zurückgelassen. Sobald ich mich wieder etwas beruhigt hatte, sah ich nach dem Fahrplan. Wir hatten Waterlank 5 Minuten nach Eins erreicht. Wenn der nächste Zug keine Verspätung hatte, so traf er 1 Uhr 44 Minuten ein und kam in Yateland, der nächsten Station, zehn Minuten später an. Ich konnte nur hoffen, dass Priscilla ebenfalls sich den Fahrplan ansehen und mich erwarten möchte.
Wenn ich versucht hätte, die Entfernung zwischen den beiden Orten zu Fuß zurückzulegen, so würde ich nur Zeit verloren haben. Die Zwischenzeit, die ich zu warten hatte, war nicht sehr lang, und ich benutzte sie, um mir einmal die Stadt anzusehen.
Unbeschadet der gebührenden Achtung für die Bewohner, muss ich doch sagen, dass Waterlank selbst für andere Leute ein langweiliger Ort ist. Ich ging eine Straße hinauf und eine andere hinunter und blieb stehen, um einen Laden zu betrachten, der mir auffiel, nicht wegen der Gegenstände in demselben, sondern weil er das einzige Ladenlokal in der Straße war, das die Erker geschlossen hatte. Ein angeschlagener Zettel kündigte an, dass der Laden zu vermieten sei.
Name und Geschäft des bisherigen Geschäftsmannes, die in den üblichen gemalten Buchstaben darauf angekündigt waren, lauteten: »Jakob Wycomb, Messerschmied«. Zum erstenmal fiel es mir ein, dass wir bei der Versendung der Photographie des Messers ein Hindernis nicht beachtet hatten. Keiner von uns hatte daran gedacht, dass ein Teil der Messerschmiede zufällig uns entgangen sein könnte, sei es, dass sie sich vom Geschäfte zurückgezogen, sei es, dass sie in Konkurs geraten waren. Ich trug immer ein Exemplar der Photographie bei mir und dachte bei mir selbst: Hier könnte sich eine Aussicht eröffnen, die Spur des Messers bis zu Deluc zu verfolgen.
Die Ladentür wurde, nachdem ich zweimal die Schelle gezogen hatte, von einem alten Manne geöffnet, der sehr schmutzig und stocktaub war. Er sagte zu mir: »Sie tun besser, hinaufzugehen und mit Herrn Scorrier, oben im Hause, zu sprechen.« Ich brachte meine Lippen an das Hörrohr des alten Burschen und fragte ihn, wer Herr Scorrier sei. »Schwager des Herrn Wycomb. Herr Wycomb ist tot. Wenn Sie das Geschäft kaufen wollen, wenden Sie sich an Herrn Scorrier.«
Nach dieser Antwort ging ich die Treppe hinauf und fand Herrn Scorrier damit beschäftigt, ein messingenes Türschild zu gravieren. Er war ein Mann in mittlerem Alter mit einer wahren Leichenphysiognomie und blöden Augen. Nach den nötigen Entschuldigungen zeigte ich ihm die Photographie des Messers vor: »Darf ich fragen, ob Sie etwas von der Inschrift auf diesem Messer wissen?« Er nahm sein Vergrößerungsglas und betrachtete es. »Das ist sonderbar,« bemerkte er mir kühn. »Ich erinnere mich des seltsamen Namens Zebedäus. Ja, mein Herr, ich führte die Arbeit aus, soweit sie fertig ist. Doch möchte ich gerne wissen, was mich an der Vollendung der Inschrift hinderte.«
Der Name Zebedäus und die unfertige Inschrift auf dem Messer waren in jeder englischen Zeitung erschienen. Er nahm die Sache so kaltblütig, dass ich zweifelhaft war, wie ich mir seine Antwort auslegen sollte. War es möglich, dass er den Zeitungsbericht über den Mord nicht gelesen hatte? Oder war er ein Mitschuldiger, der mit wunderbarer Kraft der Selbstbeherrschung ausgestattet war?
»Entschuldigen Sie,« sagte ich, »lesen Sie Zeitungen?« »Niemals! Mein Augenlicht ist zu schwach. Ich enthalte mich des Lesens im Interesse meiner Beschäftigung.«
»Haben Sie nicht den Namen Zebedäus erwähnen hören, besonders von Leuten, welche die Zeitungen lesen.« »Sehr wahrscheinlich; aber ich achtete nicht darauf. Wenn mein Tagewerk vorüber ist, mache ich einen Spaziergang. Dann nehme ich mein Abendessen, ein Gläschen Grog und meine Pfeife. Dann gehe ich zu Bett: Sie denken wohl, ein armseliges Dasein das! Ich hatte ein elendes Leben, als ich jung war. Den bloßen Lebensunterhalt und ein wenig Ruhe vor der letzten vollkommenen Ruhe im Grabe — das ist alles, was ich wünsche. Die Welt ist schon lange an mir vorübergegangen; umso besser!«
Der arme Mann redete ehrlich. Ich schämte mich, an ihm gezweifelt zu haben. Dann wendete ich mich wieder zu der Angelegenheit des Messers »Wissen Sie, wo und von wem es gekauft wurde?« fragte ich. »Mein Gedächtnis ist nicht mehr so gut, wie es war,« antwortete er, »aber ich habe etwas, das ihm nachhilft.« Er nahm vom Schranke eine schmutzige, alte Mappe. Soweit ich sehen konnte, waren Papierstreifen mit darauf befindlicher Schrift auf die einzelnen Seiten geklebt. Er wendete nach einem Register um und schlug eine Seite auf. Es blitzte etwas wie Leben auf seinem düsteren Gesichte auf. »Ha! Jetzt erinnere ich mich,« rief er. »Das Messer wurde von meinem verstorbenen Schwager, unten im Laden, gekauft. Alles kommt mir wieder in die Erinnerung. Eine Person, die sich wie wahnsinnig gebärdete, stürzte gerade in dieses Zimmer und riss mir das Messer weg, als ich kaum die halbe Inschrift fertig hatte.« Ich fühlte, dass ich jetzt nahe an der Entdeckung war. »Darf ich sehen, was Ihr Gedächtnis unterstützt hat?« fragte ich. »O ja, Sie müssen wissen, mein Herr, ich lebe von dem Eingravieren von Inschriften und Adressen und klebe die Originale der mir erteilten Aufträge mit meinen eigenen Bemerkungen am Rande in dieses Buch. Zunächst dienen sie mir als Empfehlung neuen Kunden gegenüber, und dann unterstützen sie sicherlich mein Gedächtnis.« Er hielt mir das Buch entgegen und zeigte auf einen Papierstreifen, der den unteren Teil einer Seite einnahm. Ich las die vollständige Inschrift, die für das Messer bestimmt war, mit welchem Zebedäus ermordet wurde: »Dem Johann Zebedäus von Priscilla Thurlby.«
VII.
Es ist mir nicht möglich, zu beschreiben, was ich fühlte, als Priscillas Name mir wie ein schriftliches Schuldbekenntnis entgegentrat. Ich kann nicht sagen, wie lange es währte, bis ich mich einigermaßen wieder erholte. Nur dessen kann ich mich deutlich erinnern, dass ich den armen Graveur sehr erschreckte. Mein erstes Verlangen war, das Manuskript der Inschrift an mich zu nehmen. Ich sagte ihm, dass ich Polizeibeamter sei, und forderte ihn auf, mir in der Entdeckung eines Verbrechens behilflich zu sein. Ich bot ihm sogar Geld an. Er wich vor mir zurück. »Sie sollen es umsonst haben,« sagte er, »wenn Sie nur fortgehen und niemals wieder hierher zurückkommen.« Er versuchte, das Manuskript aus dem Blatte herauszuschneiden, aber seine zitternden Hände waren hierzu nicht imstande. Ich schnitt es selbst heraus und versuchte, ihm zu danken. Er wollte mich aber nicht anhören. »Gehen Sie fort!« sagte er, »Ihr Blick gefällt mir nicht.«
Es mag hier erwähnt werden, dass ich mich von Priscillas Schuld nicht so, wie ich tat, hätte überzeugt fühlen sollen, ehe ich mir nicht weitere Beweismittel gegen sie verschafft hatte. Denn das Messer konnte ihr gestohlen worden sein, vorausgesetzt, dass sie die Person war, die es der Hand des Graveurs entrissen hatte, und so konnte es nachher von dem Diebe dazu benutzt worden sein, den Mord zu begehen. Das ist alles richtig. Aber ich war nicht einen Augenblick mehr über ihre Schuld im Zweifel, als ich die entsetzliche Zeile in der Mappe des Graveurs gelesen hatte.
Ich ging ohne irgendeinen bestimmten Plan nach der Bahn zurück. Der Zug, mit welchem ich Priscilla hatte folgen wollen, hatte Waterbank bereits verlassen. Der nächste Zug, welcher ankam, ging nach London. Ich nahm Platz in demselben, ohne dass noch irgend ein Plan zur Reife gekommen war. Zu Charing Cross traf mich einer meiner Freunde und rief: »Sie sehen erbärmlich aus. Kommen Sie mit und trinken Sie etwas!« Ich ging mit ihm. Einen Liqueur bedurfte ich wirklich; er regte mich an und klärte den Kopf. Mein Freund ging dann seinen Weg, und ich tat es ebenso. Kurze Zeit darauf hatte ich mich darüber entschieden, was ich tun wollte.
Zunächst entschloss ich mich, meine Stellung im Polizeidienste aufzugeben aus einem Beweggrunde, der sich sogleich zeigen wird. Sodann nahm ich eine Wohnung in einem Gasthause. Denn ohne Zweifel würde Priscilla nach London zurückkehren, in meine Wohnung kommen und ausfindig machen, warum ich der getroffenen Verabredung nicht nachgekommen sei. Die einzige Frau, die ich zärtlich geliebt hatte, dem Gerichte zu überliefern, war eine zu grausame Pflicht für mich Armen. Ich zog daher vor, den Polizeidienst zu verlassen. Auf der anderen Seite hatte ich eine entsetzliche Furcht, dass ich nunmehr zum Mörder an ihr werden möchte, falls wir uns begegnen sollten, ehe die Zeit mich gelehrt hatte, wieder die Herrschaft über mich zu gewinnen. Die Elende hatte nicht allein mich beinahe verleitet, sie zu heiraten, sondern auch das unschuldige Hausmädchen anzuklagen, dass sie bei dem Morde beteiligt gewesen sei.
In der Nacht fand ich den Weg, die Zweifel aufzuklären, welche mein Gemüt noch quälten. Ich schrieb an den Pfarrer Derrington, indem ich ihn benachrichtigte, dass ich mich mit Priscilla verlobt habe, und anfragte, ob er mit Rücksicht auf meine Stellung mir sagen wolle, welcher Art ihre früheren Beziehungen zu einer Person namnes Johann Zebedäus gewesen seien. Mit wendender Post erhielt ich folgende Antwort:
»Mein Herr! Unter den vorliegenden Umständen glaube ich verpflichtet zu sein, Ihnen vertraulich mitzuteilen, was Priscillas Freunde und Gönner um ihretwillen bisher geheimgehalten haben. Zebedäus stand in der Nachbarschaft im Dienst. Es tut mir leid, es von einem Manne sagen zu müssen, der ein solch klägliches Ende genommen hat, aber sein Betragen Priscilla gegenüber zeigte, dass er ein lasterhafter und herzloser Wicht gewesen ist. Sie waren verlobt, und er versuchte, wie ich mit Entrüstung hinzufügen muss, sie unter dem Versprechen der Heirat zu verführen. Ihre Tugend leistete ihm Widerstand, und er gab vor, sich seiner selbst zu schämen. Das Aufgebot fand in meiner Kirche statt. Am nächsten Tage verschwand Zebedäus und verließ sie in grausamer Weise. Er war ein brauchbarer Dienstbote, und ich glaube, dass er bald wieder eine andere Stelle erhielt.
Ich überlasse Ihnen sich vorzustellen, wie das arme Mädchen unter dem ihr zugefügten Schimpf gelitten haben mochte.
Nachdem sie mit meiner Empfehlung sich nach London begeben hatte, ging sie auf die erste Annonce ein, die sie las, und war so unglücklich, ihren häuslichen Dienst in dem nämlichen Gasthause zu beginnen, in welches, wie ich aus dem Zeitungsberichte über den Mord schließe, Zebedäus die Frau mitnahm, die er heiratete, nachdem er Priscilla verlassen hatte.
Seien Sie versichert, dass Sie im Begriffe sind, sich mit einem vortrefflichen Mädchen zu verbinden, und empfangen Sie meine besten Wünsche für Ihr künftiges Glück.«
Es war hiernach klar, dass weder der Pfarrer, noch die Eltern oder Freunde etwas von dem Kaufe des Messers wussten. Der Elende, der allein die Wahrheit kannte, war der Mann, der von ihr begehrt hatte, sein Weib zu werden.
Ich war es mir schuldig — wenigstens schien es mir so — nicht die Vermutung aufkommen zu lassen, dass auch ich sie in niedriger Gesinnung verlassen hätte. Wie peinlich dies auch voraussichtlich war, so fühlte ich doch, dass ich sie noch einmal und zum letztenmal sehen müsse.
Sie war an der Arbeit, als ich ihr Zimmer betrat. Als ich die Tür öffnete, fuhr sie in die Höhe, ihre Wangen röteten sich, und ihre Augen blitzten im Zorn auf. Ich ging auf sie zu, und sie sah mir ins Antlitz. Der Ausdruck meines Gesichtes ließ sie im Schweigen verharren. Ich sprach in den kürzesten Worten, die ich finden konnte. »Ich bin im Laden des Messerschmiedes in Waterbank gewesen,« sagte ich. »Dort befindet sich ganz in Ihrer Handschrift die noch unvollendete Inschrift des Messers. Ich könnte Sie mit einem Worte an den Galgen bringen, aber — Gott vergebe mir — ich kann dieses Wort nicht sprechen.«
Ihre frische Gesichtsfarbe wurde plötzlich erdfahl und ihre Augen starr und groß wie die Augen einer Person im Fieberschauer. Sie stand unbewegt und schweigend vor mir. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, warf ich die Inschrift ins Feuer. Schweigend verließ ich sie. Ich sah sie nie wieder.
VIII.
Aber einige Tage später hörte ich von ihr. Ihren Brief habe ich längst verbrannt. Ich wünschte, dass ich ihn auch hätte vergessen können. Aber er haftet mir im Gedächtnis. Wenn ich bei Bewusstsein sterbe, wird Priscillas Brief mein letzter Gedanke auf Erden sein. In der Hauptsache wiederholte er das, was der Pfarrer mir bereits mitgeteilt hatte. Dann teilte sie mir mit, dass sie das Messer als ein Andenken für Zebedäus gekauft habe an Stelle eines ähnlichen Messers, das er verloren hatte. Sonnabend kaufte sie es, ließ es aber zur Anfertigung der Inschrift zurück. Am Sonntag erfolgte das Aufgebot, am Montag wurde sie von Zebedäus verlassen. Sie eilte darauf zu dem Messerschmied und nahm ihm mitten in der Arbeit das Messer vom Tische weg.
Nur sie wusste, dass Zebedäus der ersten Kränkung eine neue hinzugefügt hatte, als er mit seiner Frau im Gasthause ankam. Ihre Arbeit hielt sie in der Küche zurück, und Zebedäus erfuhr nie, dass Priscilla im Hause war. Ich teile noch die letzten Zeilen ihres Geständnisses mit:
»Ein böser Geist fuhr in mich, als ich auf meinem Gange zum Schlafzimmer hinauf ihre Tür untersuchte und sie unverschlossen fand. Ich horchte eine Weile und spähte in das Zimmer hinein. Ich sah sie beide beim verlöschenden Lichte der Kerze, das eine schlafend im Bette, das andere im Schlaf neben dem Kamin. Ich hatte das Messer in der Hand, und es kam mir der Gedanke, die Tat auszuführen, derentwegen die Frau an den Galgen kommen würde. Das Messer konnte ich nicht mehr aus dem Körper ziehen, als die Tat vollbracht war. Bleiben Sie dessen eingedenk, dass ich Sie wirklich liebte. Als Sie mich fragten, ob ich Sie heiraten wolle, sagte ich nicht ja, weil Sie doch nicht Ihre eigene Frau an den Galgen bringen konnten, wenn Sie ausfindig machten, wer den Zebedäus getötet hatte.«
Seitdem habe ich nichts mehr von Priscilla Thurlby gehört. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt oder tot ist. Viele Leute denken wohl, dass ich selbst gehenkt zu werden verdiene, weil ich sie nicht an den Galgen brachte.
Sie mögen vielleicht enttäuscht sein, wenn sie diese Beichte lesen und hören, dass ich ehrlich in meinem Bette gestorben bin. Ich tadele sie nicht. Ich bin ein reuiger Sünder. Allen barmherzigen Christen sage ich ein Lebewohl für immer.
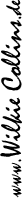
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung
Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung Zweisprachig
einschalten
Zweisprachig
einschalten