
Zwei Schicksalswege
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Sie bedarf wiederum meiner
Als die Zeit verfloss und das Schweigen zwischen uns andauerte, versuchte Miss Dunroß mich zu ermuntern.
»Haben Sie sich entschlossen in Gesellschaft Ihrer Freunde in Lerwick nach Schottland zurückzukehren?« fragte sie.
»Es wird mir nicht leicht,« erwiderte ich, »meine Freunde hier zu verlassen.«
Sie ließ den Kopf sinken und antwortete mir mit leiser Stimme:
»Denken Sie an Ihre Mutter, die Pflichten gegen sie gehen allen anderen vor. Es ist sehr schwer für sie gewesen, Sie so lange zu entbehren und sie leidet sicher darunter.«
»Sie leidet?« wiederholte ich, »davon sagen ihre Briefe aber nichts.«
»Sie vergessen, dass Sie mir die Erlaubnis gaben ihre Briefe zu lesen,« warf Miss Dunroß ein, »und ich habe aus dem was sie schreibt, obgleich sie nichts davon ausspricht, sehr wohl ihre Sorge um Sie herausgelesen und Sie wissen so gut, wie ich, dass sie Grund hat zu sorgen. Beglücken Sie sie durch die Nachricht, dass Sie mit Ihren Freunden heimkehren werden und mehr noch in dem Sie sie versichern, dass Sie nicht länger den Verlust von Frau van Brandt beklagen. Darf ich ihr das in Ihrem Namen mit diesen Worten schreiben?«
Es war mir unmöglich ihr zu gestatten, dass sie in diesen oder irgend welchen anderen Worten über Frau van Brandt schrieb. Obwohl meine unglückliche Liebesgeschichte bisher immer zwischen uns besprochen worden war, warum war es mir jetzt, als wäre sie ein verbotenes Thema, warum konnte ich mich nicht entschließen ihr auf ihre Frage zu antworten?
»Wir haben ja noch viel Zeit übrig«, sagte ich, »ich möchte erst über Sie selbst sprechen.« In der Dunkelheit, die sie umgab erhob sie die Hand, als wollte sie sich gegen dieses Gespräch verwahren, ich aber bestand darauf es dennoch anzubahnen. »Wenn ich denn doch abreisen muss,« fuhr ich fort, »so darf ich Ihnen wohl beim Scheiden sagen, was ich bis jetzt verschwieg, dass ich Sie nicht für unheilbar halte. Sie wissen, dass ich Arzt bin und daher kenne ich mehrere der im Augenblick berühmtesten Ärzte in Edinburgh sowohl als in London. Gestatten Sie mir, dass ich Männern, die in der Behandlung verwickelter Nervenkrankheiten geübt sind, Ihren Zustand, so wie ich ihn auffasse, schildere und darf ich Ihnen den Erfolg schriftlich mitteilen?«
Ich erwartete ihren Bescheid, aber weder Wort noch Gebärden ermutigten meinen Wunsch in Zukunft mit ihr in Verbindung zu bleiben. Da versuchte ich noch einen anderen Weg, auf dem ich sie zu vermögen hoffte, einen Brief von mir zu empfangen.
»Jedenfalls muss ich mir erlauben Ihnen zu schreiben,« fuhr ich fort, »denn Sie werden doch sicher von mir hören wollen, ob Ihre Ahnungen, die Sie mit so großer Sicherheit an ein Wiedersehen zwischen der kleinen Mary und mir glauben lassen, richtig sind!«
Wieder erwartete ich vergebens eine Antwort. Sie sprach, aber nur um den Gegenstand unseres Gesprächs zu wechseln.
»Die Zeit vergeht und wir haben den Brief an Ihre Mutter immer noch nicht angefangen,« war Alles, was sie sagte.
Da ihre Stimme mir verriet, dass sie litt, wäre es grausam gewesen sie noch länger zu quälen. Der matte Lichtschein, der durch die Spalte des Vorhanges drang, nahm schnell ab, so war es wirklich Zeit den Brief zu schreiben. Ich hoffte noch eine andere Gelegenheit zu finden, um mit ihr sprechen zu können, ehe ich das Haus verließ.
»Ich bin bereit,« sagte ich »wollen Sie beginnen?«
Der erste Satz, worin ich meiner Mutter mitteilte, dass meine verrenkte Hand fast heil sei und dass nichts mich hinderte Schottland zu verlassen, sobald Sir James abzureisen beschlösse, war meinem geduldigen Schreiber bald diktiert. Da meiner Mutter aus triftigen Gründen verschwiegen war, dass sich meine Wunde bei dem Unfall wieder geöffnet hatte, war damit Alles gesagt, was über meine Gesundheit zu sagen war und Miss Dunroß wartete auf die folgenden Worte, nachdem sie den Eingang des Briefes geschrieben hatte.
Im nächsten Satze bezeichnete ich meiner Mutter den Tag, an dem das Schiff von hier abgehen sollte und sagte ihr, wenn sie bei günstigem Wetter meine Heimkehr erwarten könne. Auch das schrieb Miss Dunroß und wartete wieder. Ich dachte nach, was ich nun weiter sagen sollte, und nahm mit Erstaunen wahr, dass ich meine Gedanken unmöglich auf den Brief zu richten vermochte. Sie wanderten in rätselhafter Weise immer zu Frau van Brandt hin. Ich war beschämt, ich zürnte mir selbst und beschloss, was ich auch sagen mochte, wenigstens um jeden Preis den Brief zu beenden. Aber, wie ich mich auch bemühte, selbst die äußerste Anstrengung meiner Willenskraft half nichts. In meinen Ohren widerhallten nur Frau van Brandts Worte bei unserem letzten Begegnen - kein Wort für meine Mutter kam mir in den Sinn. Miss Dunroß legte die Feder nieder und wendete langsam den Kopf, um mich anzusehen.
»Sie wollen doch wohl Ihrem Briefe noch Einiges hinzufügen?« sagte sie.
»Gewiss« antwortete ich, »aber ich weiß nicht, was mir fehlt, das Diktieren übersteigt heute Abend entschieden meine Kräfte.«
»Kann ich Ihnen helfen?« fragte sie.
Ich nehme den Vorschlag dankbar an. »Es gibt ja vieles, was meine Mutter mit Freuden hören würde, wenn ich nur Kraft hätte darüber nachzudenken. Wollen Sie es nicht gütigst für mich tun?«
Durch diese unvorsichtige Antwort bot sich Miss Dunroß die Gelegenheit auf Frau van Brandt zurückzukommen. Sie ergriff sie auch mit der festen Entschlossenheit einer Frau, die ihr Ziel im Auge hat und es auf jeden Fall erreichen will.
»Wollen Sie nicht Ihrer Mutter in Ihren eigenen Worten sagen, dass Ihre Verblendung für Frau van Brandt nun zu Ende ist oder soll ich es für Sie niederschreiben, indem ich versuche möglichst Ihre Ausdrucksweise zu wählen?«
Ihre Beharrlichkeit besiegte mich in der Verfassung, in der ich mich eben befand. Ich dachte nachlässig bei mir selbst: »Sie wird wieder auf den Gegenstand zurückkommen, wenn ich jetzt auch Nein sage und mich, nach allen den Freundlichkeiten, die ich ihr verdanke, doch veranlassen Ja zu sagen.«
Ehe ich ihr antworten konnte, verwirklichte sie meine Vermutungen schon, indem sie auf den Gegenstand zurückkam und mir ein Ja entlockte.
»Wie soll ich Ihr Schweigen deuten?« sagte sie. »Erst bitten Sie um meine Hilfe und dann verwerfen Sie den ersten Vorschlag, den ich Ihnen mache!«
»Nehmen Sie die Feder zur Hand,« erwiderte ich, »ich werde Ihren Wunsch erfüllen.«
»Wollen Sie mir die Worte selbst diktieren?«
»Ich will es versuchen.«
Ich versuchte es und dieses Mal gelang es mir. Indem Frau van Brandts Bild lebhaft vor mir stand, stellte ich in Gedanken den Satz zusammen, der meiner Mutter verkünden sollte, dass meine »Verblendung« über Frau van Brandt zu Ende sei.
»Du wirst Dich freuen, wenn Du hörst, dass die Zeit und die Abwechselung von Erfolg waren.«
Miss Dunroß schrieb die Worte nieder und erwartete meinen nächsten Satz. Das Licht erlosch allmählich, das Zimmer wurde dunkler und ich fuhr fort:
»Hoffentlich werde ich Dir wegen Frau van Brandt keine Sorgen mehr bereiten, teure Mutter!«
Bei der herrschenden Stille konnte ich vernehmen, wie die Feder meines Schreibers über das Papier hin und her ging, während ich diese Worte schreiben ließ.
Als der Ton verstummte, fragte ich: »Haben Sie das geschrieben?«
»Ich habe es geschrieben,« antwortete sie in ihrem ruhigen Ton.
Ich fuhr in meinem Briefe fort.
»Die Tage vergehen und ich gedenke selten oder gar nicht ihrer. Ich glaube, ich habe den Verlust von Frau van Brandt nun überwunden.«
Als ich den Satz schloss, stieß Miss Dunroß einen leisen Schrei aus und ich sah im Augenblick trotz der zunehmenden Dunkelheit, dass ihr Kopf hinten gegen die Lehne ihres Stuhles gesunken war. Meinem natürlichen Antrieb folgend, sprang ich auf, um zu ihr zu gehen, aber eine unbeschreibliche Furcht bannte mich an meinen Platz. Ich hielt mich am Kaminsims und war unfähig einen Schritt zu tun, mit Anstrengung gelang es mir zu sprechen.
»Sind Sie krank?« fragte ich.
Sie antwortete mir im flüsternden Tone ohne den Kopf zu erheben: »Ich bin sehr erschrocken.«
»Was erschreckte Sie?«
Ich hörte durch die Dunkelheit, wie sie schauderte. Anstatt mir zu antworten, flüsterte sie vor sich hin: »Was soll ich ihm sagen?«
»Sagen Sie mir, was Sie erschreckt hat,« wiederholte ich, »Sie wissen, Sie können mir die Wahrheit anvertrauen.«
Sie raffte sich auf und antwortete mir diese seltsamen Worte:
»Es trat etwas zwischen mich und den Brief, den ich schreiben wollte.«
»Was war es denn?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Sehen Sie es nicht?«
»Nein.«
»Fühlen Sie es nicht?«
»Ja.«
»Wie erscheint es Ihnen denn?«
»Wie ein kalter Luftzug zwischen mir und dem Briefe.«
»Ist das Fenster aufgegangen?«
»Nein, das ist fest zu.«
»Und die Tür?«
»So viel ich sehen kann ist die Tür auch zu. Überzeugen Sie sich selbst davon. Wo sind Sie und was tun Sie?«
Ich sah nach dem Fenster und nahm, während sie diese Worte sprach, eine Veränderung in dem Teile des Zimmers wahr.
Durch die Spalte zwischen den Vorhängen schien ein neues Licht - nicht das matte, natürliche Zwielicht, sondern ein reiner, sternenheller Schein, ein bleiches, überirdisches Licht. Während ich es beobachtete, zitterte dieser Sternenschimmer, als wenn irgend ein Luftzug ihn bewegte und als es wieder ruhig wurde, trat aus dem überirdischen Glanz die Gestalt einer Frau hervor. Ganz allmälig wurde sie deutlicher. Ich kannte die edle Gestalt und das trübe, liebliche Lächeln wohl, ich stand zum zweiten Male vor Frau van Brandts Erscheinung.
Sie war nicht wie bei unserem letzten Begegnen gekleidet, sondern trug den Anzug, den sie an jenem entwürdigenden Abende trug, als wir uns auf der Brücke trafen und in dem sie mir zuerst an dem Wasserfall in Schottland erschienen war. Der Sternenschimmer umgab sie wie ein Heiligenschein. Sie sah mich mit denselben traurigen, bittenden Augen an, wie damals in dem Lusthause, sie erhob die Hand, aber nicht, wie damals, winkend, dass ich mich ihr nähern sollte, sondern um mich sanft an meinen Platz zu bannen.
Ich wartete voller Ehrfurcht aber ohne Furcht, mein ganzes Herz gehörte ihr, als sie so vor mir stand.
Sie bewegte sich und glitt vom Fenster zu dem Stuhl, auf dem Miss Dunroß saß und ihn leise umgehend, stellte sie sich hinter die Lehne. Bei dem Lichte des matten Schimmers, der sie umgab und der Geistererscheinung auch folgte, sah ich die dunkle Gestalt der lebenden Frau regungslos in ihrem Stuhle sitzen, mit dem Schreibzeug auf dem Schoß und der darauf liegenden Feder. Ihre Arme hingen kraftlos herab, der verschleierte Kopf war jetzt nach vorn gebeugt, sie machte den Eindruck, als wäre sie, im Begriff aufzustehen, in einen Stein verwandelt worden.
Nach einem Augenblick sah ich wie die Geistererscheinung sich über die lebende Gestalt neigte und das Schreibzeug von ihrem Schoße nahm. Das Schreibzeug auf ihre Schulter setzend, ergriffen die bleichen Finger die Feder und schrieben auf den unvollendeten Brief. Dann setzte sie das Schreibzeug der Lebenden wieder auf den Schoß und wendete sich von ihrem Platze aus zu mir. Sie sah mich wieder an und winkte mir wieder, winkte aber dieses Mal, dass ich herankommen sollte.
Willenlos bewegte ich mich, wie damals, als ich sie zum ersten Male in dem Lusthause sah. Durch eine unwiderstehliche Macht näher und näher gezogen, blieb ich einige Schritt vor ihr stehen. Sie trat zu mir und legte mir die Hand auf die Brust und wiederum erfüllte mich das wunderbar gemischte Gefühl von Wonne und Ehrfurcht, das mich schon damals ergriffen hatte, als ich im Geiste ihre Berührung gefühlt. Sie sprach wieder in den leisen, melodischen Tönen, die mir so wohlbekannt waren und sagte dieselben Worte: »Gedenke mein und komm zu mir.« Ihre Hand glitt von meiner Brust herab, das bleiche Licht, das sie umgab, zitterte, sank und verschwand. Das Dämmerlicht schien durch die Vorhänge, das war Alles, was ich sah. Sie hatte gesprochen und war verschwunden. Ich war Miss Dunroß so nah, dass ich sie mit der ausgestreckten Hand erreichen konnte.
Sie erschrak und schauderte, wie jemand, der plötzlich aus einem schweren Traum erwacht.
»Sprechen Sie mit mir!« flüsterte sie. »Sagen Sie mir, dass Sie es waren, der mich berührte.«
Ehe ich sie näher befragte, sagte ich ihr einige beruhigende Worte.
»Haben Sie etwas im Zimmer gesehen?«
Sie erwiderte: »Mich hat eine tödliche Furcht befallen, ich sah nichts, als dass das Schreibzeug von meinem Schoß genommen wurde.«
»Sahen Sie die Hand, die es nahm?«
»Nein.«
»Sahen Sie eine Art Sternenschimmer und eine Gestalt darin stehen?«
»Nein.«
»Sahen Sie das Schreibzeug, nachdem es von Ihrem Schoß genommen war?«
»Ich sah es auf meiner Schulter stehen.«
»Sahen Sie in dem Briefe eine Handschrift, die nicht die Ihrige war?«
»Ich sah auf dem Papier einen dunkleren Schatten, als den, in welchem ich mich befinde.«
»Bewegte er sich?«
»Er ging über das Papier.«
»Nach welcher Richtung hin?«
»Von links nach rechts.«
»Wie man eine Feder beim Schreiben bewegt?«
»Ja, wie man eine Feder beim Schreiben bewegt.«
»Kann ich den Brief nehmen?«
Sie reichte ihn mir hin.
»Darf ich ein Licht anstecken?«
Sie nickte schweigend und zog den Schleier dichter um ihr Gesicht. Ich steckte hinter ihr auf dem Kaminsims das Licht an und sah nach der Schrift.
Dort, auf der leeren Stelle des Briefes, wie einst auf der leeren Stelle in meinem Skizzenbuche, fand ich die Schrift, welche die Geistererscheinung mir zurückgelassen hatte, wie damals in zwei Reihen geschrieben, die ich hier folgen lasse:
Am Ende des Monats
Im Schatten von St. Paul.
Vorheriges Kapitel
Nächstes Kapitel
Inhaltsverzeichnis für diese Geschichte
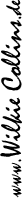
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung
Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung Zweisprachig
einschalten
Zweisprachig
einschalten