
Wilkie Collins - Ein biographisch-kritischer Versuch
von Ernst Freiherr von Wolzogen (1855-1934)
Kapitel 5
Der nächste Roman unseres Verfassers „The Woman in White“ machte seinen Namen in Europa bekannt. Die „Frau in Weiß“ ist eines von jenen Büchern, welche geschrieben werden mußten, um einer bestimmten literarischen Epoche ihren Charakter zu verleihen; eines von jenen Büchern, welche von heute zu morgen aller Welt bekannt werden, ohne daß man recht weiß, wie, welche von dem größten Teil der Kritiker scheel angesehen und trotzdem von allen kleinen Talenten nachgeahmt werden. Wilkie Collins hatte damit einen glücklichen Wurf getan, welcher ihn sofort unter die hervorragendsten Zeitgenossen einreihte. Er hat mit diesem Buche England den klassischen Sensationsroman gegeben, wenn ich so sagen darf. Ich habe mich bereits über das Wesen der sogenannten Sensationsliteratur ausgesprochen und bei jener Gelegenheit auf die Gefahr aufmerksam gemacht, welche in dieser Gattung so leicht die künstlerische Form und die psychologische Vertiefung über der Befriedigung der Neugier, welche das bloße Geschehnis wachhält, vergessen läßt. In diesem Meisterwerke jedoch wird die großartige Kunst der Fabelführung und Komplikation der Intrige fast noch überboten von der genialen Erfindung und Ausführung mancher Charaktere, sowie der großen stilistischen Feinheit in der Wiedergabe der Schreibarten der verschiedenen Berichterstatter.
Ich darf den Inhalt dieses Romans, welcher einer der beliebtesten der ganzen englischen Literatur ist, wohl als bekannt voraussetzen. Doch möchte ich auf die Komposition desselben näher eingehen, weil ich glaube, daß dieselbe als ein Muster für jeden Romanschriftsteller aufgestellt zu werden verdient.
Was zunächst die Form der Darstellung betrifft, so hätte wohl für diesen Stoff keine günstigere gewählt werden können, als die der Berichterstattung durch Augenzeugen und Collins selbst hat dies so wohl empfunden, daß er in den meisten seiner späteren Werke dieselbe Form zur Anwendung bringt. Was könnte auch geeigneter sein, den Glauben an ungewöhnliche, vielfach verwickelte Ereignisse zu bestärken, als solche persönliche Berichte, welche, jeder durch seine individuelle Färbung, wiederum den Glauben an die Realität des Berichterstatters selbst befestigen. Es wäre ein entschiedener Mißgriff, etwa einen historischen Roman in dieser Manier zu schreiben, und auch der Charakterroman würde unter Umständen sehr dadurch leiden, weil es um die Objektivität eines Selbstschilderers doch schief steht. Für den humoristischen Roman wäre die Manier vollends unmöglich, weil der Humor stets die innerste Eigenheit des Autors widerspiegelt und alle Dinge durch die Brille dieser seiner Eigenheit gesehen werden. Hier jedoch, wo es sich zunächst darum handelt, ein Wirrsal von Intrigen zu durchdringen, deren Wirkungen uns mit Entsetzen erfüllen und eben dadurch reizen, ihre einzelnen Fäden auf ihren gemeinsamen Anknüpfungspunkt zu verfolgen, hier wird durch diese Manier das Interesse auf das höchste gesteigert, indem wir aus den Berichten der mithandelnden und mitleidenden Personen den frischen Eindruck des unmittelbar Erlebten erhalten. Durch die starke Sympathie oder Antipathie, welche wir für diese Personen hegen, wird unser Anteil an der aus diesen Einzelerlebnissen zusammengesetzten Geschichte aus einem gegenständlichen zu einem persönlichen und der Autor, dem es gelingt, dieses zu erreichen, schwingt sich dadurch hoch über das künstlerische Niveau des gewöhnlichen Kriminalromanciers hinaus. Wilkie Collins hat es erreicht. Marianne Holcombe ist mit ihrer Liebe zur Schwester und ihrer unerschütterlichen Energie hinreißend; der Graf Fosco, eine der originellsten Figuren, welche die Romanliteratur aufzuweisen hat und es ist ganz undenkbar, daß die Leser über ihn verschiedener Meinung sein könnten: alle werden seinen eminenten Geist bewundern und mit scheuem Haß den Etappen seiner mit der Konsequenz der Gewissenlosigkeit durchgeführten Intrigen folgen. Man mag ferner ruhig zugeben, daß die Figur des Frederic Fairlie übertrieben grell gemalt sei, aber der beabsichtigte Effekt seines krassen Egoismus auf die Stimmung des Lesers wird so vollkommen erreicht, daß man dem Künstler die Wahl seiner Mittel verzeihen muß. Auch der oberflächlichste, gleichmütigste Romanleser wird sich dem Zwange nicht entziehen können, dieses Monstrum von Selbstsucht so ingrimmig zu hassen, daß er selbst die Wonne ersehnen muß, die Nerven dieses zarten Scheusals möglichst energisch anzugreifen. Es ist kein gering anzuschlagendes Vermögen eines Autors, den Leser nach seinem Willen zum innigsten Mitleid und persönlichsten Grimm gegen seine Gestalten zu nötigen. Collins besitzt diese keineswegs häufige Gabe in hohem Maße und hat sie in jenen drei Gestalten vielleicht am eklatantesten innerhalb seiner Werke bewiesen.
Nun also zur Composition. Gleich die ersten Worte enthalten eine Andeutung über den Inhalt, welche den Leser vermuten lassen, daß derselbe ein sehr aufregender sein werde. In ruhigem, schlichten Ton legt der Herausgeber der Geschichte seine Absicht dar, ein Vorkommnis aufzudecken, welches seiner Natur nach außerhalb des Bereiches der strafenden Gerechtigkeit geblieben sei. Darauf legt er seine Stellung und Familienverhältnisse klar und berichtet, auf welche Weise er mit den Hauptpersonen des zu erwartenden Dramas in Berührung kommt. Diese Berührung wird bewirkt durch eine Person, welche, so unbedeutend sie uns anfangs für das Ganze erscheint, am Schluß zum Werkzeug der strafenden Gerechtigkeit gemacht wird. Ich meine Pesca, den kleinen Italiener. Das ist die ganze Vorgeschichte. Schon die zweite Szene, um bei dem Vergleich mit dem Drama zu bleiben, führt uns in medias res, indem sie Walter Hartright mit der geheimnisvollen Frau in Weiß zusammenführt, welche nachher eine so bedeutsame Rolle zu spielen berufen ist. Nach diesem ersten Gipfelpunkt des tatsächlichen Interesses wird bis zum Schluß des ersten Aktes, den ich mir mit Walters Abreise aus England und Lauras Hochzeit zusammenfallend denke, mehr das psychologische Interesse für das Wachsen der Neigung zwischen jenen Beiden in Anspruch genommen. Diese idyllischen Szenen gewähten einen angenehmen Ruhepunkt, ohne jemals die Fortentwicklung der Intrige aus den Augen zu verlieren. Die Identifizierung der weißen Frau mit Anne Catherick und das zweite Erscheinen derselben bezeichnen den Fortschritt der Handlung.
In dieser Exposition wird auf ganz vortreffliche Weise der Grund zu den uns immer mehr beherrschenden Sym,pathien und Antipathien gelegt. Mit großer Meisterschaft wird in dem treuherzigen, schwäremerischen Erzählerton Walters dessen Liebe zu Laura vorgeführt, jedoch nicht ohne daß auch auf das Glück und die stille Wehmut dieses Verhältnisses schon die Schatten künftiger Ereignisse fielen. Auch wird uns bereits Mariannes Bedeutung für die fernere Entwicklung klar und ihre männliche Energie, gepaart mit echtester weiblicher Empfindung nehmen uns im Sturme für sie ein.
Nun kommt der zweite Akt, welcher die Vorgänge im Blackwaterpark bis zu Mariannes Krankheit enthält. Der veränderte Ton, in welchem diese Ereignisse in Mariannes Tagebuch erzählt werden, gibt diesem Abschnitte seinen eigentümlichen Hintergrund. Mit dem Auftreten des Grafen Fosco und seiner Frau gewinnt die Handlung ungemein an Interesse und steigert sich mit höchster dramatischer Lebendigkeit bis zu dem überraschenden Schlußeffekt, dem Nachwort Foscos zu Mariannes Aufzeichungen, durch welches die ganze Ausbeute ihrer übermenschlichen Anstrengungen vernichtet und das Gefühl des Zuschauers auf das denkbar Höchste angespannt wird.
In der Ausführung ist dieser Akt bei weitem der hervorragendste, wenn er auch, getreu den Gesetzen dramatischer Steigerung, von den noch folgenden an starken Effekten überboten wird. Dazu kommt, daß er auch charakterologisch der interessanteste ist, was ja nicht anders sein kann, da er von dem Wettstreit der beiden hervorragendsten Charaktere des Romans erfüllt ist.
Ich muß hier noch besonders aufmerksam machen auf die frappante Wahrheit, mit welcher Sir Percivals Schwanken zwischen Brutalität und Furcht, sowie seine unwillige Abhängigkeit von Fosco geschildert ist. Desgleichen die sklavische Unterwürfigkeit der Gräfin gegen ihren Mann. Wir werden uns vorläufig noch nicht klar, ob die Bewunderung des Grafen für Marianne ehrlich oder nur ironisch ist. Am Schluß erst werden wir von ersterem überzeugt, und wir müssen die Feinheit dieses Zuges bewundern, welche mehr noch, als Foscos glänzender Witz und Erfindungsgabe dazu beiträgt, ihn von der Gattung des höheren Verbrechertums abzuheben und ihn zu einem Original der Niedertracht zu machen, welchem wir bei allem Abscheu nicht nur unsere Bewunderung, sondern auch die Anerkennung eines vorhandenen Gemütslebens nicht versagen können. Soll ich auch aus diesem Akt eine interessante Stelle ins Gedächtnis rufen, so sei es die Unterhaltung der Gesellschaft von Blackwaterpark über die Frage, ob ein Verbrechen allemal durch eigene Schuld des Verbrechers entdeckt würde:
Der Graf zuckte mit den Achseln und lächelte Laura auf das Freundlichste an.
„Sehr wahr!“ sagte er. „Des Narren Verbrechen ist dasjenige, welches entdeckt, und des gescheiten Mannes das, welches nicht entdeckt wird. Wenn ich Ihnen ein Beispiel geben könnte, so wäre es nicht mehr das eines gescheiten Mannes. Liebe Lady Glyde, Ihr gesunder englischer Verstand hat mich geschlagen. Diesmal bin ich schachmatt; wie, Miß Halcombe?“
„Laß Dich nicht verblüffen, Laura“, spottete Sir Percival, der von der Tür aus zugehört hatte. „Sage ihm auch noch, daß Verbrechen durch eigenes Verschulden des Täters entdeckt werden. Da hast Du noch eine Schönschreibebuch-Moral, Fosco. Verbrechen werden durch des Täters eigenes Verschulden entdeckt. Welch‘ verdammtes Gewäsch!“
„Ich glaube, daß es wahr ist“, sagte Laura ruhig.
Sir Percival lachte laut auf – so heftig, so übertrieben, daß er uns alle erschreckte, den Grafen aber am meisten.
„Ich glaube dasselbe“, sagte ich, Laura zu Hilfe eilend.
Sir Percival, den die Bemerkung seiner Frau in so unbegreiflichem Grade belustigt hatte, war durch die meinige in demselben Grade erzürnt. Er stieß heftig mit dem neuen Spazierstock auf den Boden und ging fort.
„Dieser gute Percival!“ rief der Graf, ihm fröhlich nachblickend, „er ist das Opfer englischen Spleens. Aber meine liebe Miß Halcombe, teuerste Lady Glyde, glauben Sie wirklich, daß Verbrechen durch des Täters eigenes Verschulden entdeckt werden? Und Du, mein Engel“, fuhr er, zu seiner Gemahlin gewendet, fort, welche noch kein Wort gesagt hatte, „glaubst Du es auch?“
„Ich lasse mich belehren“, entgegnete die Gräfin in einem Tone eisigen Vorwurfs gegen Laura und mich gerichtet, „ehe ich mir anmaße, in Gegenwart wohlunterrichteter Männer zu urteilen.“
„Wirklich?“ sagte ich. „Ich weiß doch die Zeit noch, Gräfin, wo sie die Rechte der Frauen vertraten und eines derselben war Meinungsfreiheit.“
„Wie denkst Du über den Gegenstand, Graf?“ frug die Gräfin, ruhig mit Anfertigung ihrer Zigarren fortfahrend und ohne die geringste Notiz von mir zu nehmen.
Der Graf streichelte eine seiner weißen Mäuse nachdenklich mit dem kleinen Finger, ehe er etwas erwiderte.
„Es ist wahrhaft staunenswert“, sagte er, „wie leicht die Gesellschaft für die schlimmsten ihrer Vergehen sich durch ein Stückchen Gemeinplatz tröstet. Die Maschinerie, welche sie zur Entdeckung von Verbrechen eingesetzt hat, ist auf eine erbärmliche Weise unzureichend, und dennoch – es erfinde nur einer ein moralisches Epigramm und sage, daß es von guter Wirkung sei, und sofort wird er alles gegen die Fehler desselben verblendet haben. Also Verbrechen werden durch des Täters eigenes Verschulden entdeckt? Und „Es ist nichts so fein gesponnen, es kommt doch ans Licht der Sonnen“, wie? Fragen Sie die Richter, Lady Glyde, welche in großen Städten bei Leichenschauen gegenwärtig sind, ob dies wahr sei. Fragen Sie Sekretäre, die bei Lebensversicherungsgesellschaften angestellt sind, Miß Halcombe, ob dies der Fall ist. Lesen Sie die öffentlichen Blätter. Sind nicht unter den wenigen Fällen, die ihren Weg in die Zeitungen finden, nicht Beispiele von erschlagen gefundenen Körpern, deren Mörder unentdeckt bleiben? Multiplizieren Sie die Fälle, welche berichtet sind, mit denen, die unberichtet bleiben, und die Leichname, die gefunden werden, mit denen, die verborgen bleiben, zu welchem Schlusse kommen Sie da? Zu folgendem. Daß es ungeschickte Verbrecher gibt, die entdeckt werden, und gescheite Verbrecher, die der Entdeckung entgehen. Worin besteht das Verhehlen oder das Aufdecken eines Verbrechens? In Schlauheitsversuchen der Polizei auf der einen und des Individuums auf der andern Seite. Wenn der Verbrecher ein brutaler, unwissender Narr ist, so siegt die Polizei in zehn Fällen neunmal; ist er aber ein entschlossener, gebildeter, in hohem Grade intelligenter Mensch, so verliert die Polizei in demselben Verhältnisse. Wenn die Polizei siegt, hören Sie gewöhnlich den ganzen Hergang der Sache – verliert sie dagegen, so hören Sie meistens kein Wort von der Geschichte. Und auf diese wackelige Grundlage bauen Sie Ihre gemütliche moralische Maxime, daß Verbrechen durch des Täters eigenes Verschulden entdeckt werden! Ja – alle Verbrechen, von denen Sie etwas wissen. Wie aber stehts mit den übrigen?“
„Verflucht wahr das, und sehr gut dargetan“, rief eine Stimme am Eingange des Bootshauses. Sir Percival hatte seinen Gleichmut wieder gewonnen und war zurückgekehrt, während wir dem Grafen zuhörten.
„Es mag zum Teil wahr sein und ist alles sehr gut dargetan“, sagte ich. „Aber ich sehe nicht ein, warum Graf Fosco den Sieg des Verbrechens über die Gesellschaft mit solchem Frohlocken feiern, oder warum Sie, Sir Percival, ihm so enthusiastisch dafür applaudieren sollten.“
„Hörst du es, Fosco?“ sagte Sir Percival spöttisch. „Nimm meinen Rat und schließe Frieden mit Deinen Zuhörern. Sage ihnen, daß es etwas Herrliches um die Tugend ist – das wird ihnen gefallen, kann ich Dir versprechen.“
Der Graf lachte still in sich hinein, und zwei von den weißen Mäusen in seiner Weste stürzten, über das Erdbeben unter derselben entsetzlich erschrocken, heraus, und eilten in ihren Käfig zurück.
„Die Damen“, sagte er, „sollen mir von der Tugend erzählen, mein guter Percival. Sie haben darüber ein besseres Urteil als ich; denn Sie wissen, was Tugend ist, und ich weiß es nicht.“
„Hört ihn an!“ sagte Sir Percival, „ist das nicht entsetzlich?“
„Es ist wahr“, sagte der Graf ruhig. „Ich bin ein Weltbürger und habe in meinem Leben schon so viele verschiedene Arten von Tugend kennengelernt, daß ich jetzt in meinen alten Tagen nicht im Stande bin, die rechte Sorte von der unrechten zu unterscheiden. Hier in England gibt es eine Sorte und da hinten in China eine andere. John Engländer sagt, die meine ist die echte Tugend, und John Chinese sagt, nein, die meine ist die echte. Und ich sage Ja zu dem einen oder Nein zu dem Andern, und bin dabei über das Richtige ebenso sehr im Unklaren bei John in den Reitstiefeln wie bei John mit dem Zopfe. Ach! Meine süße kleine Maus! Komm, und küsse mich. Wie denkst Du über tugendhafte Leute, mein Mäuselinchen? Daß es Leute sind, die Dich warm halten und Dir reichlich zu speisen geben? Gar keine schlechte Idee und jedenfalls eine verständliche.“
„Einen Augenblick, Graf“, unterbrach ich ihn, „auf Ihr Beispiel eingehend, so haben wir doch ohne Frage eine Tugend in England, die ihnen in China fehlt. Die chinesischen Gerichtsobrigkeiten töten Tausende von unschuldigen Menschen auf irgend einen abescheulichen nichtigen Vorwand hin. In England sind wir von aller derartigen Schuld fern, so fürchterliche Verbrechen begehen wir nicht, wir verabscheuen sorgloses Bluvergießen von ganzem Herzen.“
„Ganz recht, Marianne“, sagte Laura, „ein guter Gedanke und gut ausgedrückt.“
„Bitte, gestatten Sie dem Grafen, fortzufahren“, sagte die Gräfin mit strenger Höflichkeit. „Sie werden finden, meine Damen, daß er nie etwas sagt, wofür er nicht die vortrefflichsten Gründe hätte.“
„Ich danke Dir, mein Engel“, sagte der Graf, „darf ich Dir einen Bonbon anbieten?“ Er nahm eine niedliche kleine Schachtel aus der Tasche und stellte sie offen auf den Tisch, „Chocolad à la Vanille“, rief dieser unerschütterliche Mann, indem er fröhlich die Schachtel schüttelte und sich rundum gegen die Gesellschaft verneigte. „Als ein Akt der Huldigung Foscos gegen die bezaubernde Gesellschaft.“
„Sei so gut und fahre fort, Graf“, sagte seine Frau mit einem tückischen Blick auf mich; „tu mir den Gefallen, Miß Halcombe zu widerlegen.“
„Miß Halcombe ist unwiderlegbar“, entgegnete der höfliche Italiener - „das heißt, soweit sie geht. Ja! Ich stimme mit ihr überein. John Bull verabscheut des Chinesen Greueltaten. Es gibt in der Welt keinen flinkern alten Herrn als ihn, um die Fehler anderer wahrzunehmen und keinen langsamern, wo es auf die Entdeckung seiner eigenen ankommt. Ist er aber wirklich auf seine Art so viel besser, als die Leute, die er verdammt? Die englische Gesellschaft, Miß Halcombe, ist ebenso oft die Mitschuldige des Verbrechens, wie sie dessen Feindin ist. Ja! Ja! Das Verbrechen ist in diesem Lande gerade dasselbe, was es in anderen Ländern ist – ebenso oft der gute Freund eines Mannes und derer, die zu ihm gehören, als es sein Feind und der ihrige ist. Ein großer Schurke sorgt für seine Frau und Kinder; je schlechter er ist, desto lebhafter erregt er Eure Teilnahme für seine Familie. Oft sorgt er auch für sich selbst. Ein ausschweifender Verschwender, der fortwährend Geld borgt, wird mehr aus seinen Freunden machen, als der streng rechtliche Mann, der nur einmal in der bittersten Notwendigkeit von ihnen borgt. In ersterem Falle werden die Freunde durchaus nicht erstaunen und deshalb herhalten, im zweiten werden sie sehr überrascht sein und daher zögern, ehe sie etwas herausgeben. Ist das Gefängnis, in welchem Herr Schurke am Ende seiner Laufbahn Wohnung bekommt, ein unangenehmerer Aufenthalt, als das Landarbeitshaus, in dem Herr Biedermann am Ende der seinigen sich zurückziehen muß? Wenn John Howard-Menschenfreund Elend erleichtern will, so sucht er es in Gefängnissen auf, wo es verbrecherisches Elend ist, nicht aber in den Hütten der Armut, wo es tugendhaftes Elend ist. Wer ist derjenige englische Poet, der sich die allgemeinste Teilnahme errungen, der den leichtesten Gegenstand zu pathetischer Dichtung und pathetischer Malerei abgibt? Jener charmante junge Mann, der das Leben mit einer Fälschung begann und es mit Selbstmord beendete. - Euer lieber romantischer, interessanter Chatterton. Welche von zwei verhungernden Nähjungfern kommt Ihrer Ansicht nach wohl am besten weg: die, welche der Versuchung widersteht und ehrlich bleibt, oder die, welche ihr weicht und stiehlt? Ihr wißt alle recht gut, daß diese Person durch diesen Diebstahl ihr Glück macht, es ist eine Reklame für sie von einem Ende zum andern des gutmütigen, mildtätigen England, und als Übertreterin eines Gebotes wird ihr geholfen, während man sie hätte verhungern lassen, so lange sie das Gebot gehalten. Komm her, meine lustige kleine Maus! Hei! Presto! Flink! Ich verwandele dich für den Augenblick in eine respektable Dame. Bleib‘ hier in der Fläche meiner schrecklich großen Hand, mein Mäuschen, und höre mir zu. Du heiratest den armen Mann, den du liebst, Maus, und die eine Hälfte deiner Bekannten bemitleidet dich, während die andere dich tadelt. Jetzt aber verkaufst du dich im Gegenteil für Gold einem Manne, um den du dich keinen Pfifferling scherst, und alle deine Bekannten jubeln; und der Verwalter des öffentlichen Gottesdienstes weihet den schändlichsten aller menschlichen Handelsverträge und lächelt und grinst hernach an deinem Tische, wenn du so gütig gewesen bist, ihn zum Frühstück einzuladen. Hei! Presto! Flink! Sei wieder eine Mus und quieke; denn wenn du noch länger eine Dame bleibst, so würdest du mir zunächst sagen, daß die Gesellschaft das Verbrechen verabscheute, und dann, Maus, würde ich daran zweifeln, ob deine eigenen Augen und Ohren dir wirklich von geringstem Nutzen seien. Ach! Ich bin ein schlechter Mann, Lady Glyde, nicht wahr? Ich spreche aus, was andere Leute bloß denken, und wenn die ganze übrige Welt sich verschwört, die Maske für das Gesicht anzunehmen, so ist die meine die verwegene Hand, welche die plumpe Pappe hinwegreißt und die nackten Knochen darunter zeigt. Ich will mich auf meine großen Elephantenbeine erheben, ehe ich mir in Ihrer unschätzbaren Meinung noch mehr Schaden tue, ich will mich erheben und einen kleinen Spaziergang machen. Teure Damen, wie Ihr vortrefflicher Sheridan sagt, ich gehe und lasse meinen Charakter in Ihren Händen zurück.“
Die Führung der Szenen innerhalb dieses Aktes, das unaufhörliche Intrigenspiel erinnern lebhaft an die Art und weise mancher Sardou‘schen Komödie. - Der dritte kurze Akt eilt in so hastigen Sprüngen, daß unser atemloses Interesse kaum zu folgen vermag, auf die Peripetie zu, nämlich die Vertauschung der Anne Catherick mit Laura und die Einsperrung der letzteren in die Irrenanstalt. Der erste Teil dieses Aktes enthält die unglaublich kühnen Machinationen, durch welche es Fosco gelingt, Marianne bei Seite zu schaffen und Laura nach London zu locken. Dann erleben wir, obwohl nicht als Augenzeugen, Lauras plötzlichen Tod, sowie ihr Begräbnis. Wir werden von der Höhe unserer Erwartungen herabgeschleudert und müssen nach dem Fallen des Vorhanges annehmen, daß nun bloß noch eine nachhinkende Erklärung des geheimnisvollen Zusammenhanges zwischen der Frau in Weiß und Sir Percival übrig sein könne.
Die Eröffnungsszene des vierten Aktes zeigt uns zu unserem maßlosen Erstaunen den Anfang eines völlig unverhofften Endes. Walter Hartright ist zurückgekehrt und weint am Grabe seiner Geliebten, während diese lebendig mit Marianne auf ihn zutritt. Jetzt handelt es sich also darum, die Möglichkeit des scheußlichen Verbrechens jener Personenverwechselung aufzudecken und die sühnende Katastrophe herbeizuführen.
Der vierte Akt enthält die Bemühungen Walters um diesen Endzweck: den Kampf ums Leben zwischen Sir Percival, welcher die Entdeckung seines Geheimnisses vor Augen sieht und Walter, welcher dieser Entdeckung mit dem Mute der Liebe nachjagt. Der Flammentod Sir Percivals beschließt diesen Akt. Als Probe für die großartige Kunst der Schilderung stehe dieselbe hier:
Ich fiel durch den Kirchhof der Tür zu.
Als ich näher kam, stahl sich ein sonderbarer Geruch durch die feuchte, stille Luft mir entgegen. Ich hörte drinnen ein Geräusch, wie von einem zusammenschnappenden Schlosse – ich sah das Licht oben heller und heller werden – eine Glasscheibe zersprang – ich rannte auf die Türe zu und legte meinen Arm dagegen. Die Sakristei brannte.
Ehe ich mich noch rühren, ehe ich nach dieser Entdeckung Atem schöpfen konnte, erfüllte mich ein schwerer Fall von innen gegen die Türe mit Entsetzen. Ich hörte, wie der Schlüssel heftig im Schlosse hin und her gedreht wurde – ich hörte hinter der Türe die Stimme eines Mannes in entsetzlich gellenden Tönen um Hilfe schreien.
Der Bediente, der mir gefolgt war, fuhr schaudernd zurück und fiel auf seine Knie. „O mein Gott!“ rief er aus; „es ist Sir Percival!“
Als die Worte seinen Lippen entfuhren, trat der Küster zu uns – und in demselben Augenblicke ließ sich das Geräusch des Schlüssels im Schlosse noch einmal und zum letztenmal hören.
„Der Herr erbarme sich seiner Seele!“ rief der Küster aus. „Er ist des Todes. Er hat das Schloß verdreht!“
Ich stürzte gegen die Tür. Der eine, alles verzehrende Gedanke, der seit Wochen mein ganzes Innere erfüllt und alle meine Handlungen geleitet hatte, schwand in einer Sekunde aus meinem Geiste. Alle Erinnerungen an das grenzenlose Elend, welches des Mannes herzloses Verbrechen verursacht hatte, an die Liebe, die Unschuld und das Glück, die er so erbarmungslos mit Füßen getreten, an den Eid, den ich im eignen Herzen geschworen, daß ich furchtbare Rechenschaft von ihm fordern wolle – schwand wie ein Traum aus meinem Gedächtnisse. Ich dachte an nichts weiter, als an das Entsetzliche seiner Lage; ich fühlte nichts als den natürlichen menschlichen Drang, ihn von einem furchtbaren Tode zu retten.
„Versuchen Sie die andere Türe!“ schrie ich ihm zu, „versuchen Sie die andere Türe, die in die Kirche führt! Das Schloß ist verdreht. Sie sind des Todes, wenn sie noch einen Augenblick dabei verlieren!“
Es hatte sich, als der Schlüssel zum letztenmale im Schlosse umgedreht wurde, kein erneuter Hilferuf hören lassen, und es war jetzt kein Ton irgend einer Art mehr zu vernehmen, der uns bewiesen hätte, daß er noch am Leben sei. Ich vernahm nichts, als das immer schnellere Knistern der Flammen und das scharfe Zerspringen der Glasscheiben im Gewölbefenster.
Ich sah mich um nach meinen beiden Begleitern. Der Diener war aufgestanden, hatte die Laterne ergriffen und hielt dieselbe mit geistesabwesendem Gesichte gegen die Türe. Der Schreck schien ihn geradezu mit Blödsinn geschlagen zu haben – er wartete an meinen Fersen und folgte mir, wohin ich mich wandte, wie ein Hund. Der Küster saß kauernd, stöhnend und bebend auf einem Grabsteine. Der kurze Blick, den ich auf die beiden warf, genügte, um mich zu überzeugen, daß ich von ihnen keine Hilfe zu erwarten hatte.
Indem ich kaum wußte, was ich tat, und nur nach dem Drange meiner Gefühle handelte, erfaßte ich den Diener und stieß ihn gegen die Mauer der Sakristei. „Bücken Sie sich!“ sagte ich, „und halten Sie sich an den Steinen. Ich werde über Sie aufs Dach steigen – ich werde das Gewölbefenster einbrechen und ihm etwas Luft geben!“
Der Mann zitterte am ganzen Leibe, aber er stand fest. Ich stieg, mit meinem Knittel im Munde, auf seinen Rücken, faßte die Vormauer mit beiden Händen und hatte mich im Nu auf das Dach geschwungen. In der wahnsinnigen Eile und Aufregung des Augenblickes fiel es mir gar nicht ein, daß ich, anstatt bloß die Luft hineinzulassen, die Flamme herauslassen würde. Ich schlug auf das Gewölbefenster und zerbrach das zersprungene, gelöste Glas mit einem Schlage. Das Feuer sprang heraus wie ein wildes Tier aus seinem Hinterhalte. Hätte der Wind es nicht glücklicherweise in der Richtung von mir fortgetrieben, so hätten hiermit alle meine Bemühungen ihr Ende erreicht. Ich kauerte auf dem Dache nieder, als Rauch und Flamme über mich herausströmten. Das Leuchten des Feuers zeigte mir das Gesicht des Dieners, das blödsinnig zu mir herausstierte; den Küster, der aufgestanden war und in Verzweiflung die Hände rang, und die spärliche Bevölkerung des Dorfes, bleiche Männer und erschrockene Frauen, die sich außerhalb des Kirchhofs drängten – die alle in der furchtbaren Glut der Flammen auftauchten und in dem schwarzen, erstickenden Rauche wieder verschwanden. Und der Mann unter mir! - der Mann, der uns allen so nahe und so hoffnungslos außer unserm Bereiche erstickte, verbrannte, starb!
Der Gedanke machte mich beinahe wahnsinnig. Ich ließ mich an den Händen vom Dache herunter und fiel auf den Boden.
„Den Schlüssel zur Kirche!“ schrie ich dem Küster zu. „Wir müssen es von der anderen Seite versuchen – wir mögen ihn noch retten können, wenn wir die innere Tür sprengen.“
„Nein, nein, nein!“ schrie der alte Mann. „Keine Hoffnung! Der Schlüssel zur Kirchentüre und der zur Sakristei sind an demselben Ringe – beide da drinnen! O, Sir, er ist nicht mehr zu retten – er ist jetzt schon Staub und Asche!“
„Sie werden das Feuer von der Stadt aus sehen“, sagte eine Stimme unter den Leuten zu mir. „Sie haben eine Feuerspritze in der Stadt. Sie werden die Kirche retten.“
Ich rief dem Manne zu – er wenigstens hatte noch etwas Geistesgegenwart – ich rief ihm zu, er möge zu mir kommen. Es mußte wenigstens eine Viertelstunde währen, ehe die Feuerspritze uns zu Hilfe kommen konnte. Der grauenvolle Gedanke, so lange in Untätigkeit zu bleiben, war mehr als ich ertragen konnte. Trotz allem, was meine eigene Vernunft mir sagte, überredete ich mich, daß der Unglückliche bewußtlos in der Sakristei am Boden liege und noch nicht tot sei. Falls wir die Tür sprengten, konnte wir ihn nicht noch retten? Ich wußte, wie stark das schwere Schloß war und wie dick die Tür von nägelbeschlagenem Eichenholze – ich wußte, wie hoffnungslos es sei, eins oder das andere auf gewöhnlichem Wege anzugreifen. Aber gab es denn in den abgerissenen Hütten rund umher keinen Balken? Konnten wir uns nicht einen solchen holen und ihn als Sturmbock gegen die Tür anwenden?
Der Gedanke sprang auf in mir, wie die Flammen durch das zerschlagene Gewölbefenster gesprungen waren. Ich sprach zu dem Manne, welcher zuerst die Feuerspritze erwähnt hatte: „Haben Sie Ihre Spitzaxt zur Hand?“ Ja, sie hatten sie. „Und ein Beil, eine Säge und einen Reif?“ Ja! Ja! Ja! „Fünf Schillinge für jeden, der mir hilft!“ Die Worte gaben ihnen Leben. Jener gierige zweite Hunger der Armut: der Hunger nach Geld brachte sie sofort in Bewegung und Tätigkeit. „Zwei von euch – bringt noch Laternen mit, wenn Ihr welche habt! Zwei holen Spitzhacken und Brechwerkzeuge! Die anderen mir nach, um einen Balken zu holen. Sie schrieen – mit gellenden, verhungerten Stimmen schrieen sie Hurra! Die Frauen und Kinder stoben zu beiden Seiten auseinander. Wir stürzten zusammen den Pfad vom Kirchhofe der ersten leeren Hütte zu, hinunter. Kein Mann blieb zurück, außer dem Küster – dem armen, alten Küster, der schluchzend und jammernd auf einem Grabsteine den Verlust der Kirche betrauerte. Der Bediente folgte mir noch immer auf den Fersen; sein weißes, hilfloses, entsetztes Gesicht blickte dicht über meine Schulter hinweg, als wir uns in die Hütte drängten. Es lagen Sparren von der abgerissenen Decke am Boden – doch waren sie zu leicht. Ein Balken lag oben über unseren Häuptern, doch nicht außer dem Bereiche unserer Arme und Hacken – ein Balken, der an beiden Enden in der zerfallenen Mauer festsaß, um den der Boden und die Decke fortgebröckelt war und über dem ein großes Loch im Dache den Himmel zeigte. Wir griffen den Balken an beiden Enden zugleich an. O Gott, wie fest er saß – wie uns Stein und Kalk widerstand. Wir hackten und hieben und rissen. Der Balken wich an einem Ende – er stürzte herunter, gefolgt von einer Schuttmasse. Die Weiber, die sich alle um den Eingang drängten, um uns zuzuschauen, stießen einen Schrei aus – die Männer einen lauten Ausruf – zwei von ihnen lagen am Boden, doch unverletzt. Noch einen Riß mit gesamter Anstrengung – der Balken war an beiden Enden los. Wir hoben ihn auf und befahlen, am Eingange Raum zu machen. Jetzt ans Werk! Jetzt auf die Tür los! Da ist das Feuer, das zum Himmel hinan speiet, heller denn je, um uns zu leuchten! Vorsichtig, den Pfad entlang, vorsichtig mit dem Balken – auf die Türe zu. Eins, zwei, drei – und los! Das Hurrahrufen erschallte unbezähmbar. Wir haben die Tür bereits erschüttert; die Angeln müssen sich lösen, falls das Schloß sich sprengen läßt. Noch einen Stoß mit dem Balken! Eins, zwei, drei – los! Sie weicht! Das schleichende Feuer leckt uns aus jeder Spalte an. Noch einen letzten Stoß! Die Tür bricht krachend ein. Eine große, angsterfüllte, atemlose, erwartungsvolle Stille hält jede lebende Seele umfangen. Wir suchen nach dem Körper. Die sengende Hitze, die unseren Gesichtern begegnet, treibt uns zurück: wir sehen nichts – oben, unten, im ganzen Zimmer sehen wir nichts als eine große Flammenmasse.
„Wo ist er?“ flüsterte der Diener, blödsinnig in die Flammen stierend.
„Er ist Staub und Asche“, sagte der Küster. „Und die Bücher sind Staub und Asche – und o, ihr Herren! Die Kirche wird auch bald Staub und Asche sein.“
Sie waren die einzigen beiden, welche sprachen. Als sie wieder schwiegen, war nichts weiter zu hören, als das Knistern und Lodern der Flammen.
Horch!
Ein scharfer, rasselnder Ton aus der Ferne – dann das hohle Trampeln von Pferdefüßen im schnellen Galopp – dann das Getöse, der alles übertönende Tumult von Hunderten von menschlichen Stimmen, die alle zugleich schreien und rufen. Endlich ist die Feuerspritze da.
Die Leute um mich her wandten sich alle vom Feuer dem Gipfel der Anhöhe zu. Der alte Küster versuchte, ihnen zu folgen, aber seine Kraft war erschöpft. Ich sah, wie er sich an einem der Grabsteine festhielt. „Rettet die Kirche!“ rief er mit matter Stimme, wie wenn er schon jetzt von den Feuerleuten gehört zu werden erwartete. „Rettet die Kirche!“
Der einzige, der sich nicht rührte, war der Bediente. Da stand er – die Augen noch immer mit demselben geistesabwesendem Blicke auf die Flammen geheftet. Ich redete auf ihn hinein und schüttelte ihn am Arme: er war nicht zu erwecken. Er flüsterte bloß immer wieder: „Wo ist er?“
In zehn Minuten war die Spritze aufgestellt; aus dem Brunnen auf der Hinterseite der Kirche versah man sie mit Wasser und trug dann den Schlauch an den Eingang der Sakristei. Falls man jetzt der Hilfe von mir bedurft, so hätte ich sie nicht leisten können. Meine Willenskraft war fort – meine Kräfte erschöpft – der Aufruhr meiner Gedanken war jetzt, da ich wußte, er sei tot, auf furchtbare, plötzliche Weise gestillt. Ich stand nutzlos und hilflos da und stierte in das brennende Zimmer hinein.
Ich sah, wie man langsam das Feuer überwältigte. Die Helle der Glut erbleichte – der Dampf erhob sich in weißen Wolken und die glimmenden Aschenhaufen zeigten sich rot und schwarz auf dem Boden. Es trat eine Stille ein – dann begaben sich die Leute von der Feuerbrigade und von der Polizei an den Eingang – es erfolgte eine Beratung von leisen Stimmen – und dann wurden zwei von den Männern durch die Menge hindurch fortgeschickt. Die Menge wich zu beiden Seiten zurück, um sie durchzulassen.
Nach einer Weile rann ein großes Entsetzen durch das Gedränge, die lebendige Allee wurde langsam breiter. Die Männer kamen auf derselben mit einer Tür aus einer der leeren Hütten zurück. Sie trugen dieselben an die Sakristei und gingen hinein. Die Polizei umringte abermals den Eingang; die Leute schlichen sich zu zweien und dreien aus der Menge heraus und stellten sich hinter die Polizei, um es zuerst zu sehen. Andere warteten in der Nähe, um es zuerst zu hören. Frauen und Kinder gehörten zu den letzteren.
Die Berichte aus der Sakristei fingen an, unter die Menge zu kommen – dieselben fielen langsam von Munde zu Munde, bis sie den Ort erreichten, an dem ich stand. Ich hörte die Fragen und Antworten mit leisen, eifrigen Stimmen um mich her wiederholen.
„Haben sie ihn gefunden?“ „Ja.“ - „Wo?“ „An der Tür. Mit dem Gesichte an der Tür.“ - „An welcher Tür?“ „An der Tür, die in die Kirche führt.“ - „Ist sein Gesicht verbrannt?“ „Nein.“ - „Ja.“ „Nein; versengt, aber nicht verbrannt. Er lag mit dem Gesichte gegen die Tür gelehnt, sag ich Euch ja.“ - „Wer war er? Ein Lord, sagen sie.“ „Nein, kein Lord. Sir Soundso; Sir heißt soviel wie Ritter.“ - „Und wie Baronet.“ „Nein.“ - „Ja doch.“ „Was wollte er da drinnen?“ „Nichts gutes, kannst Du glauben!“ „Tat er es vorsätzlich?“ „Ob er sich vorsätzlich verbrannt hat!“ „Ich meine nicht sich selbst, sondern ob er die Sakristei vorsätzlich verbrannt hat.“ - „Sieht er sehr schrecklich aus?“ „Entsetzlich!“ - „Aber nicht im Gesicht?“ „Nein, nein; im Gesichte nicht so schlimm.“ - „Kennt ihn kein Mensch?“ „Es ist da ein Mann, der sagt, er kennt ihn.“ - „Wer?“ „Ein Bedienter, heißt es. Aber er scheint ganz verdummt zu sein und die Polizei glaubt ihm nicht.“ - „Weiß kein Mensch, wer es ist?“ „Stille -!“
Die laute, klare Stimme eines Mannes in Autorität brachte das leise, summende Gespräch um mich her augenblicklich zum Schweigen.
„Wo ist der Herr, der ihn zu retten versuchte?“ frug die Stimme.
„Hier, Sir – hier ist er!“ Dutzende von eifrigen Gesichtern drängten sich um mich, und Dutzende von Armen trennten die Menge. Der Mann in Autorität kam mit einer Laterne in der Hand zu mir heran.
„Hierher, Sir, wenns gefällig ist“, sagte er ruhig.
Es war mir nicht möglich, zu ihm zu sprechen und unmöglich, mich ihm zu widersetzen, als er meinen Arm faßte. Ich versuchte ihm zu erklären, daß ich den Toten nie zu dessen Lebzeiten gesehen – daß keine Hoffnung vorhanden sei, ihn durch einen Fremden, wie ich war, zu identifizieren. Aber die Worte erstarben mir auf den Lippen. Ich war schwach und stille und hilflos.
„Kennen Sie ihn, Sir?“
Ich stand mitten in einem Kreise von Männern. Drei von ihnen, die mir gegenüber standen, hielten Laternen tief am Boden. Ihre Augen und die Augen aller übrigen waren erwartungsvoll auf mein Gesicht gerichtet. Ich wußte, was zu meinen Füßen lag – ich wußte, warum sie die Laterne so tief am Boden hielten.
„Können Sie ihn identifizieren, Sir?“
Meine Blicke senkten sich langsam. Zuerst sahen sie nichts als ein großes Canevastuch. Das Tröpfeln des Regens auf dasselbe war deutlich zu hören. Ich blickte weiter hinauf an dem Canevastuche entlang, und da am Ende, steif, grimmig und schwarz in dem gelben Scheine – da lag sein totes Gesicht.
So sah ich ihn zum ersten- und zum letztenmale. Es war Gottes Wille gewesen, daß er und ich einander so begegneten.
Trotzdem Walter durch die freiwilligen Geständnisse der alten Mrs. Catherick in den Besitz des Geheimnisses der Frau in Weiß gekommen ist, ist ihm doch gerade durch Sir Percivals Tod die Möglichkeit genommen, Foscos Schuld darzutun. Und so sehen wir dem fünften Akte abermals mit banger Erwartung entgegen. Da ist es denn der von uns fast vergessene kleine Pesca, welcher des unerreichbar scheinenden Fosco Schicksal wird. Ein völlig überraschender, aber durch seine innere Gerechtigkeit durchaus befriedigender Ausgang. Auch der gefangene und besiegte Fosco bleibe seinem Wesen durchaus getreu. Wir bedauern, daß er nicht gehenkt wird, aber ich glaube, wir würden ihn auch noch am Galgen bewundern. Foscos Benehmen, sowie der Ton seiner schriftlichen Geständnisse in dieser letzten Szene sind geradezu großartig. Der Schlußakkord klingt in Moll aus, wie es sich nach einer so erschütternden Tragödie von selbst versteht, aber in reiner, mild beruhigender Harmonie. Wenn man nach dieser Andeutung des vollendet künstlerischen, dramatischen Aufbaues die „Frau in Weiß“ nochmals durchliest, so wird man mir recht geben, wenn ich diesen Roman als ein nachahmungswürdiges Muster seiner Gattung hinstelle. Es ist sehr viel daraus zu lernen, die ganze Technik des modernen realistischen Romanes!
Vorheriges Kapitel
Nächstes Kapitel
Inhaltsverzeichnis für diese Geschichte
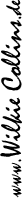
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten