
Der Mondstein
Die Erzählung
Erste Periode
Der Verlust des Diamanten
l848.
Von Gabriel Betteredge, Haushofmeister im Dienste
Lady
Julia Verinder’s, berichtete Ereignisse.
Erstes Capitel.
Im ersten Theil von Robinson Crusoe auf Seite 129 steht zu lesen:
»Jetzt sah ich, wiewohl zu spät ein, wie thöricht es sei, etwas zu unternehmen, bevor man die Kosten berechnet und bevor man sich vergewissert hat, daß man die Kraft besitzt, das Unternommene durchzuführen.«
Noch gestern fiel mir diese Stelle beim Oeffnen von Robinson Crusoe in die Augen, und diesen Morgen, 21. Mai 1850, kam Mylady’s Neffe, Herr Franklin Blake, und hatte die folgende kurze Unterhaltung mit mir.
»Betteredge,« begann Herr Franklin »ich habe mit unserm Advocaten über einige Familien-Angelegenheiten gesprochen, und neben andern Dingen kam auch das vor zwei Jahren geschehene Verschwinden des Familien-Diamanten aus dem Hause meiner Tante in Yorkshire zur Sprache. Der Advokat ist der Meinung, die ich theile, daß der ganze Vorgang im Interesse der Wahrheit so bald wie möglich zu Papier gebracht werden sollte.«
Da ich nicht sogleich merkte, worauf er hinaus wollte, und es ein für allemal um des lieben Friedens Willen für richtig halte, mich auf die Seite der Advokaten zu stellen, so sagte ich: »Der Meinung bin ich auch.«
Herr Franklin fuhr fort: »In dieser Diamantengeschichte,« sagte er, »sind schon unschuldige Personen, wie Sie wissen, verdächtigt worden. Es ist zu fürchten, daß in Ermangelung eines Berichts über die Thatsachen, auf welchen sich unsere Nachkommen berufen können, auch künftig das Andenken unschuldiger Personen verunglimpft werden möchte. Aus diesen Gründen sollte diese unsere sonderbare Familiengeschichte niedergeschrieben werden und ich glaube, Betteredge, der Advokat und ich haben die rechte Art, wie es mit dem Aufzeichnen zu halten sein würde, gefunden.«
Ohne Zweifel sehr angenehm für Beide, nur sah ich noch nicht ein, was ich mit der Sache zu thun haben könnte.
»Wir haben gewisse Thatsachen zu berichten,« fuhr Franklin fort, »und wir haben gewisse bei diesen Thatsachen betheiligte Personen, die im Stande sind, diesen Bericht zu machen Von dieser einfachen Sachlage ausgehend, meint der Advokat, wir sollten alle der Reihe nach von der Geschichte des Mondsteins niederschreiben was Jeder erlebt hat, und weiter nichts. Der Bericht muß damit anfangen, zu erzählen, wie der Diamant zuerst in die Hände meines Onkels Herncastle gelangt ist, als er vor fünfzig Jahren in der englischen Armee diente. Diese einleitende Erzählung besitze ich schon in Gestalt eines alten Familiendocuments welches die nöthigen Details nach der Aussage eines Augenzeugen enthält. Das nächst zu Berichtende ist: wie der Diamant vor zwei Jahren in das Haus meiner Tante in Yorkshire kam und wie er wenig mehr als zwölf Stunden später wieder verloren ging. Kein Mensch weiß so gut wie Sie, Betteredge, was zu jener Zeit im Hause vorging. Sie müssen also die Feder in die Hand nehmen und die Geschichte erzählen.«
So erfuhr ich, was ich persönlich mit der Diamantengeschichte zu thun habe. Wenn man wissen will, wie ich mich unter diesen Umständen bei der Sache benahm, so will ich nur bemerken, daß ich that, was jeder Andere an meiner Stelle wahrscheinlich gethan haben würde. Ich erklärte mich bescheidentlich der mir zugedachten Aufgabe durchaus nicht gewachsen und war mir dabei vollkommen bewußt, daß ich die Aufgabe sehr gut würde lösen können, wenn ich nur meine Talente in Bewegung setzen wollte. Jetzt ist es zwei Stunden her, daß mich Herr Franklin verlassen hat. Kaum war er aus der Thür, als ich mich an mein Schreibpult setzte, um meinen Bericht zu beginnen. Und da sitze ich nun die ganze Zeit, trotz aller meiner Talente, und weiß mir nicht zu helfen, und sehe ein, was Robinson Crusoe auch eingesehen hatte, wie ich oben angeführt habe, wie thöricht es sei, etwas zu unternehmen, bevor man die Kosten berechnet und sich vergewissert hat, ob man die Kraft besitzt, das Unternommene durchzuführen. Ich bitte wohl zu bedenken, daß mir die Stelle grade gestern, also einen Tag ehe ich meine jetzige Arbeit leichtsinniger Weise übernommen habe, zufällig in die Augen gefallen ist, und erlaube mir die Frage, wenn das nicht Prophezeihung ist, was denn.
Ich bin nicht abergläubisch, ich habe meiner Zeit eine Masse von Büchern gelesen, ich bin ein Gelehrter auf eigene Faust. Obgleich ich über siebzig bin, so ist mein Gedächtnis; noch frisch und sind meine Beine noch rüstig. Man nehme es daher gefälligst nicht als die Behauptung eines unwissenden Menschen hin, wenn ich sagte, daß es kein zweites Buch wie Robinson Crusoe giebt. Seit Jahren habe ich dies Buch gewöhnlich mit einer Pfeife Tabak im Munde zu Rathe gezogen und habe in allen Lagen des Lebens einen erprobten Freund in der Noth darin gefunden. Wenn ich schlechter Laune bin: Robinson Crusoe, wenn ich Rath brauche: Robinson Crusoe, in vergangenen Tagen, wenn mein Weib mich plagte und jetzt, wenn ich einen Schluck zu viel genommen habe: Robinson Crusoe; ich habe sechs Robinson Crusoe’s mit angestrengtem Lesen in meinem Dienst verbraucht. An Myladys letztem Geburtstage schenkte sie mir ein siebentes Exemplar. Bei dieser Gelegenheit trank ich einen Schluck zu viel und Robinson Crusoe brachte mich wieder in Ordnung. Das Exemplar kostet vier Schillinge sechs Pence, ist blau gebunden und mit einem Titelkupfer versehen.
Dies sieht aber nicht aus wie der Anfang zu einer Geschichte des Diamanten, nicht wahr? Ich schwatze Gott weiß was und gerathe Gott weiß wohin. Ich will ein neues Blatt Papier nehmen, wenn’s dem Leser gefällig ist, und von Frischem anfangen.

Zweites Capitel.
Eben habe ich von Mylady gesprochen Nun wäre der Diamant nie in unser Haus gekommen, wo er verloren ging, wenn er nicht Myladys Tochter geschenkt worden wäre, und Mylady’s Tochter hätte nie das Geschenk bekommen können, wenn Mylady sie nicht mit Schmerzen geboren hätte. Wenn wir daher mit Mylady anfangen, so können wir ziemlich sicher sein, unsere Erzählung früh genug zu beginnen, und eine solche Sicherheit ist wahrhaftig beim Beginn einer Arbeit, wie sie mir auferlegt ist, schon ein großer Trost.
Wer etwas von der feinen Welt weiß, hat gewiß von den drei schönen Fräulein Herncastle gehört. Fräulein Adelaide, Fräulein Caroline und Fräulein Julia, welche letztere die jüngste und nach meiner Meinung die beste von den drei Schwestern war, und ich hatte Gelegenheit es zu beurtheilen, wie man gleich sehen wird. Ich trat in die Dienste ihres Vaters, des alten Lords, der uns Gottlob bei dieser Diamantengeschichte nichts angeht. Er hatte die schärfste Zunge und das schlimmste Temperament, die mir bei irgend einem Menschen, hoch oder niedrig, je vorgekommen sind. Ich trat also, wie gesagt, in die Dienste des alten Lord als Page zur Aufwartung der drei jungen Damen, als ich fünfzehn Jahre alt war. Da blieb ich, bis Fräulein Julia den verstorbenen Lord Verinder heirathete. Ein vortrefflicher Mann, der nur Jemanden brauchte, der ihn zu nehmen wußte, und unter uns gesagt, er fand Jemanden, der das verstand, und was mehr ist, er gedieh und wurde dick und fett dabei, und lebte glücklich und starb zufrieden, von dem Tage an, wo Mylady mit ihm zur Kirche ging, um ihn zu heirathen, bis zu dem Tage, wo er seinen letzten Athemzug aushauchte und sie seine Augen für immer schloß.
Ich habe vergessen zu sagen, daß ich mit der jungen Frau nach ihres Gatten Haus und Gütern hierher zog. »John,« sagte sie zu ihm, »ich kann ohne Gabriel Betteredge nicht fertig werden.« »Mylady,« antwortete er, »ich auch nicht.« Das war seine Art, mit ihr zu verkehren, und so kam ich in seinen Dienst. Mir war es ganz einerlei, wo ich hinkam, so lange ich nur mit meiner Herrin zusammen war.
Als ich sah, daß Mylady sich für ländliche Arbeiten, für die Meiereien und dergleichen interessirte, interessirte ich mich auch dafür, umso mehr, als ich selbst der siebente Sohn eines kleinen Pächters war. Mylady stellte mich unter den Gutsverwalter und ich gab mir Mühe und erwarb mir Zufriedenheit und wurde dafür auch befördert. Nach Verlauf einiger Jahre sagte Mylady, wenn ich nicht irre an einem Montag: »John, Dein Gutsverwalter ist ein dummer alter Mann, gieb ihm eine gute Pension und setze Gabriel Betteredge an seine Stelle.« Am Dienstag sagte Sir John: »Mylady, ich habe dem Gutsverwalter eine gute Pension ausgesetzt und habe Gabriel Betteredge seine Stelle gegeben.« Man hört leider genug von Eheleuten, die schlecht mit einander leben, hier haben wir ein Beispiel vom Gegentheil, welches Einigen zur Warnung und Andern zur Ermuthigung dienen mag. Unterdessen will ich in meiner Geschichte fortfahren.
Gut also, da saß ich in der Wolle, wird man sagen. Auf einem ehrenvollen Vertrauensposten mit einem kleinen eigenen Häuschen zum Wohnen, mit meiner Beaufsichtigung der Arbeiten auf den Gütern am Morgen, meiner Buchführung am Nachmittag und meiner Pfeife und meinem Robinson Crusoe am Abend; was in der Welt brauchte es mehr zu meinem Glück? Man vergesse aber nicht, was Adam sich wünschte, als er noch allein im Paradiese war, und wenn man diesen Wunsch bei Adam nicht tadelt, so darf man ihn auch bei mir nicht tadeln. Das Frauenzimmer, auf das ich meinen Blick richtete, war meine Haushälterin. Sie hieß Selina Goby. Ich finde, der selige William Cobbett hat Recht: Wenn man eine Frau sucht, muß man sehen daß sie manierlich ißt und ihre Füße fest auf den Boden setzt. Wenn sie diese Eigenschaften hat, kann man ruhig sein. Selina Goby genügte in beiden Beziehungen, was ein Grund war, um sie zu heirathen. Einen anderen Grund fand ich selbst heraus. Ich hatte Selina Goby wöchentlich für ihre Kost und Dienste etwas zu bezahlen. Wenn Selina Goby meine Frau wurde, konnte sie mir nichts für ihre Kost berechnen und mußte mir ihre Dienste umsonst leisten. Das waren die Gesichtspunkte, aus denen ich die Sache betrachtete, Oeconomie mit einem Anflug von Liebe. Ich trug die Sache, wie es meine Pflicht war, meiner Herrin vor. »Ich habe mir Selina Goby durch den Kopf gehen lassen,« sagte ich, »und bin zu der Ueberzeugung gelangt, Mylady, daß es billiger ist, sie zu heirathen, als sie zur Haushälterin zu haben.«
Mylady lachte laut auf und sagte, sie wisse nicht, was sie ärger finden solle, meine Sprache oder meine Grundsätze. Sie fand vermuthlich etwas bei der Sache, was nur die vornehmen Leute verstehen. Ich verstand nur so viel, daß für mich nichts im Wege sei, die Sache jetzt Selina vorzulegen, und so that ich. Und was sagte diese? Wer so fragt, muß bei Gott wenig von Frauen wissen. Natürlich sagte sie ja. Als die Zeit herankam und die Rede davon war, daß ich mir für die Feierlichkeit einen neuen Rock anschaffen müsse, fing ich an, wieder schwankend zu werden. Ich habe mich bei anderen Männern erkundigt, was sie in ähnlicher Lage empfunden haben, und sie haben mir Alle zugegeben, daß sie ungefähr eine Woche vor dem entscheidenden Tage von der Sache loszukommen wünschten. Ich ließ es nicht ganz beim Wünschen bewenden, ich machte einen wirklichen Versuch, loszukommen. Nicht, daß ich es umsonst verlangt hätte, ich war ein zu billig denkender Mann, um zu erwarten, daß sie mich umsonst loslassen würde. Entschädigung für das Frauenzimmer, wenn sie den Mann wieder losläßt, ist in England Rechtens; dieses Gesetzes eingedenk und nachdem ich mir die Sache wohl überlegt hatte, bot ich Selina Goby ein Federbett und fünfzig Shilling, um von dem Geschäft wieder abzukommen. Man wird es kaum glauben, aber es ist doch wahr: Sie war thöricht genug, meinen Vorschlag abzulehnen. Da war natürlich alle Hoffnung für mich vorbei. Ich schaffte mir den neuen Rock so billig wie möglich an und ließ mich alles Uebrige so wenig wie möglich kosten. Wir waren nicht gerade ein glückliches Paar, aber auch kein unglückliches: wir waren halb das Eine und halb das Andere. Wie es kam, weiß ich nicht, aber wir waren uns immer einander im Wege. Wenn ich die Treppe hinaufgehen wollte, so konnte ich sicher sein, daß meine Frau die Treppe hinunter kam, oder umgekehrt, wenn meine Frau die Treppe hinunter wollte, so war ich im Begriff, hinauf zu gehen. So ist es einmal nach meiner Erfahrung in der Ehe.
Nachdem das Caramboliren auf der Treppe fünf Jahre lang gedauert hatte, gefiel es der allweisen Vorsehung, meine Frau von mir zu nehmen und uns so von einander zu erlösen. Ich blieb mit meiner kleinen Penelope allein übrig. Kurz nachher starb Sir John und Mylady blieb mit ihrer Tochter Fräulein Rachel allein. Ich müßte mich sehr schlecht über Mylady ausgedrückt haben, wenn ich noch zu sagen brauchte, daß meine Herrin sich meiner kleinen Penelope annahm und daß sie in die Schule geschickt und unterrichtet und ein gescheidtes Mädchen wurde. Als sie alt genug dazu war, wurde sie Fräulein Rachels Kammerjungfer. Was mich anlangt, so bekleidete ich mein Amt als Gutsverwalter ununterbrochen weiter bis zum Weihnachtstag 1847, wo eine Veränderung in meinem Leben eintrat. An jenem Tage lud sich Mylady zu einer Tasse Thee allein mit mir in meinem Häuschen bei mir ein. Sie bemerkte, daß ich von der Zeit an gerechnet, wo ich als Page zu dem alten Lord in’s Haus gekommen, mehr als fünfzig Jahre in ihren Diensten gewesen sei, und gab mir eine schöne wollene Weste, die sie selbst für mich gestrickt hatte, um mich an kalten Wintertagen damit warm zu halten.
Ich nahm dieses prachtvolle Geschenk entgegen und fühlte mich ganz unfähig, Worte zu finden, mit denen ich meiner Herrin für die mir erwiesene Ehre hätte danken können. Zu meinem größten Erstaunen aber stellte es sich bald heraus, daß die Weste kein Ehrengeschenk, sondern eine Bestechung sei. Mylady hatte herausgefunden, daß ich alt werde, bevor ich es selbst gemerkt hatte, und sie war zu mir gekommen, um mich, wenn ich so sagen darf, zu beschwatzen, meine anstrengende Beschäftigung im Freien als Gutsverwalter aufzugeben und meine Tage als Haushofmeister im Schloß in Ruhe zu beschließen. Ich wehrte mich so gut ich konnte gegen die unwürdige Zumuthung, mich zur Ruhe zu setzen. Aber meine Herrin kannte meine schwache Seite und stellte mir die Sache als eine Gefälligkeit gegen sie vor. Unsere Unterhaltung endete damit, daß ich mir die Augen wie ein alter Narr mit meiner wollenen Weste trocknete und sagte, ich wolle mir die Sache überlegen.
Meine Gemüthsverfassung bei dieser Ueberlegung, nachdem Mylady mich verlassen hatte, war wirklich schrecklich und so nahm ich meine Zuflucht zu dem Mittel, das ich in zweifelhaften und schwierigen Fällen noch nie vergebens angewandt hatte. Ich steckte mir eine Pfeife an und schlug meinen Robinson Crusoe auf. Keine fünf Minuten hatte ich in diesem merkwürdigen Buche gelesen, da stieß ich auf folgende tröstliche Stelle auf Seite 158: »Heute lieben wir, was wir morgen hassen.« Auf der Stelle sah ich, was ich zu thun hatte. Heute war ich ganz von dem Wunsche erfüllt, Gutsverwalter zu bleiben, morgen würde ich nach Robinson Crusoe’s Wort ganz anders denken. Also mußte ich, so lange ich in dieser Stimmung von »morgen« war, mich auf morgen richten, und die Sache war gethan. Nachdem mein Gemüth so beruhigt war, legte ich mich als Lady Verinder’s Gutsverwalter zu Bett und stand am nächsten Morgen als Lady Verinder’s Haushofmeister in einer ganz behaglichen Stimmung auf, die ich lediglich Robinson Crusoe verdanke.
Eben sieht mir meine Tochter Penelope über die Schulter, um zu sehen, was ich bis jetzt geschrieben habe. Sie bemerkt, daß es sehr schön geschrieben ist und Alles die reine Wahrheit, aber sie macht eine Einwendung Sie sagt, was ich bis jetzt geschrieben habe, ist durchaus nicht das, was ich schreiben sollte. Ich solle die Geschichte des Diamanten schreiben und statt dessen habe ich meine eigene Geschichte geschrieben, sonderbar genug und mir selbst unbegreiflich. Ich möchte wohl wissen, ob es den Herren, die vom Bücherschreiben leben, auch wie mir begegnet, daß ihnen mitten in ihren Erzählungen ihre eigene Geschichte in die Feder kommt. Wenn dem so ist, so kann ich mich sehr gut in ihre Lage versetzen. Einerlei, da habe ich schon wieder verkehrt angefangen, was ist nun zu thun? So viel ich sehe, nichts Anderes, als für meine Leser: nicht die Geduld zu verlieren, und für mich: die ganze Geschichte zum dritten Mal von vorne anzufangen.

Drittes Capitel.
Auf zwei Weisen habe ich versucht, über die Art, wie ich die Geschichte gut anfangen soll, in’s Reine zu kommen; erstens indem ich mir den Kopf zerkratzt habe, was zu nichts führte, zweitens indem ich meine Tochter Penelope zu Rathe, zog, die mich auf eine ganz neue Idee gebracht hat. Penelope ist der Meinung, ich müsse die Begebenheiten von jedem Tage niederschreiben, und da anfangen, wo wir erfahren, daß Herr Franklin Blake zu einem Besuche bei uns erwartet werde, Wenn man einmal auf diese Art sein Gedächtniß auf einen bestimmten Tag fixiert hat, ist es wunderbar, wie das Gedächtniß wenn es einmal einen solchen Anstoß bekommen hat, Einem zu Hilfe kommt. Die einzige Schwierigkeit besteht darin, erst einmal die Daten festzustellen. Das will aber Penelope für mich übernehmen, aus ihrem eigenen Tagebuche zu thun, welches sie schon in der Schule zu führen angehalten wurde und das sie seitdem immer fortgeführt hat. Auf einen daraufhin von mir gemachten Vorschlag, nämlich daß sie statt meiner die Geschichte nach ihrem Tagbuche erzählen sollte, entgegnete Penelope mit einem zornigen Blick und erröthend, daß ihr Tagebuch nur für sie allein sei und daß kein lebendes Wesen außer ihr selbst jemals erfahren solle, was darin steht. Als ich sie fragte, was das zu bedeuten habe, sagte Penelopin »Dummes Zeug!« und ich sagte: »Liebesgeschichten!«
Um, nun also nach Penelopes Plan anzufangen, habe ich zu sagen, daß ich am Mittwoch den 24. Mai 1848 zu Mylady in ihr Wohnzimmer beschieden wurde.
»Gabriel,« sagte Mylady zu mir, »da sind Nachrichten, die Sie überraschen werden. Franklin Blake ist wieder da. Er ist eben eine Zeit lang bei seinem Vater in London gewesen und kommt morgen zu uns, um bis nächsten Monat bei uns zu bleiben und Rachel’s Geburtstag mit zu feiern.«
Wenn ich einen Hut in der Hand gehabt hätte, so hätte mich nur der Respect vor meiner Herrin abhalten können, den Hut vor Freuden an die Decke zu werfen. Ich hatte Herrn Franklin nicht gesehen, seit er als Kind in unserm Hause gelebt hatte. Er war in meiner Erinnerung der herzigste Junge, der je einen Kreisel gedreht oder ein Fenster zerbrochen hat. Fräulein Rachel, die anwesend war und gegen die ich das bemerkte, erwiderte, daß er nach ihrer Erinnerung der abscheulichste Tyrann gewesen sei, der jemals eine Puppe gequält habe, und der grausamste Treiber eines erschöpften kleinen Mädchens beim Pferdspielen, den man in England finden könne. »Ich zittere vor Entrüstung und keuche vor Ermattung, wenn ich an Franklin Blake denke,« waren Rachel’s letzte Worte.
Man wird fragen, wie es kam, daß Herr Franklin die ganze Zeit von seiner ersten Jugend bis zu seinen Mannesjahren im Auslande zubrachte. Meine Antwort ist: Weil sein Vater das Unglück hatte, der nächste Erbe eines Herzogthums zu sein, ohne es beweisen zu können.
Die Sache war kurz folgende:
Mylady’s älteste Schwester heirathete den berühmten Herrn Blake, der eben so bekannt durch seinen Reichthum wie durch seinen großen Proceß war. Wie viele Jahre er die Gerichte des Landes in Anspruch nahm, um den Herzog außer Besitz und sich selbst an seine Stelle zu setzen, wie vieler Advokaten Taschen er bis zum Platzen füllte, wie viele sonst friedliche Leute er zum Streit über die Frage brachte, ob er Recht oder Unrecht habe, das Alles genau zu erzählen, würde über meine Kräfte gehen. Seine Frau und zwei von seinen drei Kindern starben, bevor die Gerichte sich entschlossen, ihn abzuweisen und ihm kein Geld mehr abzunehmen. Als Alles vorbei und der Herzog in seinem Besitz gesichert war, fand Herr Blake, daß die einzige Art, mit seinem Vaterland für die Behandlung, die es ihm habe angedeihen lassen, quitt zu werden, die sei, seinem Lande nicht die Ehre der Erziehung seines Sohnes zu Theil werden zu lassen. »Wie kann ich den Institutionen meines Landes Vertrauen schenken,« war sein Ausspruch, »nachdem ich durch diese Institutionen so schlecht behandelt worden bin.« Wenn man hinzu nimmt, daß Herr Blake alle Knaben, seinen eigenen mit einbegriffen, haßte, so wird man begreifen, daß die Sache nur aus eine Art enden konnte. Der kleine Franklin wurde aus England entfernt und nach dem herrlichen Deutschland geschickt, um Institutionen übergeben zu werden, denen sein Vater, wie er sich ausdrückte, vertrauen könne. Herr Blake selbst blieb, wohlgemerkt, ruhig in England, um für die Besserung seiner Landsleute im Parlament zu wirken und eine Darlegung seiner Proceß Angelegenheit auszuarbeiten, welche noch heute nicht vollendet ist.
Da, Gottlob, das wäre gethan. Mit dem alten Blake brauchen wir uns nun nicht weiter zu befassen. Ueberlassen wir ihn seinem Herzogthum und kommen wir endlich zu dem Diamanten.
Der Diamant bringt uns wieder zu Herrn Franklin zurück, der die unschuldige Ursache davon war, daß dieser verwünschte Edelstein in unser Haus kam.
Unser lieber Junge vergaß uns nicht im Auslande. Er schrieb uns ab und zu, bisweilen an Mylady, bisweilen an Fräulein Rachel, bisweilen an mich. Wir hatten vor seiner Abreise ein Geschäft mit einander gemacht, welches darin bestand, daß er sich von mir ein Knäuel Bindfaden, ein Messer mit vier Klingen und sieben Shilling sechs Pence lieh, die ich bis jetzt noch nicht wieder gesehen habe und wohl auch nicht wieder zu sehen bekommen werde. Seine Briefe an mich hatten hauptsächlich fernere Darlehen zum Gegenstande. Wie es ihm im Auslande ging, wie er an Jahren und Größe zunahm, erfuhr ich immer von Mylady. Nachdem er Alles gelernt hatte, was die deutschen Institutionen ihn lehren konnten, machte er den Franzosen und dann den Italienern einen Besuch. Da machten sie ihn, so weit ich es beurtheilen kann, zu einer Art von Universalgenie. Er schriftstellerte ein wenig, er malte ein wenig, er sang, spielte und componirte ein wenig, immer glaube ich auf anderer Leute Kosten. Das Vermögen seiner Mutter, 700 Lftr. jährlich, fiel ihm zu, als er mündig wurde, und lief ihm durch die Finger wie durch ein Sieb. Je mehr Geld er hatte, desto mehr brauchte er, in seiner Tasche war ein Loch, das keine Kunst zunähen konnte. Wohin er kam, war er wegen seines lebhaften, liebenswürdigen Wesens beliebt. Er reiste herum und lebte bald hier, bald dort, und seine Adresse, wie er sie selbst aufzugeben pflegte, war: »Europa poste restante.« Zweimal hatte er die Absicht gehabt, zu uns zum Besuche zu kommen, und beide Male stand, mit Respect zu melden, eine unnennbare Dame im Wege und hielt ihn zurück. Sein dritter Versuch endlich gelang, wie man schon aus der Mittheilung Mylady’s gesehen hat. Am Dienstag den 25. Mai sollten wir zum ersten Mal sehen, was für ein Mann unser Herzensjunge geworden sei. Er war von guter Race, er hatte einen hohen Sinn und war nach unserer Rechnung fünfundzwanzig Jahre alt. Jetzt weiß der Leser gerade so viel von Herrn Franklin Blake, als ich von ihm wußte, bevor er wieder in unser Haus kam.
Jener Dienstag war der herrlichste Sommertag, den man sich denken kann, und Mylady und Fräulein Rachel, die Herrn Franklin nicht vor Tisch erwarteten, waren zum Frühstück zu einigen Freunden in der Nachbarschaft gefahren.
Als sie fort waren, ging ich in das für unsern Gast hergerichtete Fremdenzimmer und sah, ob Alles in Ordnung sei. Da ich um jene Zeit nicht nur Mylady’s Haushofmeister, sondern auf meinen besonderen Wunsch auch ihr Kellermeister geworden war, weil es mich verdroß, die Schlüssel zu des verstorbenen Sir John’s Keller in andern Händen zu sehen, ging ich dann in den Keller und holte ein Paar Flaschen von unserm famosen Latour herauf und stellte sie in die warme Sonne, damit sie bei Tisch die rechte Temperatur hätten.
Ich beschloß, mich selbst auch in die warme Sonne´zu setzen, weil ich wußte, daß, was für alten Rothwein gut sei, auch alten Menschen gut thue, und nahm meinen Gartenstuhl, um damit in den Hintergarten zu gehen, als ich durch einen trommelähnlichen Klang, der von der Vorderseite des Hauses her an mein Ohr drang, zurückgehalten wurde. Ich ging nach vorn und sah drei mahagonifarbene Indier in weißen leinenen Kitteln und Beinkleidern, die sich das Haus ansahen. Als ich genauer zusah, fand ich, daß die Indier kleine Handtrommeln um den Hals hängen hatten. Hinter ihnen stand ein kleiner schmächtiger, blondhaariger englischer Junge, der einen Handsack trug. Ich hielt die Kerle für umherziehende Jongleurs und den Jungen für den Träger ihrer Geräthschaften. Einer von den Dreien, der Englisch sprach und, wie ich bekennen muß, sehr feine Manieren hatte, bewies mir durch seine Mittheilungen sofort, daß meine Vermuthung richtig sei. Er bat um die Erlaubniß, vor der Herrin des Hauses seine Kunststücke machen zu dürfen. Ich bin kein Griesgram, ich amüsire mich gern und bin der Letzte, der einem Menschen mißtraut, weil er ein bischen dunklere Haut hat, als ich. Aber Jeder hat seine Schwäche und meine Schwäche besteht darin, daß ich, wenn ich weiß, daß Silbergeräth in der Geschirrkammer offen dasteht, augenblicklich, sobald ich eines umherziehenden Fremden mit besonders feinen Manieren ansichtig werde, an dieses Geschirr denken muß, und ich complimentirte ihn und seine Gesellschaft vom Hause weg. Ich meinerseits kehrte zu meinem Gartenstuhl zurück und verfiel, um die Wahrheit zu gestehen, wenn auch nicht gerade in einen festen Schlaf, doch in einen dem Schlaf ähnlichen Zustand.
Auf einmal wurde ich durch meine Tochter Penelope aufgeschreckt, die angelaufen kam, als ob das Haus in Flammen stände. Und warum? Sie verlangte die sofortige Festnahme der drei indischen Jongleurs und zwar deshalb, weil sie wüßten, wen wir aus London zum Besuch erwarteten, und weil sie gewiß gegen Herrn Franklin Blake etwas Böses im Schilde führten.
Der Name Franklin ermunterte mich. Ich machte die Augen weit auf und bat meine Tochter, sich zu erklären. Es ergab sich, daß Penelope direct aus des Pförtners Wohnung komme, wo sie mit der Tochter des Pförtners geplaudert hatte. Die beiden Mädchen hatten die drei Indier in Begleitung des Jungen aus der Pforte gehen sehen, nachdem ich sie wegcomplimentirt hatte. Die Mädchen kamen auf den Einfall, daß der Junge von den Fremden schlecht behandelt werde, so weit ich einsehen konnte, aus keinem andern Grunde, als weil der Junge hübsch und zart aussah, —— und hatten sich an der inneren Seite der Hecke, welche das Gut von der Landstraße trennt, entlang geschlichen und die Fremden durch die Hecke hindurch beobachtet.
Sie sahen da, daß die Kerle sich erst nach allen Seiten umsahen, um sich zu vergewissern, daß sie allein seien, dann drehten sie sich alle Drei um und blickten scharf nach der Richtung des Hauses hin. Dann kauderwelschten sie, stritten sich in ihrer Sprache und sahen sich einander an wie Leute, die ihrer Sache nicht recht sicher sind. Dann wandten sie sich an den kleinen englischen Jungen, als ob sie von ihm Auskunft erwarteten. Endlich sagte der Anführer auf Englisch zu dem Jungen: »Halt’ Deine Hand auf.« Bei diesen Worten, versicherte meine Tochter Penelope, sei es ihr gewesen, als müsse ihr das Herz im Leibe zerspringen. Ich dachte bei mir, daß ihr Corset wohl Schuld daran gewesen sein möge.
Ich sagte aber nur: »Mich schauder’s bei der Geschichte.«
NB. Frauen lieben solche Aeußerungen
Weiter: Der Junge trat zurück, schüttelte mit dem Kopfe, er habe keine Lust die Hand hinzuhalten Der Indier fragte ihn darauf gar nicht unfreundlich, ob er lieber nach London zurückgeschickt und wieder dahin gebracht werden wolle, wo sie ihn in einem offenen Korbe unter freiem Himmel schlafend, als ein hungriges, verlassenes Kind gefunden hätten. Damit, scheint es, war die Schwierigkeit beseitigt. Der kleine Bursche hielt seine Hand widerwillig hin, worauf der Indier aus seiner Brusttasche eine Flasche zog und aus derselben etwas von einer schwarzen Flüssigkeit wie Tinte in die hohle Hand des Kindes goß. Der Indier berührte dabei den Kopf des Jungen, machte Zeichen in der Luft und sagte dann: »Sieh her.« Der Junge stand starr da wie ein Marmorbild und sah auf die Tinte in seiner Hand.
So weit schien mir die Sache nur wie ein Jongleurkunststück mit einer albernen Vergeudung von Tinte, und ich fing an, wieder schläfrig zu werden, als Penelopes fernere Worte mich abermals aufrüttelten.
Die Indier sahen sich nochmals nach allen Seiten um und darauf sprach der Anführer zu dem Jungen die Worte: »Sieh den englischen Herrn, der aus dem Auslande kommt.«
Der Junge sagte: »Ich sehe ihn.«
Der Indier fragte: »Kommt der Fremde heute auf dieser Straße und auf keiner anderen nach diesem Hauses?«
Der Knabe antwortete: »Der Fremde kommt heute auf dieser Straße und auf keiner anderen nach diesem Hause.«
Nach einer kleinen Pause that der Indier eine zweite Frage.
Er fragte: »Hat der englische Herr ihn bei sich?«
Der Knabe antwortete gleichfalls nach einer kleinen Pause: »Ja.«
Die dritte und letzte Frage des Indiers war: »Wird der Fremde, wie er es versprochen hat, gegen Abend hierherkommen?«
Der Junge antwortete: »Das kann ich nicht sagen.«
Der Indier fragte: »Warum?«
Der Junge entgegnete: »Ich bin erschöpft, es wird trübe und wirr in meinem Kopf. Ich kann heute nichts mehr sehen.«
Damit war das Catechisiren zu Ende. Der Anführer sagte etwas auf indisch zu den beiden Andern, indem er bald auf den Knaben, bald nach der Stadt hin wies, wo sie, wie wir nachher erfuhren, Wohnung genommen hatten. Darauf machte er wieder Zeichen über dem Kopf des Kindes, hauchte seine Stirn an und brachte ihn so plötzlich wieder zu sich. Worauf sie sich Alle nach der Stadt zu auf den Weg machten und von dem Mädchen nicht weiter gesehen wurden.
Die meisten Dinge, sagt man, tragen eine Moral in sich, wenn man nur genau zusteht. Was war die Moral von dieser Geschichte?
Die Moral war nach meiner Meinung: erstens, daß der Anführer der Gauklerbande die Dienstboten vor dem Hause von der Ankunft des Herrn Franklin hatte reden hören und das für eine gute Gelegenheit hielt, ein bischen Geld zu machen. Zweitens, das er mit seinen Kameraden und dem Jungen zu obigem Zweck, bis sie Mylady nach Hause kommen sähen, um das Haus herumlungern und ihr dann Herrn Franklins Ankunft prophezeihen wollten. Drittens: daß Penelope einer Probe ihres Hokus Pokus, die sie wie Schauspieler vorher machten, beigewohnt habe. Viertens: daß ich gut thun werde, diesen Abend ein Auge auf das Silbergeschirr zu haben, und fünftens, daß Penelope gut thun werde, sich abzukühlen und ihren Vater in seinem Schläfchen in der lieben Sonne nicht weiter zu stören.
Das schien mir eine verständige Auffassung der Sache, wer aber die Art und Weise junger Mädchen kennt, wird es nicht überraschend finden, daß Penelope für diese Auffassung nicht zugänglich war. Nach ihrer Meinung war die Moral der Sache eine viel ernstere. Die Ernsthaftigkeit meiner Tochter machte mich Verdrießlich.
»Wozu in aller Welt braucht Herr Franklin von diesen Possen etwas zu wissen?« fragte ich sie.
»Frag’ ihn selbst,« erwiderte Penelope »und sieh zu, ob er es auch für Possen hält.«
Mit diesem Trumpf verließ meine Tochter mich. Als sie fort war, überlegte ich mir die Sache und kam zu dem Entschluß, Herrn Franklin die Sache wirklich mitzutheilen, hauptsächlich um Penelope zu beruhigen. Was zwischen ihm und mir darüber verhandelt wurde, als ich noch an demselben Tage spät ihm davon sprach, wird seiner Zeit ausführlich mitgetheilt werden. Da ich aber den Leser nicht zu spannen und später zu enttäuschen wünsche, so erlaube ich mir, bevor ich in meinem Bericht fortfahre, schon hier zu bemerken, daß man in unserer Unterhaltung über die Jongleurs nicht die Spur eines Scherzes finden wird.
Zu meiner größten Ueberraschung nahm Herr Franklin, wie vordem Penelope, die Sache ernsthaft. Wie ernsthaft wird man ermessen, wenn ich erzähle, daß nach seiner Ansicht mit jenem geheimnisvollen »ihn« des Indiers der Mondstein gemeint gewesen sei.

Viertes Capitel
Es thut mir wirklich leid, den Leser bei mir und meinem Gartenstuhl aufhalten zu müssen. Ein alter Mann, der sein Schläfchen im Sonnenschein macht, ist kein interessanter Gegenstand, das weiß ich sehr gut; aber die Dinge müssen nun einmal niedergeschrieben werden, wie sie sich wirklich begeben haben und so muß ich den Leser bitten, sich’s noch eine Weile bei mir gefallen zu lassen, bis wir zu der später am Tage erfolgenden Ankunft des Herrn Franklin Blake gelangen.«
Ehe ich noch Zeit gehabt, wieder einzuschlafen, nachdem meine Tochter Penelope mich wieder verlassen hatte, wurde ich durch ein Geklapper von Tellern und Schüsseln im Domestikenzimmer aufgerüttelt und das bedeutete, daß das Mittagessen fertig sei. Da ich meine Mahlzeiten in meinem eignen Wohnzimmer zu nehmen gewohnt war, so ging mich das Mittagessen der Leute nichts an und ich legte mich wieder in meinen Stuhl zurück, nachdem ich ihnen Allen guten Appetit gewünscht hatte. Eben hatte ich meine Beine wieder ausgestreckt, als ein anderes weibliches Wesen auf mich losstürzte, diesmal nicht meine Tochter, sondern nur das Küchenmädchen Nancy. Ich war ihr mit meinem Stuhl gerade im Wege, und als sie mich bat, ich möge sie vorbeilassen, fand ich daß sie mürrisch aussah, was ich nun einmal als Vorgesetzter der Domestiken aus Princip niemals ohne nachzuforschen vorübergehen lasse.
»Na,« frage ich, »warum läufst denn Du vom Mittagessen fort? Was ist Dir widerfahren, Nancy?«
Sie versuchte mir ohne Antwort zu entwischen, was ich verhinderte, indem ich aufstand und sie beim Ohr ergriff. Sie ist ein hübsches rundes Ding und das Zupfen am Ohr ist meine Gewohnheit, wenn ich den Mädchen mein Gefallen an ihnen bezeigen will.
»Was ist Dir widerfahren?« fragte ich noch einmal.
»Rosanna ist wieder nicht da zum Mittagessen,« antwortete sie, »und ich soll sie holen. Alle schwere Arbeit im Hause fällt mir zu. Lassen Sie mich in Ruhe, Herr Betteredge!«
Die genannte Rosanna war unser zweites Hausmädchen. Da ich für dieses zweite Hausmädchen eine gewisse Sympathie empfand (warum, wird man gleich erfahren), und da ich aus Nancy’s Mienen die Besorgniß schöpfte, daß sie ihre Collegin mit härteren Worten, als gerade nothwendig, herbeiholen werde, fiel mir ein, daß ich nichts Besonderes zu thun habe und daß ich ja Rosanna selbst holen und sie dabei ermahnen könnte, in Zukunft pünktlich zu sein, was sie, wie ich gewiß wußte, gut aufnehmen würde.
»Wo ist denn Rosanna?« fragte ich.
»Natürlich am Strande« antwortete Nancy mit zurückgeworfenem Kopfe. »Sie ist heute Morgen wieder einmal in Ohnmacht gefallen und hat um die Erlaubniß gebeten, ein bischen frische Luft schöpfen zu dürfen. Ich habe keine Geduld mehr mit ihr.«
»Geh Du nur zu Tisch, mein Kind Ich habe Geduld mit ihr, ich will sie selbst holen.«
Nancy, die sich eines guten Appetits erfreute, lächelte beifällig; wenn sie beifällig lächelt, sieht sie sehr gut aus, und wenn sie gut aussieht, fasse ich sie unter’s Kinn, nicht aus Unsittlichkeit, sondern aus Gewohnheit.
Ich nahm also meinen Stock und machte mich auf den Weg nachdem Strande.
Aber nein! wir kommen immer noch nicht weiter, ich muß leider abermals innehalten; aber ich muß hier wahrhaftig erst die Geschichte des Strandes und die Geschichte Rosanna’s erzählen —— denn beide stehen mit der Diamantenangelegenheit in naher Beziehung. Ich gebe mir die redlichste Mühe, meinen Bericht ohne Weitschweifigkeit abzufassen, und doch gelingt es mir so schlecht. Aber die Sache ist, daß Personen und Dinge auf so wunderliche Weise in unser Leben eingreifen und uns so, zu sagen zwingen, von ihnen Notiz zu nehmen. Aber wir wollen die Sache leicht nehmen und kurz machen. Nur noch eine kleine Geduld und wir sind mitten in unserer geheimnißvollen Geschichte.
Rosanna, um die Person der Sache voranzustellen, was dem Gebot der einfachsten Höflichkeit gehorchen heißt, war die einzige neue Magd in unserm Hause. Ungefähr vier Monate vor der Zeit, über die ich berichte, war Mylady in London gewesen und hatte dort eine Besserungsanstalt besucht, die zu dem Zwecke errichtet war, um unglückliche Frauenzimmer, nachdem ihre Gefängnißstrafe abgesessen, vor dem Rückfall zu bewahren. Als die Hausmutter sah, daß die Anstalt Mylady interessire, machte sie sie auf ein Mädchen mit Namen Rosanna Spearman aufmerksam und erzählte ihr eine höchst klägliche Geschichte, die ich hier zu wiederholen nicht den Muth habe, denn ich mag weder mich noch meine Leser traurig stimmen. Das Kurze von der Sache war, daß Rosanna Spearman eine Diebin gewesen war, und da sie nicht zu denen gehörte, die in ganzen Gesellschaften Tausende anstatt eines Einzigen berauben, so verfiel sie dem Gesetz, und Gefängniß und Besserungshaus folgten dem Gesetz. Die Meinung der Hausmutter über Rosanna ging dahin, daß sie trotz ihres Vergebens ein seltenes Mädchen sei und nur einer Gelegenheit bedürfe, um sich des Interesses, das ihr eine christliche Dame bezeigen möchte, würdig zu zeigen. Mylady, die eine christliche Dame ist, wenn es je eine gegeben hat, sagte darauf der Hausmutter: »Ich will Rosanna Spearman eine solche Gelegenheit in meinem Dienste geben.«
Eine Woche darauf trat Rosanna Spearman als zweites Hausmädchen bei uns in Dienst. Kein Mensch erfuhr die Geschichte des Mädchens außer Fräulein Rachel und mir. Mylady, die mir die Ehre erzeigt, mich bei den meisten Dingen zu Rathe zu ziehen, fragte mich auch in Betreff Rosanna’s um meinen Rath. Da ich in letzter so ziemlich in die Gewohnheit des verstorbenen Sir John verfallen war, immer Mylady’s Meinung zu sein, stimmte ich ihr auch von ganzem Herzen in Betreff Rosanna Spearman’s bei.
Eine günstigere Gelegenheit, in ihrer Besserung zu beharren, war nie Mädchen geboten. Keiner unter den Domestiken konnte ihr ihr vergangenes Leben vorwerfen, denn Keiner wußte etwas davon. Sie bekam ihren Lohn und wurde gut behandelt wie die Andern, und von Zeit zu Zeit hatte Mylady ein freundliches Wort der Ermunterung für sie. Dafür zeigte sie sich aber auch dieser freundlichen Behandlung durchaus würdig. Obgleich sie gar nicht stark und den erwähnten Ohnmachten unterworfen war, that sie ihre Arbeit, ohne sich zu beklagen, bescheiden und gut. Aber doch wollten sich die andern dienenden Mädchen nicht recht mit ihr befreunden, ausgenommen meine Tochter Penelope, die immer freundlich, wenn auch nicht befreundet mit Rosanna war.
Ich weiß nicht recht, womit das Mädchen es eigentlich bei den Andern versah. Schön war sie nicht, so daß die Andern etwa hätten neidisch sein können, sie war das häßlichste Mädchen im Hause und noch dazu entstellt durch eine verwachsene Schulter. Was die Andern hauptsächlich gegen sie hatten, war, glaube ich, ihr stilles schweigsames Wesen. In ihren Mußestunden, wo die Andern schwatzten, beschäftigte sie sich mit Lesen oder Handarbeit. Und wenn die Reihe an sie kam, auszugehen, setzte sie in den meisten Fällen schweigend ihren Hut auf und ging ganz allein ihres Weges. Sie stritt sich nie und nahm nie etwas übel, sie hielt sich nur eben so höflich wie hartnäckig in einer gewissen Entfernung von allen Uebrigen. Dazu kam, daß trotz ihrer Häßlichkeit ein gewisses Etwas, weiß nicht, ob in ihrer Stimme oder in ihrem Gesicht, an ihr war, das mehr einer Dame als einem Hausmädchen anzugehören schien. Alles, was ich sagen kann, ist, daß die andern Mädchen von dem Augenblick ihres Eintritts an über dieses gewisse Etwas herfielen und höchst ungerechter Weise behaupteten, Rosanna Spearman gebe sich Airs.
Nachdem ich nun Rosanna’s Geschichte erzähIt habe, brauche ich nur noch über eine von den vielen Sonderbarkeiten dieses eigenthümlichen Mädchens zu berichten, bevor ich an meine Geschichte des Strandes komme.
Unser Haus liegt auf einer Anhöhe an der Küste von Yorkshire und ganz in der Nähe der See, wir haben schöne Spaziergänge nach allen Seiten hin mit Ausnahme einer einzigen, in dieser einen Richtung ist aber der Weg wahrhaft schrecklich. Er führt eine viertel Meile lang durch eine trübselige, kümmerliche Tannen-Anpflanzung, dann durch niedrige Klippen zu der einsamsten und häßlichsten Bucht an unserer Küste.
Die Dünen gehen hier bis ins Wasser hinein und laufen in zwei Felsenzungen aus, die sich einander gegenüberliegend, so weit ins Meer hinein erstrecken, daß man ihr Ende nicht zu verfolgen im Stande ist. Die eine heißt die Nordspitze und die andere die Südspitze. Zwischen beiden liegt der gefährlichste Flugsand an unserer Küste, der sich zu gewissen Jahreszeiten vor- und rückwärts schiebt.
So oft die Fluth herannaht, begibt sich etwas in der Tiefe der Erde, was die ganze Fläche des Flugsands in ein höchst merkwürdiges Schwanken und Zittern versetzt und diese Eigenthümlichkeit hat der Fläche in unserer Gegend den Namen des »Zitterstrandes« verschafft. An einer großen Sandbank, die eine halbe Meile von der Küste vor der Mündung der Bucht liegt, brechen sich die aus der offenen See herankommenden Wellen. Winter und Sommer, wenn die Fluth über den Flugsand hinweggeht, scheint die See die Wellen hinter sich auf der Sandbank zu lassen und fließt, ruhig und gemächlich steigend, über den Strand hin. Es ist das in Wahrheit ein einsamer und schrecklich verlassener Ort. Kein Boot wagt sich je in diese Bucht. Kein Kind aus unserm Fischerdorf Cobb’s Hole kommt je zum Spielen hierher. Selbst die Vögel in der Luft umkreisen, wie mir scheint, den Zitterstrand, wenn ihr Flug sie in seine Nähe bringt, in weitem Bogen.
Daß ein junges Mädchen, wenn es die Auswahl unter einem Dutzend hübscher Spaziergänge hat und jederzeit Gesellschaft haben könnte, wenn sie nur sagen wollte: »Kommt mit,« einen solchen Platz, vorzieht und sich da ganz allein mit einem Buch oder einer Handarbeit hinsetzt, wenn sie Erlaubniß zum Ausgehen bekommt, das klingt doch gewiß unglaublich. Und doch ist es wahr, man mag darüber denken wie man will. Dies war Rosanna Spearman’s Lieblingsspaziergang den sie aufsuchte so oft sie ausging, ausgenommen die seltenen Fälle, wo sie nach Cobb’s Hole ging, um die einzige Freundin zu besuchen, die sie in unserer Nachbarschaft hatte und von der wir später noch mehr hören werden. Und nach diesem Zitterstrand machte ich mich jetzt auf den Weg, um das Mädchen zum Essen zu holen, und damit sind wir glücklich wieder bei unserm Ausgangspunkt angekommen und setzen nun unseren Weg nach dem Strande ungestört fort. In der Tannenpflanzung fand ich keine Spur des Mädchens. Als ich aber durch die Sandhügel an die Küste gelangte, stand sie da mit ihrem kleinen Strohhut und ihrem grauen Mantel, den sie immer trug, um ihre verwachsene Gestalt so viel wie möglich zu verbergen, da stand sie ganz allein, auf den Flugsand und das weite Meer blickend.
Sie schreckte auf, als ich vor sie hintrat, und wandte ihren Kopf von mir weg. Da das Michnichtansehen auch eine Manier ist, die ich als Vorgesetzter der Domestiken principiell nicht dulde, drehte ich ihr Gesicht mir wieder zu und sah, daß sie weinte. Mein seidenes Schnupftuch, eines von sechs Prachtstücken, die mir Mylady zum Geschenk gemacht hatte, steckte in meiner Tasche. Ich zog es heraus und sagte zu Rosanna »Komm mein Kind, setze Dich zu mir auf den Strand. Ich will erst Deine Thränen trocknen und mir dann die Frage erlauben, warum Du geweint hast.«
In meinem Alter ist das Niedersetzen am Strande ein viel schwereres Stück Arbeit, als junge Leute es sich träumen lassen. Bis ich mit mir in Ordnung war, hatte Rosanna ihre Augen schon selbst mit ihrem eigenen ganz ordinairen Batist-Schnupftuch getrocknet. Sie war ganz ruhig und sah sehr unglücklich aus; aber sie setzte sich zu mir. Wenn man ein Mädchen auf die einfachste Weise trösten will, muß man sie auf den Schooß nehmen. Ich befolgte diese goldene Regel. Aber o weh! Rosanna war nicht wie Nancy, das muß wahr sein.
»Nun erzähle mir, mein Kind,« sagte ich, »Warum weinst Du?«
»Ueber die vergangenen Jahre, Herr Betteredge,« antwortete Rosanna ruhig, »mein früheres Leben tritt mir noch bisweilen vor die Seele.«
»Komm, komm, mein Kind,« erwiderte ich. »Dein vergangenes Leben ist völlig ausgewischt: Warum vergißt Du es nicht?«
Sie ergriff einen meiner Rockschöße. Ich bin ein nachlässiger alter Mann und eine gute Portion von meinem Essen und Trinken bleibt aus meinen Kleidern sitzen, die bald von einem, bald von dem andern der Mädchen wieder gereinigt werden. Tags zuvor hatte Rosanna einen Fleck auf meinem Rockschoß mit einem ganz neuen und als vorzüglich gerühmten Fleckwasser ausgemacht. Das Fett war zwar fort, aber die Stelle, wo der Fleck gesessen hatte, war doch noch sichtbar. Das Mädchen zeigte auf die Stelle und schüttelte mit dem Kopfe.
»Der Fleck ist fort, Herr Betteredge,« sagte sie, »aber die Stelle bleibt sichtbar.«
Eine Bemerkung, die sich auf den eigenen Rock eines Mannes stützt, ist nicht leicht zu widerlegen. Ueberdies war in jenem Augenblick etwas in dem Wesen des Mädchens selbst, das meine besondere Theilnahme erweckte. Sie hatte hübsche braune Augen trotz ihrer sonstigen Häßlichkeit, und sie blickte auf mich mit einem Ausdrucke sehnsüchtiger Ehrfurcht vor meinem glücklichen Alter und meinem guten Ruf, Dinge, die für sie auf immer unerreichbar bleiben würden, und das machte mir das Herz schwer. Da ich mich außer Stande fühlte, sie zu trösten, so gab es nur Eines für mich in diesem Augenblick zu thun, und das war, sie zum Essen zu überreden.
»Hilf mir auf,« sagte ich, »denn das Essen wartet auf Dich, Rosanna, und ich bin gekommen, um Dich zu holen.«
»Sie, Herr Betteredge?« fragte sie.
»Sie wollten Nancy an Dich abschicken, aber ich dachte, Du würdest Deine Schelte lieber von mir hinnehmen.«
Statt mir aufzuhelfen, drückte mir das arme Ding verstohlen die Hand. Sie kämpfte stark gegen die wieder aufsteigenden Thränen, und mit Erfolg, was mir Achtung für sie einflößte.
»Sie sind sehr gütig, Herr Betteredge,« sagte sie, »aber ich brauche heute kein Mittagessen lassen Sie mich noch ein wenig hier bleiben.«
»Warum bist Du gern hier,« fragte ich, »was in aller Welt führt Dich immer wieder an diesen elenden Platz?«
»Es zieht mich etwas hierher,« erwiderte das Mädchen und zeichnete dabei mit ihren Fingern Figuren in den Sand. »Ich versuche es immer wieder, wegzubleiben, aber ich kann nicht. Zuweilen,« fuhr sie mit leiser Stimme fort, als ob der Gedanke sie selbst erschreckte, »zuweilen scheint es mir, Herr Betteredge, als ob mein Grab mich hier erwarte.«
»Zu Hause erwartet Dich aber Hammelbraten und Pudding,« warf Ich ein. »Komm, geh gleich zum Essen. Solche Gedanken, wie Du sie hast, kommen aus einem leeren Magen.« Ich sprach mit Strenge in der ganz natürlichen Entrüstung meines Alters; ein Mädchen von 25 Jahren von ihrem Tode sprechen zu hören. Sie schien mich nicht zu hören, sondern legte ihre Hand auf meine Schulter und hielt mich auf meinem Platze an ihrer Seite fest.
»Mir ist, als ob dieser Platz einen Zauber auf mich übte,« fing sie wieder an. »Ich träume jede Nacht davon. Ich muß daran denken, während ich bei meiner Arbeit sitze. Sie wissen, daß ich nicht undankbar bin, Herr Betteredge, daß ich mir Mühe gebe, Ihre Güte und Mylady’s Vertrauen zu verdienen. Aber es kommt mir zuweilen vor, als ob das Leben hier zu gut und zu ruhig für ein Mädchen wäre, das so viel durchgemacht hat wie ich, Herr Betteredge, so viel durchgemacht! Ich fühle mich einsamer unter den anderen Mädchen in dem Gefühl, daß ich nicht zu ihnen gehöre, als hier. Mylady weiß eben so wenig wie die Hausmutter im Besserungshause welch ein schrecklicher Vorwurf, unbescholtene Menschen für ein Mädchen wie ich sind. Schelten Sie mich nicht, Sie sind auch gut. Ich thue ja meine Arbeit, nicht wahr? Bitte, sagen Sie Mylady nicht, ich wäre unzufrieden, denn das ist nicht der Fall. Mein Gemüth ist zuweilen unruhig, das ist Alles.«
Sie riß ihre Hand plötzlich von meiner Schulter weg und deutete mit derselben auf den Flugsand hin.
»Sehen Sie,« rief sie, »ist das nicht großartig, ist nicht schrecklich. Ich habe das wohl zwanzig Mal gesehen und doch ist es mir jedesmal so neu, als hätte ich es noch nie gesehen!«
Ich sah ihrer Hand nach. Die Fluth kam eben heran und der Sand begann sein grausiges Zittern? Die breite braune Oberfläche desselben hob sich langsam und fing dann an, an allen Stellen zu schwanken und zu zittern.
»Wissen Sie, was mir das für einen Eindruck macht,« sagte Rosanna, indem sie ihre Hand wieder auf meine Schulter legte; »Es kommt mir vor, als ob Hunderte von erstickenden Menschen darunter wären, die Alle ringen, an die Oberfläche zu gelangen und immer weiter und weiter in die schreckliche Tiefe hinabsinken. Werfen Sie einen Stein hin, Herr Betteredge, werfen Sie einen Stein hinein und sehen Sie, wie der Sand ihn verschluckt!«
Das war ungesundes Gerede, das war die Wirkung eines leeren Magens auf ein unruhiges Gemüth. Eben wollte ich ihr eine Antwort geben und zwar eine, die das Mädchen in seinem eigenen Interesse tüchtig zurecht gesetzt hätte, als sie mir plötzlich durch eine Stimme abgeschnitten wurde, die mich von den Dünen her bei meinem Namen rief.
»Betteredge,« rief es, »wo sind Sie.«
»Hier« rief ich zurück, ohne eine Ahnung davon zu haben, wessen Stimme mich gerufen habe.
Rosanna richtete sich rasch auf und blickte nach der Richtung, von wo die Stimme kam. Ich wollte mich eben auch aufrichten, als mich ein plötzlicher Wechsel in dem Gesichtsausdruck des Mädchens betroffen machte.
Ihr Gesicht übergoß sich mit einem schönen Roth, wie ich es nie zuvor an ihr gesehen hatte und strahlte in einem sprach- und athemlosen Staunen.
»Wer ist das?« fragte ich.
Sie aber gab mir als Antwort meine eigene Frage zurück.
»O, wer ist es?« sagte sie leise mehr zu sich selbst, als zu mir.
Ich drehte mich im Sande herum und blickte rückwärts Da kam von den Hügeln her ein junger Mann auf uns zu, der in einem hellbraunen Anzug mit Hut und Handschuhen von gleicher Farbe, eine Rose im Knopfloch und ein Lächeln auf seinen Lippen trug, das den »Zitterstrand« selbst zu einem Lächeln hätte bringen können.
Ehe ich mich noch erheben konnte, lag er im Sande neben mir und schlang, wie sie’s im Auslande thun, den Arm um meinen Hals und drückte mich an sich, daß mir der Athem verging.
»Mein lieber alter Betteredge! Ich bin Ihnen sieben. Shilling sechs Pence schuldig, wissen Sie nun, wer ich bin?«
Bei Gott dem Allmächtigen, da war er, Herr Franklin Blake, vier gute Stunden eher, als wir ihn erwartet hatten.
Bevor ich noch ein Wort sagen konnte, bemerkte ich, wie Herr Franklin offenbar überrascht von mir zu Rosanna aufsah. Ich sah nun auch nach dem Mädchen hin. Sie erröthete noch tiefer als zuvor, wie es schien von Herrn Franklins Blick getroffen, und sie wandte sich ab und verließ uns plötzlich in einer mir völlig unerklärlichen Verwirrung, ohne einen Knix für den Herrn oder ein Wort für mich, ganz gegen ihre Gewohnheit, denn sie war sonst das wohlerzogenste und höflichste Mädchen, das man sehen konnte.
»Das ist ja ein komisches Mädchen,« sagte Franklin, »ich möchte wohl wissen, was sie an mir so überraschend findet.«
»Ich denke mir,« antwortete ich, auf die continentale Erziehung unseres jungen Herrn anspielend, »es ist der ausländische Firniß.«
Ich setze hier Herrn Franklin’s gedankenlose Frage und meine dumme Antwort als einen Trost und eine Aufmunterung für alle dummen Leute her, da es, wie ich bemerkt habe, unseren weniger begabten Mitmenschen eine große Genugthuung gewährt, zu sehen, daß die Gescheidten gelegentlich nicht klüger sind als sie. Weder Herr Franklin mit seiner ausgezeichneten ausländischen Erziehung, noch ich mit meinem Alter, meiner Erfahrung und meinem natürlichen Mutterwitz hatten eine Ahnung davon, was der wirkliche Grund von Rosanna Spearman’s unerklärlichem Benehmen sei. Das arme Ding war schon unseren Gedanken entschwunden, als noch das Flattern ihres grauen Mantels zwischen den Sandhügeln sichtbar blieb. Und was war der eigentliche Grund? wird man fragen; lies weiter, guter Freund, so geduldig wie möglich, und vielleicht wirst Du Rosanna Spearman eben so tief beklagen wie ich es that, als ich die Wahrheit herausgefunden hatte.

Fünftes Capitel.
Das Erste, was ich that, als wir allein waren, war, einen dritten Versuch zu machen, mich von meinem Sitz am Strande zu erheben. Herr Franklin hielt mich aber zurück.
»Ein Gutes hat dieser schauderhafte Platz« sagte er, »man ist hier ungestört. Bleiben Sie auf, Ihrem Platz, Betteredge, ich habe Ihnen etwas zu sagen.«
Während er mit mir sprach, betrachtete ich ihn und versuchte in dem Mann, den ich vor mir hatte, Etwas von dem Knaben, der in meiner Erinnerung lebte, zu entdecken. Es wollte aber nicht gelingen. So genau ich auch zusah, so konnte ich doch so wenig mehr von seinen rosigen Wangen, wie von seiner strammen Jacke herausfinden. Sein Teint war blaß geworden, der untere Theil des Gesichts war zu meiner großen Ueberraschung und Entrüstung mit einem gelockten braunen Backen- und Schnurrbart bedeckt. Er hatte zwar noch immer ein sehr gefälliges und einnehmendes Wesen. das aber doch keinen Vergleich mit dem aushielt, was er früher gewesen war. Und was noch schlimmer war, er hatte versprochen groß zu werden und hatte dieses Versprechen nicht gehalten. Er war zierlich, schlank und wohl gebaut, aber er überragte die mittlere Mannesgröße höchstens um zwei Zoll. Die vergangenen Jahre hatten von seinem früheren Selbst nichts übrig gelassen, als seine hellen, offenen Augen. In ihnen fand ich meinen lieben Jungen wieder, und damit beschloß ich, es bei meinen Nachforschungen bewenden zu lassen.
»Seien Sie willkommen in Ihrer alten Heimath, Herr Franklin,« sagte ich. »Und um so willkommener als Sie einige Stunden früher kommen, als wir Sie erwarteten.«
»Ich habe meine Gründe, früher zu kommen, als Ihr mich erwartetet,« antwortete Franklin, »ich argwöhne Betteredge, daß man mich in den letzten drei oder vier Tagen verfolgt und beobachtet hat, und ich bin mit dem Morgen- statt mit dem Abendzug gereist, weil ich einem gewissen dunkelfarbigen Fremden gern entwischen wollte.«
Diese Worte machten einen tiefen Eindruck auf mich, sie brachten mir auf einmal wieder die Jongleurs und Penelope’s Besorgniß in Erinnerung, daß dieselben etwas Schlimmes gegen Franklin im Schilde führten.
»Wer beobachtet Sie, und warum?« fragte ich.
»Erzählen Sie mir etwas von den drei Indiern, die heute hier gewesen sind,« erwiderte Franklin, ohne auf meine Frage zu achten. »Es ist sehr möglich, Betteredge, daß mein Fremder und Eure drei Jongleurs sich als Sylben derselben Charade ausweisen.«
»Was wissen Sie von den Jonglours?« fragte ich, seine Frage mit einer andern erwiedernd, was nicht gerade fein war; wie ich bekenne, aber man wird mir Etwas, was doch so menschlich ist, zu Gute halten.
»Ich habe Penelope schon im Hause gesprochen,« antwortete Franklin, »und die hat es mir erzählt. Ihre Tochter, Betteredge, versprach immer ein hübsches Mädchen zu werden und hat ihr Versprechen gehalten. Sie hat kleine Ohren und kleine Füße. Hat sie diese unschätzbaren Vorzüge von ihrer verstorbenen Mutter geerbt?«
»Meine selige Frau hatte ihren guten Theil Fehler,« sagte ich, »einer davon war, da Sie mich doch danach fragen, daß sie nie bei einer Sache bleiben konnte. Sie glich mehr einem Schmetterling als einer Frau.«
»Da wäre sie was für mich gewesen,« entgegnete Franklin, »ich kann auch nie bei einer Sache bleiben. Sie, Betteredge, sind ja wohler auf als je, das hat mir schon Ihre Tochter gesagt, als ich sie wegen der Jongleurs befragte. »Vater wird Ihnen das Nähere erzählen, er ist merkwürdig für sein Alter und weiß sich vortrefflich auszudrücken,« waren Penelope’s eigene Worte, bei denen sie reizend erröthete. Nichts, selbst nicht mein Respekt vor Ihnen konnte mich abhalten, sie zu . . . einerlei. Ich habe sie als Kind gekannt und sie ist nicht schlechter davon geworden. Kommen Sie, sagen Sie mir ernsthaft, was wollten die Jongleurs?«
Ich war Verdrießlich über meine Tochter —— nicht weil sie sich von Herrn Franklin hatte küssen lassen, dagegen hatte ich nichts, —— aber weil sie mich zwang, ihre dumme Geschichte aus zweiter Hand zu erzählen. Indessen da half nichts, ich mußte die Details berichten. Herrn Franklins. ganze Heiterkeit ging bei meiner Erzählung verloren. Er saß da mit gerunzelter Stirn und drehte krampfhaft an seinem Schnurrbart. Als ich fertig war, sprach er mir zwei von den Fragen nach, die der Anführer der Gauklerbande an den Knaben gerichtet hatte, dem Anscheine nach zu dem Zwecke. sie sich recht fest einzuprägen.
»»Kommt der Fremde heute auf dieser Straße und auf keiner andern nach diesem Hause?« »Hat der englische Herr ihn bei sich?« »Ich fürchte,« sagte Herr Franklin, indem er ein kleines versiegeltes Paket aus seiner Tasche zog, »daß mit »ihm« dies da gemeint ist, und dieses, Betteredge, ist meines Onkels Herncastle berühmter Diamant.««
»Um Gotteswillen,« rief ich aus, »wie kommt der Diamant des schlimmen Obersten in Ihre Hände?«
»Der Diamant ist in dem Testament des Obersten meiner Cousine Rachel als Geburtstagsgeschenk vermacht,« erklärte Herr Franklin, »und mein Vater, als Testamentsvollstrecker des Obersten, hat ihn mir übergeben, um ihn hierher zu bringen.«
Wenn das Meer, das sich eben sachte über den »Zitterstrand« hingoß, sich vor meinen Augen plötzlich in trocknes Land verwandelt hätte, so wäre mein Erstaunen, glaube ich, nicht größer gewesen, als es bei Herrn Franklins Worten war.
»Der Diamant des Obersten Fräulein Rachel vermacht?« rief ich aus. »Und Ihr Vater der Testamentsvollstrecker des Obersten? Ich wäre jede Wette eingegangen, daß Ihr Vater den Obersten nicht mit der Feuerzange anfassen würde.«
»Das ist ein bischen stark, Betteredge! Was hat man denn dem Obersten vorzuwerfen gehabt? Sie müssen das besser wissen als ich. Erzählen Sie mir, was Sie von ihm wissen, und ich will Ihnen erzählen, wie mein Vater sein Testamentsvollstrecker geworden ist und noch mehr, ich habe in London Dinge über meinen Onkel Herncastle und seinen Diamanten erfahren, die mir gar nicht gefallen, und ich möchte von Ihnen hören, was daran ist; Sie nannten ihn eben den »schlimmen Obersten.« Besinnen Sie sich ein bischen, mein alter Freund, und sagen Sie mir warum.«
Ich sah, daß er Ernst machte, und fing an zu erzählen, und das Wesentlichste von dem, was ich erzählte, habe ich zum Besten des Lesers im Folgenden genau niedergeschrieben. Ich bitte Dich, lieber Leser, um Deine volle Aufmerksamkeit, sonst wirst Du Dich nicht zurechtfinden können, wenn wir tiefer in die Geschichte hinein kommen.
Denke nicht an Deine Kinder, noch an Dein Mittagessen, noch an Deinen neuen Hut, oder sonst etwas. Sieh zu, ob Du nicht auch die Politik, Pferde, Marktpreise, Clubb-Angelegenheiten u. s. w. vergessen kannst. Ich denke, Du wirst die Freiheit, die ich mir nehme, nicht übelnehmen, es ist nun so meine Art, an den geneigten Leser zu appelliren.
Du lieber Gott! wie oft habe ich Dich nicht mit den größten Autoren in der Hand gesehen und nie geneigt abzuschweifen, wenn ein Buch statt eines Menschen Deine Aufmerksamkeit verlangte.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ich habe schon oben von Mylady’s Vater, dem alten Lord mit der kurzen Geduld und der raschen Zunge gesprochen. Er hatte im Ganzen fünf Kinder: Zuerst zwei Söhne, dann nach einer langen Pause bekam seine Frau wieder Kinder und brachte nach einander, so rasch die Natur es erlaubt, drei kleine Mädchen zur Welt, von denen meine Herrin, wie schon erwähnt, die Jüngste und Beste war. Von den beiden Söhnen erbte der Aelteste, Arthur, den Titel und die Güter, der zweite, der ehrenwerthe John, erbte von einem Verwandten ein schönes Vermögen und trat in die Armee ein.
Das ist ein schlimmer Vogel, der sein eigenes Nest beschmutzt, und ich betrachte die adlige Familie der Herncastle als mein Nest und ich werde es als besondere mir gewährte Gunst betrachten, wenn man mir ein näheres Eingehen auf die Geschichte des ehrenwerthen John erläßt. Ich glaube, offen gestanden, daß er einer der größten Schufte war, die jemals gelebt haben. Ich wüßte nicht mehr noch weniger über ihn zu sagen.«
Er ging also zur Armee, indem er zunächst bei den Garden eintrat. Hier mußte er, gleichviel warum, mit dem zweiundzwanzigsten Jahre wieder austreten. Sie sind sehr eigen in der Armee und sie waren zu eigen für den »ehrenwerthen« John. Er ging nach Indien, um zu sehen, ob sie da eben so eigen wären, und sich dort im Dienst zu versuchen. Was Tapferkeit betrifft, so war er, um gerecht zu sein, ein Gemisch von einer Bulldogge, einem Kampfhahn und einem Wilden. Er war mit bei der Einnahme von Seringapatnam. Bald nachher vertauschte er sein Regiment mit einem andern und dieses wieder nach einiger Zeit mit einem dritten. In diesem erhielt er seinen höchsten Grad als Oberst-Leutnant und zugleich mit demselben einen Sonnenstich und kehrte nach England zurück.
Ihm vorangegangen war ein Ruf, der ihm alle Häuser seiner ganzen Familie verschloß. Mylady, die eben verheirathet war, führte dabei den Reigen, selbstverständlich mit der Genehmigung ihres Gemahls, und erklärte, ihr Bruder solle niemals eines ihrer Häuser betreten. Auf dem Ruf des Obersten ruhte mehr als ein böser Fleck, weshalb die Leute ihn mieden; ich brauche aber hier nur des Fleckens der Diamanten-Geschichte zu erwähnen.
Das Gerücht wollte wissen, er sei in den Besitz, dieses indischen Edelsteins durch Mittel gelangt, zu denen er sich, so frech er war, doch nicht zu bekennen wage. Er machte niemals einen Versuch, den Diamanten zu verkaufen, da er kein Geld brauchte und da er, um auch hierin wieder gegen ihn gerecht zu sein, keinen Werth auf Geld legte. Niemals gab er ihn aus den Händen, ja niemals zeigte er ihn irgend einer lebenden Seele.
Einige meinten, er handle so aus Furcht, die Sache könne ihm Unannehmlichkeiten bei der Militair-Behörde bereiten, Andere, die die wahre Natur des Mannes sehr schlecht kannten, waren der Meinung, er fürchte, wenn er den Stein zeige, könne es ihm das Leben kosten.
Und doch war in dieser letzten Annahme vielleicht ein Körnchen Wahrheit. daß er sich fürchte, war nicht der Fall, aber es war Thatsache, daß sein Leben zwei Mal in Indien bedroht gewesen war, und man glaubte allgemein, daß der Mondstein die Veranlassung dazu gegeben habe. Und als er nach England zurückkam. und von Jedermann gemieden wurde, schrieb man dies wiederum dem Mondstein zu. Das Geheimniß des Obersten stand ihm in seinem Leben überall im Wege und machte ihn so zu sagen zu einem Ausgestoßenen in seinem eigenen Lande. Die Männer verweigerten ihm den Zutritt zu ihren Clubbs, die Mädchen, die er heirathen wollte, gaben ihm sämmtlich Körbe, Freunde und Verwandte wurden zu kurzsichtig, um ihn auf der Straße zu erkennen.
Andere würden in solcher Lage vielleicht versucht haben, sich vor der Welt zu rechtfertigen, aber einen solchen Schritt zu thun, auch wenn er im Unrecht war und die ganze Gesellschaft gegen sich hatte, war nicht die Art des ehrenwerthen John. Er hatte den Diamanten trotz verschiedener in Indien gegen ihn gerichteter Mordversuche behalten; er behielt ihn in offenem Trotz gegen die öffentliche Meinung in England. Das ist das Bild des Mannes, wie ein Portrait es nicht treuer geben könnte, ein Charakter, der Allem Trotz bot, und ein Gesicht, das, obgleich schön, aussah, als ob es vom Teufel besessen wäre.
Von Zeit zu Zeit hörten wir verschiedene Gerüchte über ihn. Bisweilen hieß es, er habe sich dem Genuß des Opiums und der Bibliomanie ergeben, dann wieder, er sei mit sonderbaren chemischen Versuchen beschäftigt. Bisweilen hörte man von Orgien, die er mit der Hefe der Gesellschaft in London feierte. So viel war gewiss, der Oberst führte ein einsames, lasterhaftes, lichtscheues Leben. Ich selbst sah ihn seit seiner Rückkehr nach England nur ein einziges Mal von Angesicht zu Angesicht.
Ungefähr zwei Jahre vor der Zeit, von der ich jetzt schreibe, und ungefähr ein und ein halbes Jahr vor seinem Tode kam der Oberst unerwarteter Weise in Mylady’s Haus in London. Es war am Abend von Fräulein Rachel’s Geburtstag, den 21. Juni, und wir hatten wie gewöhnlich zu Ehren desselben Gesellschaft. Der Diener meldete mir, daß ein Herr mich zu sprechen wünsche. Ich ging hinauf und fand in der Vorhalle den Obersten, alt und schäbig und elend, mit einem so wilden und bösen Ausdruck wie je.
»Gehen Sie hinauf zu meiner Schwester,« sagte er, »und sagen Sie ihr, daß ich gekommen sei, meiner Nichte meine Glückwünsche zu ihrem Geburtstage zu bringen.«
Mehr als einmal hatte er bereits brieflich Versuche gemacht, sich mit Mylady zu versöhnen, natürlich zu keinem andern Zweck, als um sie zu peinigen; aber dies war das erste Mal, wo er selbst in’s Haus kam. Ich war im Begriff zu sagen, daß meine Herrin eben Gesellschaft bei sich habe; aber sein dämonischer Blick hielt mich zurück. Ich ging hinauf, seine Botschaft zu überbringen und ließ ihn, seinem Wunsche gemäß, unten in der Vorhalle warten.
Die Dienerschaft betrachtete ihn von Ferne mit einer ängstlichen Scheu, als ob er eine wandernde Höllenmaschine sei, die mit Pulver und Kugeln geladen, jeden Augenblick explodiren könne.
Mylady hat einen kleinen Ansatz von dem Familien-Temperament.
»Bestellen Sie Oberst Herncastle,« sagte sie, als ich ihr die Botschaft ihres Bruders überbracht hatte, »daß Fräulein Verinder beschäftigt sei und ich ihn nicht zu sehen wünsche.«
Ich versuchte es, eine etwas höflichere Antwort zu erwirken, da ich den Oberst und seine Art kannte, sich über Dinge hinweg zu setzen, vor denen Andere zurückschrecken. Vergebens, das Familien-Temperament brach auf der Stelle hervor.
»Sie wissen, Betteredge, daß ich, wenn ich Ihren Rath haben will, Sie darum frage, und ich habe Sie jetzt nicht darum gefragt.«
Ich ging mit meiner Bestellung hinunter, von der ich mir die Freiheit nahm, eine neue verbesserte Auflage zu machen, die so lautete:
»Herr Oberst, Mylady und Fräulein Rachel bedauern verhindert zu sein und bitten Sie, es zu entschuldigen, daß sie nicht die Ehre haben können, Sie zu sehen.«
Ich war selbst bei dieser milden Form der Antwort darauf gefaßt, ihn losbrechen zu sehen. Zu meinem Erstaunen erfolgte nichts der Art. Er nahm die Sache mit einem Gleichmuthe hin, der mich beunruhigte. Er sah mich einen Augenblick mit seinen glänzenden, grauen Augen fest an und lachte dabei in einer unheimlich boshaften Weise, nicht wie andere Leute aus sich heraus, sondern in sich hinein. »Ich danke Ihnen, Betteredge,« sagte er, »ich werde den Geburtstag meiner Nichte nicht vergessen.«
Mit diesen Worten drehte er sich um und verließ das Haus.
An dem folgenden Geburtstage hörten wir, er liege krank zu Bett. Sechs Monate später, d. h. sechs Monate vor der Zeit, von der ich jetzt berichte, empfing Mylady einen Brief von einem hochachtbaren Geistlichen. Derselbe enthielt zwei höchst merkwürdige Familien-Nachrichten. Erstens, daß der Oberst seiner Schwester auf dem Todbette vergeben habe. Zweitens, daß er auch allen anderen Menschen vergeben habe und mit seinem Gott versöhnt gestorben sei. Ich hege einerseits, trotz Bischöfen und Geistlichkeit, eine ungeheuchelte Achtung vor der Kirche; aber ich bin doch fest überzeugt, daß der Teufel in ungestörtem Besitz der Seele des ehrenwerthen John verblieb und daß die letzte abscheuliche Handlung in dem Leben dieses abscheulichen Menschen mit Respect zu melden darin bestand, den Geistlichen zum Besten zu haben!
Das war in der Kürze, was ich Herrn Franklin zu erzählen hatte. Ich bemerkte, daß er mit immer gespannterer Aufmerksamkeit zuhörte, je länger ich sprach, und daß die Geschichte, wie dem Obersten an dem Geburtstage seiner Nichte bei seiner Schwester die Thür gewiesen worden sei, Herrn Franklin zu berühren schien wie ein Schuß, der in’s Schwarze getroffen hat. Obgleich er es nicht zugeben wollte, sah ich doch deutlich genug an seinem Gesichte, daß mein Bericht ihn beunruhigt hatte.
»Betteredge,« sagte er, »Sie haben das Wort gehabt, jetzt kommt die Reihe an mich. Bevor ich Ihnen jedoch erzähle, was ich in London erfahren habe und wie ich in diese Diamanten-Angelegenheit verwickelt worden bin, wünsche ich noch eins zu wissen. Sie sehen aus, mein alter Freund, als ob Sie nicht recht wüßten, um was es sich eigentlich bei dieser unserer Berathung handelt. Sprechen Ihre Blicke die Wahrheit?«
»Ja gewiß,« erwiderte ich.
»In diesem Fall,« antwortete Hr. Franklin, »wäre es wohl gut, wenn ich Ihnen den Gesichtspunkt, von dem aus ich die Sache ansehe, klar mache, ehe wir weiter gehen. Ich finde in dem Geburtstagsgeschenk des Obersten an meine Cousine Stoff zu drei sehr ernsten Fragen. Folgen Sie meinen Worten genau, Betteredge, und zählen Sie mir an den Fingern nach, wenn Ihnen das die Sache erleichtert,« sagte Herr Franklin mit dem Ausdruck des Wohlgefallens über seinen klaren Verstand, was mich lebhaft an seine Knabenjahre erinnerte »Erste Frage! War der Diamant des Obersten der Gegenstand einer Verschwörung in Indien? Zweite Frage: Ist die Verschwörung dem Diamanten des Obersten nach England gefolgt? Dritte Frage: Wußte der Oberst, daß die Verschwörung dem Diamanten gefolgt sei und hat er somit durch das Geschenk an das unschuldige Kind seiner Schwester diesem absichtlich ein Vermächtniß der Sorge und der Gefahr hinterlassen? —— Das ist es, worauf ich hinaus will, Betteredge, erschrecken Sie nicht.«
Das war leicht gesagt, aber er hatte mich sehr erschreckt.
Wenn er Recht hatte, so war in unser ruhiges englisches Haus plötzlich ein Verderben bringender indischer Diamant eingedrungen, der eine Verschwörung lebendiger Spitzbuben, welche die Rache eines todten Mannes auf uns losgelassen hatte, nach sich zog. Das war unsere Situation, wie Herrn Franklin’s letzte Worte sie mir offenbart hatten! Wer hat je im neunzehnten Jahrhundert, in einer Zeit des Fortschritts und in einem Lande, das sich der Segnungen der britischen Verfassung erfreut, von so etwas gehört. Gewiß kein Mensch und daher wird auch Keiner es glauben. Nichtsdestoweniger aber werde ich ruhig in meiner Geschichte fortfahren.
Unter zehn Fällen eines plötzlichen Schreckens, wie ich ihn eben gehabt hatte, fühlen wir die Wirkung neun Mal zuerst im Magen, und wenn der Magen anfängt, seine Rechte geltend zu machen, so schwindet die Aufmerksamkeit und man wird nervös. Eine solche Nervosität ergriff mich auf meinem Platz im Sande. Herr Franklin, der mich mit den Wirkungen eines angegriffenen Magens oder Gemüths, wie man will —— das kommt auf Eins heraus —— kämpfen sah, hielt, eben im Begriff, seine Geschichte zu beginnen, inne und sagte: »Was fehlt Ihnen?«
Was mir fehlte? Ihm gestand ich es nicht, aber dem Leser will ich es im Vertrauen sagen: Mir fehlten ein paar Züge aus meiner Pfeife und ein Blick in meinen Robinson Crusoe.«

Sechstes Capitel.
Ich behielt also meine geheimen Wünsche für mich und bat Herrn Franklin fortzufahren. Er antwortete:
»Werden Sie mir nicht nervös, Betteredge,« und erzählte weiter.
Er fing damit an, mir mitzutheilen, daß seine Entdeckungen in Betreff des berüchtigten Obersten und des Diamanten ihren Anfang bei einem Besuch genommen hätten, den er, bevor er zu uns gereist sei, dem Advokaten seines Vaters in Hampstead gemacht habe; durch ein nach Tische, als Herr Franklin einmal mit dem Advokaten allein war, zufällig gegen denselben ausgesprochenes Wort erfuhr der Letztere, daß Herr Franklin von seinem Vater mit der Uebergabe eines Geburtstagsgeschenkes an Fräulein Rachel beauftragt sei. Ein Wort gab das Andere, bis der Advokat unsern jungen Freund endlich darüber aufklärte, worin das Geschenk eigentlich bestehe und wie das freundschaftliche Verhältnis; zwischen dem verstorbenen Obersten und dem älteren Herrn Blake entstanden sei. Die hierauf bezüglichen Thatsachen sind so außerordentlicher Natur, daß ich mich der Zweifel nicht erwehren kann, ob ich sie gehörig werde berichten können. Ich ziehe es daher vor, Herrn Franklins Entdeckungen so genau wie möglich mit seinen eigenen Worten wiederzugeben.
»Sie erinnern sich der Zeit, Betteredge,« fing er an, »wo mein Vater es versuchte, seine Ansprüche auf jenes unglückliche Herzogthum zu beweisen. Nun, gerade um dieselbe Zeit kehrte mein Onkel Herncastle von Indien zurück. Mein Vater machte die Entdeckung, daß sein Schwager in Besitz gewisser Papiere sei, die ihm wahrscheinlich in seinem Prozeß von Nutzen würden sein können. Er besuchte den Obersten unter dem Vorwand, ihn bei seiner Rückkehr nach England willkommen zu heißen. Der Oberst ließ sich aber nicht auf diese Weise fangen.
»Sie wollen etwas von mir,« sagte er ihm gerade ins Gesicht, »sonst hätten Sie niemals Ihren Ruf durch einen Besuch bei mir aufs Spiel gesetzt.«
Mein Vater» begriff, daß es hier das Gerathenste sei, offenes Spiel zu spielen; er gestand also ohne Weiteres zu, daß er der fraglichen Papiere wegen gekommen sei. Der Oberst erbat sich einen Tag Bedenkzeit. Dann erfolgte seine Antwort in Gestalt eines höchst merkwürdigen Briefes, den mir mein Freund, der Advokat, zeigte. Der Oberst fing damit an zu sagen, daß er auch seinerseits etwas von meinem Vater wolle, und daß er sich daher erlaube, ihm einen Austausch von Freundschaftsdiensten zu proponiren. Das Kriegsunglück, wie er sich ausdrückte, habe einen der größten Diamanten in der Welt in seinen Besitz gebracht und er habe Ursache, zu besorgen, daß weder er noch sein kostbarer Edelstein in irgend einem Hause, in irgend einem Theile der Welt, wo sie sich mit einander aufhalten möchten, vor Verfolgung sicher sei. Unter so beunruhigenden Umständen habe er beschlossen, den Diamanten einer andern Person zur Aufbewahrung anzuvertrauen. Diese Person werde dabei keinerlei Gefahr laufen. Sie könne den Edelstein in irgend ein sicheres, wohlbewachtes Gewahrsam bringen, z. B. in das feuerfeste Gewölbe eines Banquiers oder eines Juweliers niederlegen. Die Verantwortlichkeit dieser Person würde eine wesentlich passive sein. Was sie zunächst zu thun habe, sei selbst oder durch einen vertrauenswürdigen Bevollmächtigten unter einer vorher verabredeten Adresse an gewissen vorher verabredeten Tagen des Jahres ein Billet des Obersten in Empfang zu nehmen, das einfach besage, daß der Oberst an dem betreffenden Tage noch am Leben sei.
In dem Fall, wo ein solcher Tag ohne das Eintreffen des besagten Billets vorüber gehen werde, könne das Schweigen des Obersten als ein sicheres Zeichen der Ermordung desselben betrachtet werden. In diesem Fall und nur in diesem Fall sollten gewisse, auf die Disposition über den Diamanten bezügliche und mit demselben deponirte versiegelte Instructionen geöffnet und genau befolgt werden. Wenn mein Vater sich entschließen sollte, diesen sonderbaren Auftrag zu übernehmen, so ständen ihm dagegen die von ihm gewünschten Papiere zur Verfügung. Das war der Inhalt des Briefes.
»Und was beschloß Ihr Vater?« fragte ich.
»Was er beschloß,« erwiderte Franklin, »das will ich Ihnen sagen. Er wandte die unschätzbare Gabe, die man gesunden Menschenverstand nennt, auf den Brief des Obersten an und erklärte die ganze Geschichte für eine Abgeschmacktheit. Der Oberst sei irgendwo während seiner Reisen in Indien auf einen elenden Krystall gestoßen, den er für einen Diamanten genommen habe. Was die von ihm gefürchtete Gefahr einer Ermordung Und die von ihm erdachten Vorsichtsmaßregeln zur Erhaltung seines Lebens und des Krystalls beträfe, so lebten wir ja im neunzehnten Jahrhundert und jeder verständige Mensch werde sich zur Abwendung solcher Gefahren einfach an die Polizei wenden. Der Oberst sei notorisch seit Jahren ein Opiumesser und wenn die einzige Art, werthvolle Papiere von ihm zu erlangen, darin bestehe, daß man die Träume eines Opiumrausches für Wirklichkeit nehme, so, dachte mein Vater, könne er sich um so eher bereit erklären, die ihm zugemuthete lächerliche Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen, als damit keinerlei Unbequemlichkeiten für ihn verbunden seien. Der Diamant und die versiegelten Instructionen wanderten demgemäß in das Gewölbe seines Banquiers und die periodischen Zuschriften des Obersten, die ihn für noch lebend erklärten, wurden von dem Advokaten meines Vaters, als seinem Bevollmächtigten, regelmäßig entgegengenommen und geöffnet. Kein verständiger Mensch würde in einer ähnlichen Lage anders haben handeln können. Nichts in dieser Welt, mein lieber Betteredge, erscheint uns wahrscheinlicher, als was in den Kreis unserer trügerischen Erfahrungen tritt, und eine romantische Geschichte finden wir nicht eher glaubwürdig als bis wir sie gedruckt lesen.«
Aus diesen Worten wurde mir klar, daß Herr Franklin die Vorstellungen seines Vaters über den Obersten für übereilt und verkehrt hielt.
»Und wie denken Sie selbst über die Sache?« fragte ich.
»Lassen Sie mich erst die Geschichte des Obersten zu Ende erzählen,« antwortete Herr Franklin »Wir Engländer haben eine merkwürdig unsystematische Art, zu denken und Ihre Frage, mein alter Freund, ist eine Probe davon. Das einzige Feld der Mechanik ausgenommen, sind wir, bildlich zu sprechen, das liederlichste Volk in der Welt.«
Das kommt, dachte ich bei mir, von der ausländischen Erziehung. Dieses Sticheln auf uns Engländer wird er vermuthlich in Frankreich gelernt haben.
Herr Franklin nahm den Faden seiner Erzählung wieder auf und fuhr fort:
»Mein Vater bekam die Papiere, die er wünschte, und sah seinen Schwager von jener Zeit an nicht wieder. Jahr für Jahr kam an den verabredeten Tagen der verabredete Brief des Obersten und wurde von dem Advokaten geöffnet. Ich habe all’ die Briefe bei einander gesehen, alle in derselben kurzen, geschäftsmäßigen Weise geschrieben wie folgt:
Mein Herr, diese Zeilen haben den Zweck,
zu
constatiren, daß ich noch am Leben bin. Lassen Sie
den
Diamant in seinem Gewahrsam.
John Herncastle.
»Das war Alles, was die regelmäßig eintreffenden Briefe je enthielten, bis vor etwa sechs bis acht Monaten, wo der Inhalt des Briefes zum ersten Mal anders und zwar so lautete:
Mein Herr!
Man sagt mir, daß ich sterben muß.
Kommen
Sie zu mir und helfen mir bei der Abfassung
meines
Testaments.
»Der Advokat ging hin und fand den Obersten in der, kleinen vorstädtischen, von ihm gehörigen Ländereien umgebenen Villa, in der er einsam gelebt hatte, seit er von Indien zurückgekommen war. Er hielt sich Hunde, Katzen und Vögel zu seiner Gesellschaft, aber kein menschliches Wesen außer der Person, die täglich kam, das Haus in Ordnung zu halten und den Doktor an seinem Krankenbette. Die Abfassung des Testaments war eine höchst einfache Sache. Der Oberst hatte den größeren Theil seines Vermögens in chemischen Experimenten verbracht. Sein Testament bestand Alles in Allem aus drei Clauseln, welche er von seinem Bette aus in vollem Bewußtsein dictirte. Die erste Clausel sorgte für die gute Verpflegung seiner Thiere, die zweite gründete eine Professur der Chemie an einer Universität im Norden Englands. Durch die dritte endlich vermachte er den Mondstein seiner Nichte als Geburtstagsgeschenk unter der Bedingung, daß mein Vater es übernehme, als sein Testamentsvollstrecker zu fungiren. Anfänglich verweigerte mein Vater das, nach näherer Ueberlegung jedoch gab er nach, theils weil er sich überzeugt hatte, daß die Executorschaft keinerlei Unannehmlichkeit für ihn mit sich führen werde, theils weil der Advokat in Rachels Interesse darauf aufmerksam machte, daß der Diamant doch schließlich seinen Werth haben könne.«
»Gab der Oberst irgend welche Gründe an,« warf ich ein, warum er Fräulein Rachel den Diamanten vermache?«
»Er gab solche Gründe nicht allein an, sondern er ließ sie ausdrücklich in sein Testament mit aufnehmen,« antwortete Franklin »Ich habe einen Auszug bei mir, den ich Ihnen gleich zeigen will. Keine englische Abschweifung, Betteredge! Eines nach dem andern. Sie haben also jetzt von dem Testament des Obersten gehört, nun sollen Sie erfahren, was nach dem Tode des Obersten geschah. Es war erforderlich, eine Schätzung des Diamanten vornehmen zu lassen, bevor das Testament in Kraft treten konnte? Alle zu Rath gezogenen Juweliere bestätigten die Behauptung des Obersten, daß sein Diamant einer der größten in der Welt sei. Die genaue Schätzung desselben aber hatte ihre großen Schwierigkeiten. Seine Größe machte ihn zu einem Phänomen aus dem Diamantenmarkt; seine Farbe war einzig in ihrer Art und abgesehen von diesen die Schätzung erschwerenden Momenten hatte der Stein einen Fehler in Gestalt einer im Innern desselben befindlichen Blase. Trotz dieses letzten ernstlichen Mangels aber war er nach den niedrigsten unter den verschiedenen Schätzungen Zwanzig Tausend Pfund werth. Stellen Sie sich das Erstaunen meines Vaters vor! Um ein Haar hätte er sich geweigert, als Testamentsvollstrecker zu fungiren und den Verlust dieses kostbaren Edelsteins für die Familie verschuldet. Das Interesse, das die Angelegenheit jetzt für ihn gewann, veranlaßte ihn, die versiegelten Instructionen zu öffnen, die zugleich mit dem Diamanten deponirt worden waren. Der Advokat zeigte mir dieses Document nebst den übrigen Papieren, und ich glaube, darin den Schlüssel zu der Art von Verschwörung zu finden, welche das Leben des Obersten bedrohte.«
»Sie glauben also,« sagte ich, »daß wirklich eine solche Verschwörung bestand?«
»Ich, der ich mich nicht des ausgezeichneten gesunden Menschenverstandes meines Vaters erfreue, glaube, daß das Leben des Obersten wirklich in der Art bedroht war wie er es behauptete. Die versiegelten Instructioncn enthalten, glaube ich, die Erklärung dafür, wie er trotz alledem ruhig in seinem Bette starb« Für den Fall, daß er eines gewaltsamen Todes sterben, d. h. für den Fall, daß an einem der verabredeten Tage das verabredete Schreiben ausbleiben sollte, wurde mein Vater in den Instructionen beauftragt, den Mondstein heimlich nach Amsterdam zu schicken Er sollte zu einem bezeichneten Diamantenschneider in dieser Stadt gebracht und von diesem in vier bis sechs Theile zerlegt werden. Diese Steine sollten dann zu dem höchsten erreichbaren Preise verkauft und der Erlös auf die Gründung jener Professur der Experimental-Chemie verwendet werden, welche der Oberst seitdem in seinem Testament verfügt hat. Nun, Betteredge, nehmen Sie Ihren ganzen scharfen Verstand zusammen und ziehen Sie die Schlüsse, auf welche die Instructionen meines Onkels hinleiten.«
Ich nahm also meinen Verstand zusammen, der von der liederlichen englischen Beschaffenheit war und demgemäß Alles durcheinander rührte, bis Herr Franklin dazwischen fuhr und mich aus die rechte Fährte brachte.
»Bemerken Sie wohl,« sagte Herr Franklin, »daß die Unversehrtheit des Diamanten als eines ganzen Steines hier von der Bewahrung des Leben des Obersten vor einem gewaltsamen Ende abhängig gemacht ist. Es genügt ihm nicht, seinen Feinden zu sagen: »Tödtet mich, und Ihr werdet nicht besser an den Diamanten gelangen können als jetzt, er ist an einem Ort, aus dem Ihr ihn nicht herausholen könnt, in dem wohl bewachten Gewölbe einer Bank,« sondern er sagt: »Tödtet mich, und der Diamant hört auf in seiner jetzigen Gestalt zu existiren, wird nicht mehr derselbe sein.« Was bedeutet das?«
Hier glaubte ich, von einem Blitz des wunderbaren ausländischen Geistes erleuchtet zu sein.
»Ich hab’s,« sagte ich, »es bedeutet, daß der Werth des Steins vermindert werden soll und daß die Spitzbuben ans diese Weise um ihre Beute betrogen werden sollen.«
»Durchaus nicht,« entgegnete Herr Franklin, »ich habe mich danach erkundigt. Wenn der defecte Diamant in Stücke geschnitten würde, wäre ein höherer Preis dafür zu erzielen, als jetzt, aus dem einfachen Grunde, daß vier bis sechs tadellose Diamanten aus demselben gemacht werden könnten, welche zusammen werthvoller sein würden, als der eine große, aber unvollkommene Stein. Wenn Raub aus Gewinnsucht das Endziel der Verschwörung gewesen wäre, so hätten die Räuber in Folge der Instructionen, die den Stein noch werthvoller machten, ihren Zweck nur noch besser erreicht. Es hätte mehr Geld dafür erlangt werden können und die Verwerthung aus dem Diamantenmarkte würde unendlich viel leichter gewesen sein, wenn der Stein durch die Hände des Diamantenschneiders in Amsterdam gegangen wäre.«
»Um’s Himmels willens« brach ich aus, »worin bestand denn die Verschwörung?«
»Es war eine organisirte Verschwörung der Indier, denen der Edelstein ursprünglich gehört hatte,« sagte Herr Franklin, eine Verschwörung, der, ein alter indischer Aberglaube zu Grunde lag. Das ist meine Ansicht, wie sie durch ein Familienpapier bestätigt wird, das ich in diesem Augenblick bei mir trage.«
Jetzt begriff ich, warum das Erscheinen der drei indischen Jongleurs vor unserm Hause einen solchen Eindruck auf Herrn Franklin gemacht hatte.
»Ich will Ihnen meine Ansicht nicht aufdrängen,« fuhr Herr Franklin fort, »die Idee, daß gewisse auserwählte Anhänger eines alten indischen Aberglaubens sich durch alle Schwierigkeiten und Gefahren hindurch der Aufgabe widmen, die Gelegenheit zur Wiedererlangung ihres kostbaren Juwels zu erspähen, scheint mir vollkommen mit allem dem zu stimmen, was wir über die Ausdauer orientalischer Völker und den Einfluß orientalischer Religionen wissen. Aber ich habe auch Einbildungskraft, und Schlächter, Bäcker und Zolleinnehmer sind für mich nicht die einzigen glaubhaften Existenzen. Lassen wir übrigens den Werth meiner vermeintlichen Aufschlüsse über die Sache auf sich beruhen und zu der einzigen praktischen Frage übergehen, die uns dabei angeht. Ueberlebt die Verschwörung gegen den Mondstein den Tod des Obersten? Und wußte der Oberst es, als er den Stein seiner Nichte zum Geburtstagsgeschenk vermachte?«
Jetzt fing ich an, zu begreifen, wie sehr Mylady und Fräulein Rachel bei der ganzen Sache interessirt seien und hörte seinem ferneren Bericht mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zu.
»Ich hatte keine große Lust« fuhr Herr Franklin fort, »nachdem ich die Geschichte des Mondsteins herausgefunden hatte, der Ueberbringer desselben zu werden; aber mein Freund, der Advokat, stellte mir vor, daß doch Jemand das meiner Cousine bestimmte Vermächtniß in ihre Hände legen müsse und daß ich nicht mehr Grund habe, als ein Anderer, mich dieser Uebergabe zu entziehen. Nachdem ich den Diamanten aus dem Gewölbe der Bank geholt und an mich genommen hatte, kam es mir vor, als ob ich auf den Straßen von einem schäbig aussehenden dunkelfarbigen Kerl verfolgt würde. Ich ging nach Hause, um mein Gepäck zu holen und fand dort einen Brief vor, der mich unerwarteter Weise in London zurückhielt. Ich ging mit dem Diamanten wieder nach der Bank und glaubte abermals den schäbigen Kerl zu sehen, und diesen Morgen, wo ich den Diamanten wieder aus der Bank holte, sah ich den Menschen zum dritten Mal, entwischte ihm und reiste, bevor er meine Spur wieder aufgefunden hatte, mit dem Morgen- statt mit dem Nachmittagszuge ab. Hier komme ich wohl und munter mit dem Diamanten an, und was ist die erste Nachricht mit der ich empfangen wurde? Ich höre, daß drei indische Herumtreiber sich vor dem Hause gezeigt haben und daß meine Ankunft von London und etwas, das ich bei mir tragen soll, der Gegenstand ihrer besondern Nachforschung sind, sobald sie sich allein glauben. Ich will mich nicht weiter dabei aufhalten, wie sie Tinte in die Hand des Jungen gießen und ihn in derselben einen entfernten Mann und etwas in dessen Tasche sehen heißen. Ich habe dergleichen oft genug in Indien gesehen und halte es, wie Sie, für Hokus-Pokus. Worauf es jetzt einzig und allein für uns ankommt, ist die Frage, ob ich mit Unrecht diesem Vorfalle Bedeutung beilege, oder ob wir wirklich Grund haben, anzunehmen, daß die Indier die Spur des Mondsteins von dem Moment an verfolgen, wo derselbe das sichere Gewahrsam der Bank verlassen hat.«
Und doch schien uns Beide diese Frage nicht vorzugsweise zu beschäftigen. Wir sahen uns einander an und blickten dann auf die Fluth, wie sie sich sachte höher und höher über den Zitterstrand ergoß.
»Woran denken Sie?« fragte Herr Franklin plötzlich.
»Ich dachte,« antwortete ich, »daß ich den Diamanten am liebsten in den Flugsand versenken und so der ganzen Sache ein Ende machen möchte.«
»Wenn Sie den Werth des Steines aus Ihrer Tasche ersetzen wollen, so sagen Sie es nur, Betteredge, und auf der Stelle versenke ich den Stein.«
Es ist merkwürdig, wie uns, bei einem aufgeregten Gemüthszustand, der kleinste Schmerz erleichtern kann. Wir fanden damals eine unerschöpfliche Quelle von Späßen in der Ausmalung der schrecklichen Verlegenheiten, in welche Herr Blake als Exekutor gerathen würde, wenn wir das Eigenthum von Fräulein Rachel verschleudern würden, obgleich es mir jetzt völlig unerfindlich ist, worin eigentlich die Veranlassung zu unserm Scherzen lag.
Herr Franklin brachte unser Gespräch zuerst wieder auf seinen eigentlichen Gegenstand zurück. Er nahm ein Couvert aus seiner Tasche, öffnete dasselbe und gab mir das darin befindliche Papier.
»Betteredge,« sagte er, »wir müssen um meiner Tante willen der Frage nach den Motiven, die den Obersten bei dem Vermächtniß an seine Nichte geleitet haben, grade in’s Gesicht sehen. Erinnern Sie sich, wie Lady Verinder ihren Bruder von dem Augenblick seiner Rückkehr nach England an bis zu der Zeit behandelt hat, wo er zu Ihnen sagte: er werde des Geburtstages seiner Nichte gedenken. Und dann lesen Sie dies.«
Das Papier enthielt einen Auszug aus dem Testament des Obersten. Er liegt neben mir, während ich dieses schreibe, und ich will es in Folgendem zum Besten des Lesers abschreiben.
»Drittens und letztens schenke und vermache ich meiner Nichte Rachel,Verinder, Tochter Und einzigem Kinde meiner verwittweten Schwester Julia Verinder, für den Fall, daß genannte Julia Verinder an dem ersten meinem Tode folgenden Geburtstage genannter Rachel Verinder am Leben sein sollte, den mir gehörenden, im Orient unter dem Namen »der Mondstein« bekannten gelben Diamanten. Und ich will, daß mein Testament-Executor meinen Diamanten entweder durch seine eigenen Hände oder durch die Hände einer zuverlässigen von ihm dazu beauftragten Person in den Besitz meiner genannten Nichte Rachel an ihrem nächsten Geburtstage nach meinem Tode, und wo möglich in Gegenwart meiner Schwester, der genannten Julia Verinder, gelangen lasse. Und ich will, daß meine genannte Schwester durch eine beglaubigte Abschrift dieser der dritten und letzten Klause! meines Testaments davon in Kenntniß gesetzt werde, daß ich ihr die Schmach, die sie durch ihr Benehmen gegen mich meinem Ruf während meines Lebens angethan hat, aus freiem Willen vergeben habe, und insbesondere als einen Beweis dafür, daß ich, wie es einem Sterbenden wohl ansteht, die mir als einem Officier und Gentleman zugefügte Beleidigung verzeihe, daß ihr Diener auf ihren Befehl mir am Geburtstag ihrer Tochter die Thür ihres Hauses weisen mußte.«
Weitere Bestimmungen verfügten für den Fall, daß Mylady oder Fräulein Rachel zur Zeit des Ablebens des Testators verstorben sein sollten, daß der Diamant in Gemäßheit der versiegelten und mit demselben deponirten Instructionen nach Holland geschickt werden solle. Der Erlös des Verkaufs sollte in diesem Falle der Summe hinzugefügt werden, welche bereits durch das Testament für die Gründung einer Professur der Chemie an einer Universität des Nordens bestimmt war.
Ich gab Herrn Franklin das Papier zurück und wußte nicht, was ich sagen sollte. Bis zu jenem Augenblick war ich, wie der Leser weiß, der Ansicht gewesen, daß der Oberst als ein eben so schlechter Mensch gestorben sei, wie er gelebt habe. Nun will ich nicht sagen, daß der abschriftliche Auszug aus dem Testament mir sofort eine andere Meinung beibrachte, ich sage nur, daß er mich betroffen machte.
»Nun,« fragte Herr Franklin, »was sagen Sie jetzt, nachdem Sie die eigene Aussage des Obersten gelesen haben, was sagen Sie? Diene ich, indem ich den Mondstein in das Haus meiner Tante bringe, seiner Rache als ein blindes Werkzeug, oder diene ich dazu, seinen Charakter als den eines reuigen Christen wieder herzustellen?«
»Es scheint sehr hart,« antwortete ich, »zu sagen, daß er mit einer schrecklichen Rache im Herzen und einer fürchterlichen Lüge aus den Lippen gestorben sei. Gott allein weiß die Wahrheit! Fragen Sie mich nicht!«
Herr Franklin saß da und drehte und wendete den Testaments-Auszug in seinen Händen herum, als ob er auf diese Weise die Wahrheit herauspressen könnte. Sein Aussehen änderte sich dabei auffallend, hatte er kurz zuvor noch heiter und frisch ausgesehen, so erschien er jetzt aus fast unerklärliche Weise als ein ernster; feierlicher und nachdenklicher junger Mann.«
»Diese Frage hat zwei Seiten,« sagte er, »eine objective und eine subjective. Welcher sollen wir uns zuwenden?«
Er hatte sowohl eine deutsche wie eine französische Erziehung genossen. Bis jetzt hatte die eine von beiden; wie ich glaubte, ausschließlichen Besitz von ihm genommen, jetzt aber trat, so viel ich es beurtheilen konnte, die andere an die Stelle. Es ist einer meiner Grundsätze im Leben, nie Bemerkungen bei etwas zu machen, was ich nicht verstehe. Mit andern Worten: Ich sah ihm gerade in’s Gesicht und sagte weiter nichts.
»Suchen wir uns die wahre Bedeutung dieser Worte klar zu machen,« fuhr Herr Franklin fort, »warum hat mein Onkel den Diamanten Rachel und nicht meiner Tante vermacht?«
»Das ist nicht schwer zu errathen,« erwiderte ich, «Oberst Herncastle kannte Mylady gut genug, um zu wissen, daß sie die Annahme jedes von ihm kommenden Vermächtnisses verweigert haben würde.«
»Und woher wußte er, daß Rachel nicht ebenfalls die Annahme eines solches Vermächtnisses verweigern würde?«
»Giebt es ein junges Mädchen, die der Versuchung, ein solches Geburtstagsgeschenk wie den Mondstein anzunehmen, zu widerstehen vermöchte?«
»Das ist die subjective Art, die Sache anzusehen,« entgegnete Herr Franklin »Es macht ihnen alle Ehre, Betteredge, daß Sie sich zu dieser Betrachtungsweise zu erheben im Stande sind. Das Vermächtnis des Obersten birgt aber noch ein anderes Geheimniß, welches wir noch nicht berücksichtigt haben. Wie sollen wir es erklären, daß es Rachel ihr Geburtstagsgeschenk nur unter der Bedingung vermacht, daß ihre Mutter noch am Leben sei?«
»Ich möchte einem Todten nichts Böses nachreden,« antwortete ich, »aber wenn er seiner Schwester absichtlich durch ein ihrem Kinde gemachtes Geschenk ein Vermächtniß voll Sorge und Gefahr hinterlassen hat, so mußte er natürlich das Geschenk an die Bedingung des Lebens seiner Schwester knüpfen, damit sie die ihr zugedachten Unannehmlichkeiten empfinden könne.«
So erklären Sie also seine Motive? Wieder die subjective Erklärung! Sind Sie je in Deutschland gewesen, Betteredge?«
»Nein, und was ist Ihre Erklärung, wenn ich fragen darf?«
»So viel ich sehe,« sagte Herr Franklin, kann der Zweck des Obersten sehr wohl der gewesen sein, nicht seiner Nichte, die er nie gesehen hatte, etwas Gutes zu erzeigen, sondern seiner Schwester auf sehr graciöse Art durch ein ihrer Tochter gemachtes Geschenk zu beweisen, daß er ihr sterbend vergeben habe. Da haben Sie eine von der Ihrigen ganz verschiedene Art der Erklärung, die von einer subjectiv-objectiven Betrachtungsweise ausgeht. So weit ich es zu beurtheilen vermag, hat die eine Erklärung genau so viel für sich, als die andere.«
Als er die Frage auf diesen befriedigenden Punkt gebracht hatte, schien Herr Franklin zu finden, daß er Alles gethan habe, was von ihm verlangt werden könne. Er legte sich flach auf den Rücken in den Sand und fragte, was nun zu thun sei. Er war so klar und verständig gewesen, bevor er sein ausländisches Kauderwelsch ausgekramt hatte und hatte bis zu jenem Augenblick so vollständig die Leitung der Sache in die Hand genommen, daß ich auf einen solchen plötzlichen Wechsel, wie er ihn jetzt durch seinen hilflosen Appell an meinen Rath kundgab, völlig unvorbereitet war. Erst später erfuhr ich von Fräulein Rachel, welche zuerst die Entdeckung gemacht hatte, daß diese seltsamen Wechsel und Verwandlungen in Herrn Franklin’s Wesen von seiner ausländischen Erziehung herrührten. In dem Alter, wo wir Alle am bildsamsten und besonders geneigt sind, das Wesen anderer Leute auf uns wirken zu lassen, war er in’s Ausland geschickt und von einer Station zur andern gebracht worden, bevor er Zeit gehabt hätte, mehr die bei der einen als die bei der andern empfangenen Eindrücke in sich zu fixiren. In Folge davon hatte sich sein Wesen bei seiner Rückkehr so eigenthümlich entwickelt, daß er sein Leben in beständigem Widerspruch mit sich selbst und in einem Zustande zuzubringen schien, in welchem Alles mehr oder weniger unfertig und mehr oder weniger gegensätzlich erschien. Er konnte geschäftig und müßig, klar und verwirrt in seinem Kopf, ein Muster von Entschlossenheit und ein Opfer der bejammernswerthesten Hilflosigkeit sein, Alles durcheinander. Er hatte seinen französischen, seinen deutschen und seinen italienischen Charakter, wobei die englische Grundlage hie und da immer wieder durchbrach, als wolle sie sagen: »Hier bin ich, traurig verwandelt; aber es steckt doch immer noch etwas von mir in ihm.« Fräulein Rachel pflegte zu sagen, sein italienischer Charakter zeige sich bei den Gelegenheiten, wo er unerwarteter Weise nachgebe und einen Andern in seiner freundlich einschmeichelnden Weise bitte, ihm die ans ihm lastende Verantwortlichkeit abzunehmen. Man wird ihn, denke ich, nicht falsch beurtheilen, wenn man findet, daß eben jetzt der italienische Charakter die Oberhand bei ihm gewonnen hatte.
»Ich sollte denken, es wäre Ihre Sache, zu wissen, was jetzt zu thun ist, meine ist es gewiß nicht.«
Herr Franklin schien die Berechtigung meiner Frage nicht einzusehen, da er in jenem Augenblick nicht in der Lage war, überhaupt etwas Anderes als den Himmel über sich zu sehen.
»Ich möchte meine Tante nicht ohne Grund beunruhigen,« sagte er, »und doch möchte ich sie auch wieder nicht ohne eine, vielleicht dringend nöthige Warnung verlassen. Sagen Sie mir mit einem Wort, was Sie an meiner Stelle thun würden.«
In einem Wort sagte ich ihm »Warten.«
»Das will ich herzlich gern,« antwortete Herr Franklin, »aber wie lange?«
Ich erklärte mich nun:
»Wenn ich recht verstehe, so soll Jemand diesen vermaledeiten Diamanten an Fräulein Rachels Geburtstag in ihre Hände legen und dieser Jemand können Sie so gut sein, wie ein Anderer. Gut, heute haben wir den 25. Mai und der Geburtstag ist am 21. Juni. Bis dahin haben wir also noch beinahe vier Wochen vor uns. Lassen Sie uns abwarten, was inzwischen geschieht, und lassen Sie uns je nach den Umständen Mylady von der Sache in Kenntniß setzen oder nicht.«
»Vortrefflich, Betteredge, so weit wir damit kommen,« erwiderte Herr Franklin, »aber was sollen wir von nun bis zum Geburtstag mit dem Diamanten anfangen?«
»Ganz dasselbe, was Ihr Vater« damit anfing,« sagte ich. »Ihr Vater legte ihn in das sichere Gewahrsam einer Bank in London. Und Sie können ihn in das Gewahrsam der Bank von Frizinghall legen (Frizinghall war die uns nächstgelegene Stadt und die Bank von England konnte nicht sicherer sein, als die dortige Bank). An Ihrer Stelle« fügte ich hinzu, »würde ich unverzüglich mit dem Diamanten nach Frizinghall reiten, ehe die Damen zurückkommen.«
Die Aussicht etwas zu thun, und was mehr ist, dieses Etwas zu Pferde zu thun, ließ Herrn Franklin wie einen Blitz vom Sande aufschnellen. Er sprang auf und riß mich ohne Umstände mit sich in die Höhe.
»Betteredge, Sie verdienen in Gold gefaßt zu werden,« rief er, »kommen Sie mit und satteln Sie mir auf der Stelle das beste Pferd im Stall.«
Gottlob! Da kam einmal die englische Grundlage durch all’ den ausländischen Firniß zum Vorschein. Das war wieder mein junger Franklin, wie ich ihn vor Jahren gekannt hatte, der bei der Aussicht auf einen Ritt hervorbrach und der mich an gute alte Zeiten erinnerte. Ein Pferd für ihn satteln! Ich hätte gern ein Dutzend für ihn gesattelt, wenn er sie nur Alle auf einmal hätte reiten können! Wir kehrten rasch nach Hause zurück, sattelten rasch das flinkste Pferd im Stall, und Franklin trabte eben so rasch davon, um den verfluchten Diamanten wieder in das Gewölbe einer Bank einzuschließen. Als ich den letzten Hufschlag seines Pferdes hatte verhallen hören und mich auf dem Hofe wieder allein fand, war mir beinahe zu Muthe, als ob ich eben ans einem Traum erwacht wäre.

Siebentes Capitel.
Während ich mich noch so in diesem halbwachen Zustande befand und ein bischen Ruhe, um» wieder zu mir zu kommen, sehr nöthig hatte, trat meine Tochter Penelope mir in den Weg, gerade wie ihre Mutter mir auf der Treppe in den Weg zu treten pflegte, und wollte auf der Stelle Alles von mir wissen, was in der Berathung zwischen mir und Franklin zur Sprache gekommen sei. Wie die Sachen standen, war es das Gerathenste, auf der Stelle der Flamme von Penelopes Neugierde mit einem Dämpfer das Garaus zu machen. Demgemäß antwortete ich, daß Herr Franklin und ich uns über auswärtige Politik unterhalten hätten, bis wir Beide müde geworden und in der Sonnenhitze eingeschlafen seien. Diese Art von Antwort empfehle ich meinem geneigten Leser als ein probates Mittel für das nächste Mal, wo ihn seine Frau oder seine Tochter zu einer unbequemen Zeit mit einer unbequemen Frage plagen wollen, und er kann sich darauf verlassen, daß sie ihn mit ihrer angeborenen Liebenswürdigkeit küssen und bei der nächsten Gelegenheit wieder fragen werden.
Im Laufe des Nachmittags kamen Mylady und Fräulein Rachel wieder nach Hause.
Ich brauche wohl nicht zu sagen. wie erstaunt sie waren, als sie hörten, daß Herr Franklin Blake angekommen, aber auch bereits wieder fortgeritten sei. Ich brauche wohl eben so wenig zu sagen, daß sie sofort unbequeme Fragen an mich richteten und daß die »auswärtige Politik« und das »Einschlafen in der Sonne« mir bei ihnen nicht zum zweiten Male über alle Schwierigkeiten hinweghelfen sollten. Da ich nichts Anderes zu sagen wußte, so erklärte ich, Herrn Franklin’s Ankunft mit dem früheren Zuge sei nur auf Rechnung eines seiner gewöhnlichen grillenhaften Einfälle zu setzen. Als sie mich dann fragten, ob sein Wiederwegreiten auch nur einer von seinen grillenhaften Einfällen sei, bejahte ich diese Frage und zog mich, glaube ich, auf diese Weise sehr gut aus der Affaire.
Nachdem ich die Schwierigkeit mit den Damen so glücklich überwunden hatte, fand ich, daß neue Schwierigkeiten meiner warteten, als ich auf mein Zimmer zurückkehrte. Penelope trat herein, indem sie mich mit angeborner weiblicher Liebenswürdigkeit küßte und mich damit zur Beantwortung einer neuen Frage, die ihr die angeborne weibliche Neugier eingab, geneigt machen wollte. Diesmal wollte sie nur von mir wissen, was es für eine Bewandtniß mit ihrem zweiten Hausmädchen, Rosanna Spearman, habe.
Rosanna war, wie es schien, nachdem sie Herrn Franklin und mich am Zitterstrand verlassen hatte, in einem unerklärlichen Gemüthszustande zurückgekehrt. Sie hatte (wenn man Penelopes Bericht Glauben schenken durfte) abwechselnd in allen Farben des Regenbogens gespielt. Sie war ohne erkennbaren Grund lustig und wieder ohne Grund traurig gewesen. In einem Athem hatte sie Hunderte von Fragen über Herrn Franklin Blake gethan; und gleich darauf war sie ärgerlich darüber geworden, daß Penelope sich herausnähme, zu denken, daß ein fremder Herr irgend ein Interesse für sie haben könne. Man hatte sie dabei ertappt, wie sie lächelnd Herrn Franklin’s Namen in den Deckel ihres Arbeitskästchens kritzelte. Ein andermal wieder hatte man sie überrascht, als sie weinend ihre verwachsene Schulter im Spiegel betrachtete. Kannten sie und Herr Franklin sich schon von früher her? Unmöglich! Hatten sie von einander gehört? ebenso unmöglich! Ich konnte versicherte, daß Herrn Franklin’s Erstaunen, als er sah wie das Mädchen ihn anstarrte, unzweifelhaft echt gewesen sei; Penelope war ebenso fest überzeugt, daß die Neugierde des Mädchens, als sie sich nach Herrn Franklin erkundigte, echt gewesen sei. Unsere in dieser Weise geführte Unterhaltung war recht ermüdend, bis meine Tochter derselben auf einmal dadurch ein Ende machte, daß sie eine nach meiner Ansicht ganz Ungeheuerliche Vermuthung aussprach.
»Vater,« sagte Penelope ernsthaft, »es giebt nur eine Erklärung für die Sache Rosanna hat sich beim ersten Anblick in Herrn Franklin Blake verliebt.« Daß junge Mädchen sich beim ersten Anblick eines Mannes sterblich in denselben verlieben, ist nichts unerhörtes. Aber ein Hausmädchen aus einer Besserungs-Anstalt, mit einem häßlichen Gesicht und einer verwachsenen Schulter, das sich beim ersten Anblick in einen Herrn verliebt, der in das Haus ihrer Herein kommt, um dieser einen Besuch abzustatten, —— etwas so Absurdes würde Einer doch in allen Erzählungen der gesamten Christenheit vergebens suchen. Ich lachte, daß mir die Thränen über die Backen herabliefen. Penelope schien meine Heiterkeit merkwürdig unangenehm zn berühren. »Ich habe nie gewußt, daß Du so grausam sein könntest, Vater,« sagte sie mit sanfter Stimme und ging hinaus. Diese Worte meiner Tochter wirkten auf mich, wie wenn mich Jemand mit kaltem Wasser übergossen hätte. Ich war angehalten über mich selber, daß mich ihre Worte in dem Augenblick, wo sie sie ausgesprochen, so unangenehm berührt hatten —— aber es war einmal so. Ich denke, meine Leser werden nichts dagegen haben, wenn ich diesen Gegenstand wieder verlasse. Ich bedaure, daß ich mich habe hinreißen lassen, überhaupt auf denselben einzugehen, und das nicht ohne Grund, wie meine Leser bald sehen werden.
Der Mittag kam heran, und die Mittagsglocke erklang, bevor Herr Franklin von Frizinghall zurückgekehrt war. Ich brachte das warme Wasser, das ihm bei seiner Toilette vor Tisch dienen sollte, selbst auf sein Zimmer, in der Erwartung, von ihm zu hören, was die auffallende Verzögerung seiner Rückkehr verursacht habe. Zu meiner größten Enttäuschung (und ohne Zweifel auch zur Enttäuschung meiner Leser) war nichts Besonderes vorgefallen. Er war weder auf dem Hin-, noch auf dem Rückwege den Indiern begegnet. Er hatte den Mondstein in der Bank deponirt, indem er denselben nur als einen sehr kostbaren Gegenstand bezeichnete, und hatte den Empfangschein dafür unversehrt in der Tasche. Ich ging wieder hinunter, in dem Gefühl, daß dies ein ziemlich flauer Abschluß all’ unserer Aufregung vom Vormittage in Betreff des Diamanten sei.
Ueber das Wiedersehen Herrn Franklins mit seiner Tante und seiner Nichte kann ich nichts sagen.
Ich hätte viel darum gegeben, an jenem Tage bei Tische aufwarten zu dürfen. Aber in meiner Stellung im Hause bei großen Festlichkeiten bei Tisch aufwarten, hätte meine Würde in den Augen der übrigen Dienstboten herabsetzen geheißen, und zu einer solchen Herabsetzung fand mich Mylady schon ohnedies nur zu geneigt. Die Nachrichten, die an jenem Abend aus den oberen Regionen zu mir gelangten, erhielt ich durch Penelope und den Diener. Penelope bemerkte, daß sie Fräulein Rachel nie so eigen aus ihre Frisur und nie so hübsch und freundlich gesehen habe, als da sie an jenem Tage in das Wohnzimmer trat, um Herrn Franklin zu en1pfangen. Der Diener berichten, daß ihm in seinem ganzen Dienst noch nie zwei so schwer zu vereinbarende Dinge vorgekommen seien, wie die Beobachtung einer ehrfurchtsvollen Haltung in Gegenwart seiner Herrschaft und die Bedienung Herrn Franklin Blake’s bei Tische. Später am Abend spielten und sangen sie Duette, Herr Franklin mit hoher, Fräulein Rachel mit noch höherer Stimme. Mylady begleitete sie am Clavier und folgte ihnen so zu sagen über Stock und Stein und brachte sie in einer Weise glücklich ans Ziel, die auf der Terrasse durch das geöffnete Fenster höchst lieblich anzuhören war. Noch später ging ich ins Rauchzimmer, wo Herr Franklin mit seinem Sodawasser und Cognac vor sich saß, und wie ich fand durch Fräulein Rachel von seinem Gedanken an den Diamanten völlig abgebracht war. »Sie ist das reizendste Mädchen, das ich gesehen habe, seit ich nach England zurückgekehrt bin,« war Alles, was aus ihm herauszubringen war, als ich es versuchte, die Unterhaltung auf ernstere Gegenstände zu lenken.
Gegen Mitternacht ging ich, begleitet von meinem Adjutanten (dem Diener Samuel) wie gewöhnlich durch das Haus, um die Thüren zu verschließen. Als so alle Thüren, mit Ausnahme der auf die Terrasse führenden Seitenthür, geschlossen waren, schickte ich Samuel zu Bett und ging hinaus, um noch etwas frische Luft zu schöpfen, bevor ich selbst zu Bette ging. Die Nacht war still und der Mond stand voll am Himmel. Es war draußen so ruhig, daß ich von Zeit zu Zeit ganz schwach und leise das Rauschen des Meeres hörte, wie sich die Wellen über die Sandbank an der Mündung unserer kleinen Bucht ergossen. Nach der Lage des Hauses war die Seite nach der Terrasse hin im tiefen Schatten, aber das volle Mondlicht fiel auf den Kiesweg, der dicht neben der Terrasse hinführte. Als ich auf diesem Weg hinaus sah, nachdem ich zuvor zum Himmel hinaufgeblickt hatte, bemerkte ich den Schatten einer Person, der von der Ecke der hinteren Seite des Hauses her durch das Mondlicht geworfen wurde. Alt und schlau wie ich bin, hütete ich mich wohl zu rufen, da ich aber auch leider alt und schwerfällig bin, so verriethen mich meine Fußtritte auf dem Kies. Bevor ich mich, wie ich es beabsichtigte, rasch um die Ecke hatte stehlen kennen, hörte ich leisere Fußtritte als die meinigen, und wie mir vorkam von mehr als Einem Paar Füßen, sich eilig entfernen. In dem Augenblick wo ich die Ecke erreicht hatte, waren die Eindringlinge, wer sie auch gewesen sein mochten, ins Gebüsch an der anderen Seite des Weges gelaufen und wurden durch die dort stehenden dicken Bäume und Büsche Verdeckt. Aus dem Gebüsch konnten sie leicht über unser Stacket auf die Landstraße gelangen. Wenn ich vierzig Jahre jünger gewesen wäre, wäre es mir vielleicht gelungen, sie zu fassen, bevor sie unsern Grund und Boden verlassen hätten. So aber ging ich zurück, um ein Paar jüngere Beine als die meinigen in Bewegung zu setzen. Ohne irgend Jemand zu stören, nahmen Samuel und ich ein Paar Gewehre und durchsuchten die Umgebungen des Hauses und das Gebüsch. Nachdem wir uns vergewissert hatten, daß kein Mensch sich mehr auf unserm Grund und Boden herumtreibe, kehrten wir zurück. Als wir wieder über den Weg kamen, aus dem ich den Schatten gesehen hatte, bemerkte ich jetzt zum ersten Male einen kleinen, auf dem reinlichen Kies liegenden, im Mondlicht glänzenden Gegenstand. Ich nahm denselben auf und fand, daß es eine kleine Flasche war, welche eine dicke, süßriechende und tintenschwarze Flüssikeit enthielt.
Ich sagte Samuel nichts davon. Aber dessen eingedenk, was Penelope mir über die Jongleurs erzählt, wie sie Tinte in die hohle Hand des Knaben gegossen hatten, argwöhnte ich auf der Stelle, daß ich die drei Indier nächtlicher Weile um das Haus herumlungerd, bei der Ausführung ihres heidnischen Planes, den Diamanten ausfindig zu machen, aufgestört hatte.

Achtes Capitel.
Hier finde ich es nöthig, einen Augenblick in meiner Erzählung inne zu halten.
Meine eigenen Erinnerungen und Penelopes Tagebuch, das ich zu Rathe gezogen habe, machen es zulässig, über die Zeit zwischen Herrn Franklin Blakes Ankunft und Fräulein Rachels Geburtstag rasch hinwegzugehen. Denn während dieser Zeit gingen die Tage meistentheils ohne bemerkenswerthe Ereignisse vorüber.
Mit der gütigen Erlaubniß des Lesers werde ich also hier unter Penelopes Beihilfe nur einige Daten verzeichnen; und behalte mir die Wiederaufnahme der tageweisen Erzählung der Geschichte bis zu dem Zeitpunkte vor, wo die Mondstein-Affaire die wichtigste Angelegenheit für Jedermann in unserem Hause wurde.
Nachdem ich das vorangeschickt habe, können wir jetzt wieder fortfahren, indem wir zunächst auf die Flasche mit süßriechender Tinte, die ich in jener Nacht aus dem Kieswege fand, zurückkommen.
Am nächsten Morgen (den 26.) zeigte ich dieses Jongleurding Herrn Franklin und erzählte» ihm davon, was dem Leser bereits bekannt ist. Nach seiner Meinung hatten die Indier es bei ihrem Herumtreiben nicht nur auf den Diamanten abgesehen, sondern waren wirklich thörigt genug, an ihren eigenen Zauber zu glauben, womit er das Bestreichen des Kopfes und das Ausgießen der Tinte in der Hand des Knaben meinte, welches diesen befähigen sollte, Dinge und Personen zu sehen, die für ein gewöhnliches Auge nicht sichtbar seien. Herr Franklin belehrte mich, daß es nicht nur im Orient, sondern auch in unserem eigenen Lande Leute gebe, die diesen sonderbaren Hokuspokus (wenn auch ohne die Tinte) treiben und denselben mit einem französischen Namen bezeichnen, der ungefähr so viel bedeutet wie Hellseherei.
»Ganz gewiß,« sagte Herr Franklin, »rechneten die Indier fest darauf, daß wir den Diamanten hier behalten würden, und brachten darum den clairvoyanten Jungen her, damit er ihnen die Stelle zeige, wo der Diamant liege, für den Fall, daß es ihnen in voriger Nacht gelingen sollte, sich in das Haus zu schleichen.«
»Glauben Sie, Herr Franklin,« fragte ich, »daß die Kerle die Sache noch einmal versuchen werden?«
»Das,« erwiderte Herr Franklin, »hängt von dem Grade der Hellsichtigkeit des Jungen ab. Wenn er den Diamanten durch den eisernen Schrank der Bank von Frizinghall hindurch sehen kann, so werden uns die Indier zunächst mit ihrem Besuche nicht mehr incommodiren. Wenn er das nicht kann, so werden wir bald genug wieder eine Chance haben, ihrer im Gebüsch habhaft zu werden.«
Ich sah dieser Chance ziemlich zuversichtlich entgegen, aber merkwürdiger Weise trat sie nie ein.
Ob die Jongleurs in der Stadt erfahren hatten, daß Herr Franklin in der Stadt gewesen sei und demgemäß ihre Schlüsse gezogen hatten, oder ob der Junge wirklich den Diamanten an seinem jetzigen Platze gesehen (woran ich aber ein- für allemal nicht glaube), oder ob es wirklich nur ein reiner Zufall war —— so viel ist gewiß, von den Indiern zeigte sich während der Wochen, die bis zu Fräulein Rachels Geburtstag vergingen, keine Spur wieder bei dem Hause. Die Jongleurs trieben ihre Taschenspielerkünste in und um die Stadt ungestört fort, und Herr Franklin und ich warteten die Entwickelung der Dinge ruhig ab, entschlossen, die Spitzbuben nicht etwa dadurch behutsam zu machen, daß wir sie unsern Argwohn zu bald merken ließen. Das ist Alles, was ich für den Augenblick über die Indier zu sagen habe.
Am 29. des Monats erfanden Fräulein Rachel und Herr Franklin ein neues Mittel, sich die Zeit, die sonst schwer auf ihnen gelastet haben würde, gemeinschaftlich zu vertreiben. Ich habe meine Gründe, schon jetzt von der Beschäftigung, mit der sie sich unterhielten, besondere Notiz zu nehmen. Der Leser wird finden, daß dieselbe mit künftigen Dingen eng zusammenhängt.
Vornehmen Leuten steht gewöhnlich im Leben ihre eigene Trägheit im Wege. Indem sie ihr Leben meistentheils damit zubringen, sich nach einer Beschäftigung umzusehen, gerathen sie nur zu oft, besonders wenn ihre Neigungen, wie sie es nennen, geistiger Natur sind, blindlings auf Abwege. In den meisten Fällen mißhandeln oder verderben sie Etwas, und glauben Etwas für ihre Bildung zu thun, während sie in Wahrheit nur Unheil im Hause anstiften. Ich habe, wie ich leider bekennen muß, sowohl Damen wie Herren Tag für Tag mit leeren Pillendosen ausgehen sehen, die sie mit Eidechsen, Käfern, Spinnen und Fröschen gefüllt nach Hause brachten, um dann die armen Bestien auf Nadeln zu spießen oder ohne Spur von Gewissensbissen in Stücke zu zerschneiden. Da sieht man die jungen Herren oder das Fräulein mit einem Vergrößerungsglas ihre Spinnen betrachten, oder begegnet einem ihrer Frösche ohne Kopf auf der Treppe, und wenn man fragt, was die grausame Quälerei zu bedeuten habe, so wird Einem gesagt, daß es eine naturwissenschaftliche Liebhaberei des jungen Herrn oder des Fräuleins bedeute. Wieder ein anderes Mal beschäftigen sie sich stundenlang damit, eine hübsche Blume mit spitzen Instrumenten zu zerpflücken, nur aus dummer Neugierde, zu erfahren, woraus die Blume gemacht ist. Wird etwa die Farbe der Blume dadurch schöner, oder ihr Geruch angenehmer, daß sie das erfahren? Aber die armen Menschen müssen ja ihre Zeit hinbringen. Als Kinder haben sie in häßlichem Schmutze herumgewühlt und Puddings aus Erde gemacht, und wenn sie erwachsen sind, wühlen sie in häßlicher Wissenschaft herum und seciren Spinnen und zerpflücken Blumen. In dem einen Fall wie in dem andern erklärt sich die Sache daraus, daß sie in ihrem armen, leeren Kopf nichts zu denken, und mit ihren armen, trägen Händen nichts zu thun haben. Und so kommen sie endlich dahin, Leinewand mit Farben zu verschmieren und einen übeln Geruch in’s Haus zu bringen, oder Kaulquappen in einem Glaskasten mit schmutzigem Wasser aufzubewahren, bei deren Anblick sich Einem das Herz im Leibe herumdreht, oder überall Stückchen Stein abzuhauen und dabei alle Lebensmittel im Hause mit Sand zu versetzen, oder sich die Finger beim Photographiren zu beschmutzen und erbarmungslos Jedem im Hause sein Gesicht abzunehmen. Für die, welche gezwungen sind, sich ihr Brod zu verdienen, ist es gewiß oft hart genug, für ihre Kleider, ihre Wohnung und ihre Nahrung arbeiten zu müssen. Aber wenn solche Leute ihr härtestes Tagewerk mit der Arbeit der Müßiggänger vergleichen, welche Blumen zerpflücken und Spinnenmagen durchbohren, so können sie ihrem Schöpfer noch danken, daß sie Etwas im Kopfe und in den Händen haben, woran sie denken und womit sie arbeiten müssen. Was nun Herrn Franklin und Fräulein Rachel anlangt, so mißhandelten sie, wie ich mit Vergnügen melden kann, Nichts. Sie beschränkten sich vielmehr daraus, Etwas zu verderben, und Alles, was sie verdarben, war die Füllung einer Thür.
Herr Franklin, der sich als Universalgenie mit Allem befaßte, trieb auch, wie er es nannte, Decorationsmalerei. Er hatte, wie er uns erzählte, eine neue Mischung zur Anfeuchtung der Farben erfunden, welche er als ein vorzügliches Bindemittel beschrieb. Woraus dasselbe bestand, weiß ich nicht. Was es bewirkte, kann ich mit zwei Worten sagen: es stank. Da Fräulein Rachel vor Begierde brannte, sich in der neuen Procedur zu versuchen, ließ Herr Franklin die Materialien dazu von London kommen, mischte sie und verbreitete damit einen Geruch im Hause, der selbst die Hunde zum Niesen brachte, band Fräulein Rachel eine Schürze mit einem Latz vor und etablirte sie zu einer Decorirung ihres eigenen kleinen Wohnzimmers, das in Ermangelung eines bezeichnenden englischen Ausdrucks ein »budoir« genannt wurde. Mit der inneren Seite der Thür fingen sie an. Herr Franklin kratzte allen schönen Firniß mit Bimstein ab und präparirte auf diese Weise eine Fläche, wie sie nach seiner Behauptung zur Bearbeitung nöthig war. Fräulein Rachel bedeckte dann diese Fläche unter seiner Leitung und mit seiner Hilfe mit Mustern und Sinnbildern, Greifen, Vögeln, Blumen, Amoretten und dergleichen mehr —- Alles nach Zeichnungen eines berühmten italienischen Malers, ich kann nicht auf den Namen kommen —— ich meine den, der die Welt mit Jungfrau-Marien versorgt hat und ein Bäckermädchen zum Liebchen hatte. Als Beschäftigung betrachtet, war dieses Decoriren ein langweiliges und schmutziges Stück Arbeit. Aber unser junger Herr und unser Fräulein schienen seiner nie überdrüssig zu werden. Wenn sie nicht ausritten oder Gesellschaft bei sich hatten, oder ihre Mahlzeiten einnahmen, oder ihre Musik machten, saßen sie Kopf an Kopf, emsig wie die Bienen, vor der Thür und verschmierten sie. Wer war doch noch der Dichter, der gesagt hat, daß Satan auch durch unbeschäftigte Hände Unheil anzustiften weiß? Hätte er meine Stelle im Hause eingenommen und Fräulein Rachel mit ihrem großen Pinsel und Herrn Franklin mit seinem Bindemittel gesehen, so hätte er über Beide nichts Passenderes sagen können.
Der nächste erwähnenswerthe Tag war der 1. Juni, ein Sonntag. An dem Abend dieses Tages discutirten wir im Domestikenzimmer eine häusliche Frage, die, wie das Decoriren der Thür mit etwas später zu Erzählendem im Zusammenhang steht.
Da wir sahen, welches Vergnügen Herr Franklin und Fräulein Rachel gegenseitig in ihrer Gesellschaft fanden und übereinkamem daß sie in jeder Hinsicht ein allerliebstes Paar bilden würden, so hielten wir es natürlich für möglich, daß sie noch zu anderen Zwecken als zu dem der Decorirung der Thür die Köpfe zusammensteckten. Einige von uns behaupteten, noch vor Ende des Sommers werde es eine Hochzeit in unserem Hause geben. Andere (deren Wortführer ich war) gaben zwar zu, daß Fräulein Rachel sich wahrscheinlich verheirathen werde, zweifelten aber aus Gründen, die ich gleich angeben will, daß Herr Franklin Blake der Erwählte sein werde. Daß Herr Franklin verliebt sei, konnte Niemand, der ihn sah und hörte, bezweifeln; schwieriger war es, Fräulein Rachel zu ergründen. Der Leser möge mir gestatten, ihn mit ihr bekannt zu machen, er mag sie dann, wenn er kann, selber ergründen.
Der achtzehnte Geburtstag meines jungen Fräuleins stand vor der Thür, es war am 21. Juni. Wenn mein geneigter Leser ein Freund von schwarzem Haar ist (das, wie ich mir habe sagen lassen, neuestens in der feinen Welt aus der Mode gekommen ist), und wenn er kein besonderes Vorurtheil zu Gunsten großer Gestalten hat, so brauche ich keinen Widerspruch zu befürchten, wenn ich ihn versichere, daß Fräulein Rachel eines der hübschesten Mädchen war, das man sehen konnte. Sie war klein und schmächtig, aber vom Scheitel bis zur Zehe ganz proportionirt. Zu sehen, wie sie sich hinsetzte, wie sie aufstand, und namentlich wie sie ging, war genug, um sich zu überzeugen, daß die Grazie ihrer Erscheinung (wenn man mir den Ausdruck gestatten will) in ihrem Körper und nicht in ihren Kleidern lag. Sie hatte das schwärzeste Haar das ich je gesehen habe. Ihre Augen wetteiferten mit ihrem Haar. Ihre Nase war zwar, wie ich zugeben muß, etwas zu klein. Ihr Mund und ihr Kinn waren, um Herrn Franklins eigne Ausdrücke zu gebrauchen, Bissen für die Götter und ihr Teint war nach derselben unwidersprechlichen Autorität so warm, wie die Sonne selbst, mit dem großen Vorzug vor der Sonne, daß man ihn immer mit Vergnügen ansehen konnte. Nimmt man dazu, daß sie ihren Kopf so gerade trug, wie einen Pfeil im Köcher, wie es einem so lebhaften Wesen von so edler Abkunft ansteht, daß sie eine klare Stimme von echtem Metallklang hatte und ein Lächeln, daß sich höchst reizend schon in ihren Augen zeigte, noch ehe es die Lippen erreichte, so hat man ihr Portrait in Lebensgröße nach meinen besten Kräften gemalt vor sich.
Und was soll ich von ihrem Charakter sagen? Hatte dieses reizende Geschöpf keine Fehler? Sie hatte grade so viele Fehler wie Du, geneigte Leserin, nicht mehr und nicht weniger. Im Ernst hatte mein liebes, hübsches Fräulein Rachel bei einer Fülle von Reizen und anziehenden Eigenschaften einen Fehler, den strenge Unparteilichkeit mich zu nennen zwingt. Sie war den meisten jungen Mädchen ihres Alters darin Unähnlich, daß sie ihre eigenen Ideen hatte und sich halsstarrig selbst der Mode widersetzte, wenn diese ihr nicht zusagte. In Kleinigkeiten konnte man sich diese ihre Unabhängigkeit wohl gefallen lassen, aber in wichtigen Dingen ging sie, wie Mylady fand und wie es auch mir schien, darin zu weit. Sie bildete sich ihr eigenes Urtheil, wie es wenige viel ältere Frauen thun, fragte nie Jemanden um Rath, sagte Niemandem vorher, was sie zu thun beabsichtige, und hatte niemals Jemandem Geheimnisse anzuvertrauen, nicht einmal ihrer Mutter. In kleinen und großen Dingen, im Verkehr mit Leuten, die sie liebte und Leuten, die sie haßte (und sie that Beides mit gleicher Energie), ging Fräulein Rachel immer ihren eigenen Weg und war sich in Freud und Leid selbst genug. Unzählige Male habe ich Mylady sagen hören: »Rachel’s bester Freund und Rachels schlimmster Feind ist Beides in Einer Person Rachel selbst.« Noch ein Wort und ich bin mit ihrer Charakteristik fertig.
Bei all’ ihrer Verschlossenheit und all’ ihrem Eigenwillen war doch keine Spur von Falsch an ihr. Ich erinnere mich nicht, daß sie jemals ihr Wort gebrochen oder daß sie jemals Nein gesagt und Ja gemeint hätte. Dagegen erinnere ich mich aus ihrer Kindheit mehr als eines Falls, wo das liebe kleine Wesen sich für ein Vergehen, das ein von ihr geliebter Gespiele begangen hatte, schelten und bestrafen ließ. Niemals widersprach sie einer Beschuldigung, wenn sie angeklagt wurde, aber ebenso wenig sagte sie je die Unwahrheit. Sie sah Einem grade ins Gesicht schüttelte ihr trotziges Köpfchen und sagte einfach: »Ich will es nicht sagen!« Wenn sie für diesen Trotz aufs Neue bestraft wurde, so erklärte sie allenfalls, sie wolle nicht wieder »ich will nicht« sagen, aber war auch mit Brot und Wasser nicht dahin zu bringen, den Schuldigen zu nennen. Eigenwillig war sie —— verteufelt eigensinnig bisweilen —— das muß ich zugeben, aber nichtsdestoweniger das lieblichste Geschöpf, das jemals auf dieser Erde wandelte. Vielleicht findet der Leser, daß ich mir hier widerspreche. Für diesen Fall will ich ihm ein Wort in’s Ohr sagen. Mein lieber Leser, beobachte einmal Deine Frau scharf während der nächsten 24 Stunden. Wenn Dein liebes Weib während dieser Zeit nicht durch irgend ein Wort oder eine Handlung mit sich selbst in Widerspruch tritt, so sei Dir der Himmel gnädig, denn dann hast Du ein Ungeheuer geheirathet.
Ich habe also jetzt den Leser mit Fräulein Rachel bekannt gemacht und wir können uns nun ohne Weiteres mit ihren Heiraths-Aspecten beschäftigen.
Am 12. Juni schickte Mylady einem Herrn in London eine Einladung, sie zu besuchen und Fräulein Rachel’s Geburtstag mit feiern zu helfen. Das war der glückliche Sterbliche, dem sie, wie ich glaubte, in Wahrheit ihr Herz zugewandt hatte! Wie Herr Franklin war auch er ihr Vetter. Er hieß Godfrey Ablewhite.
Myladys zweite Schwester (nur keine Sorge, für diesmal lasse ich mich nicht weiter auf Familienverhältinisse ein), Myladys zweite Schwester, sage ich, hatte eine unglückliche Liebe gehabt und nachher Hals über Kopf, was man eine Mesalliance nennt, gemacht. Es entstand ein furchtbarer Aufruhr in der Familie, als das adlige Fräulein Caroline darauf bestand, einen Banquier aus Frizinghall, den simpeln Herrn Ablewhite zu heirathen. Er war sehr reich, hatte einen sehr guten Charakter und wurde der Vater einer äußerst zahlreichen Familie, —— soweit war Alles gut. Aber er hatte sich herausgenommen, sich aus einer niedrigen Stellung in der Welt heraufzuarbeiten, —— und das war gegen ihn. Indessen brachten die Zeit und die Fortschritte moderner Aufklärung Alles wieder in Ordnung, und die Mesalliance wurde zu Gnaden angenommen. Heutigen Tages werden wir Alle Liberale, und wenn Einer, dem ich die Hand gewaschen, sie mir wieder wäscht, was kümmert’s mich, ob er ein Gassenkehrer oder ein Herzog ist? Das ist die moderne Art, die Dinge anzusehen, und ich halte es mit dieser modernen Art. Die Ablewhites wohnten auf einem schönen Landsitz in der Nähe von Frizinghall. Sehr würdige Leute und hochgeachtet in der ganzen Gegend. Ich habe aber nicht die Absicht, viel über dieselben zu sagen, mit einziger Ausnahme. von Herrn Godfrey, der Herrn Ablewhite’s zweiter Sohn war, und mit dem wir uns hier, mit der gütigen Erlaubniß des Lesers, Fräulein Rachel’s wegen, etwas näher beschäftigen müssen. Trotz Herrn Franklin’s hellem Verstand, trotz seiner Gewandtheit und trotz aller seiner übrigen guten Eigenschaften, schienen mir doch seine Aussichten, Herrn Godfrey in der Neigung unseres jungen Fräuleins den Rang abzulaufen, ungemein schwach zu sein.
Erstens war Herr Godfrey, was den Wuchs betraf, bei Weitem der schönere von beiden Männern, er maß über sechs Fuß, hatte einen schönen roth und weißen Teint, ein glatt rasirtes, rundes Gesicht, und den Kopf voll schöner, langer, blonder Haare, die nachlässig auf den Nacken herabfielen. Aber warum versuche ich es, hier eine Schilderung von seiner Person zu geben? Wenn meine Leser jemals zu irgend einem mildthätigen Unternehmen einer Dame in London einen Beitrag gezeichnet haben, so müssen sie Herrn Godfrey Ablewhite so gut wie ich kennen. Er war seinem Berufe nach ein Advocat, seinem Temperament nach ein Mann für die Damen, und aus Neigung ein barmherziger Samariter. Weibliches Wohlwollen und weibliches Elend konnten nichts ohne ihn unternehmen. Bei mütterlichen Gesellschaften für die Aufnahme armer Wöchnerinnen bei Magdalenen-Stiften für die Rettung gefallener Mädchen, bei Emancipations-Vereinen, welche arme Frauen an die Stelle armer Männer setzen und es den Letztern überlassen möchten, sich selbst zu helfen —— bei allen solchen Vereinen war er Vicepräsident, Secretär oder Kassirer. Wo immer ein Damen-Comitée um einen Tisch versammelt saß, fiel Herrn Godfrey unfehlbar die Ausgabe zu, das Comitée bei guter Laune zu erhalten, und die lieben Damen auf dem dornigen Wege geschäftlicher Berathung zu leiten. Ich glaube, er war der vollkommenste Philantrop unter beschränkten Verhältnissen, den England je hervorgebracht. Es möchte schwer sein, einen Redner zu finden, der es so wie er verstanden hätte, bei Wohlthätigkeits-Versammlungen den Leuten Thränen und Geld zu entlocken. Man konnte ihn als einen öffentlichen Charakter bezeichnen. Als ich das letzte Mal in London war, verdankte ich Myladty’s Güte große Vergnügungen. Sie ließ mich ins Theater gehen, um eine Tänzerin zu sehen, die großes Aufsehen machte, und sie schickte mich nach Excter Hall, um Herrn Godfrey zu hören. Die Dame brauchte zu ihrem Tanzen ein Orchester, der Herr zu seiner Rede ein Schnupftuch und ein Glas Wasser. Ungeheurer Zudrang bei der Vorstellung mit den Beinen, ditto bei der Vorstellung mit der Zunge. Und bei alledem war er (ich meine Herrn Godfrey) von dem angenehmsten Temperament, der einfachste, liebenswürdigste und leichtlebigste Mensch, den es geben konnte. Er liebte alle Menschen, und alle Menschen liebten ihn; welche Chancen konnte wohl Herr Franklin, welche Chancen konnte irgend Jemand von gewöhnlichem Ruf und gewöhnlichen Fähigkeiten gegen einen solchen haben?
Am vierzehnten traf Herrn Godfrey’s Antwort ein.
Er nahm Mylady’s Einladung für die Tage vom Mittwoch, dem Geburtstage, bis zum Freitag Abend an, wo ihn seine Pflichten gegen mildthätige Damen nöthigen würden, wieder in London zu sein. Er übersandte zugleich ein Gedicht auf das »Wiegenfest« seiner Cousine, wie er sich elegant ausdrückte. Fräulein Rachel machte sich, wie ich erfuhr, bei Tisch mit Herrn Franklin über die Verse lustig, und Penelope, die entschieden Partei für diesen Letzteren genommen hatte, fragte mich mit triumphirender Miene, was ich davon denke. »Fräulein Rachel,« antwortete ich, »hat Dich auf eine falsche Fährte geführt, ich lasse mich aber nicht so leicht irre leiten. Watte nur bis Herr Ablewhite in Person seinen Versen auf dem Fuße folgt.« Meine Tochter erwiderte, Herr Franklin werde vielleicht sein Glück schon mit Erfolg versucht haben, noch ehe der Dichter seinen Versen folge. Zu Gunsten dieser Ansicht sprach, wie ich zugeben muß, daß Herr Franklin kein Mittel unversucht ließ, Fräulein Rachel’s Neigung zu gewinnen.
Obgleich er einer, der eingefleischtesten Raucher war, der mir je vorgekommen ist, gab er sofort das Rauchen auf, als sie eines Tages geäußert hatte, daß sie den Tabaksgeruch in seinen Kleidern nicht leiden könne. Er schlief in Folge dieses Aufgebots von Selbstverleugnung, in Ermangelung der beruhigenden Wirkung des Tabaks, an die er gewöhnt war, so schlecht und sah Morgens, wenn er hinunter kam, so elend und übermüde aus, daß Fräulein Rachel selbst ihn bat seine Gewohnheit des Rauchens wieder aufzunehmen. Aber nein! er wollte nichts thun, was ihr nur im Mindesten unangenehm wäre, er wollte entschlossen dagegen ankämpfen und erklärte, er werde seinen Schlaf schon früher oder später durch geduldiges Abwarten wiedererlangen.
Eine solche Hingebung, wird man vielleicht sagen (wie Einige in den unteren Regionen des Hauses auch thaten), konnte in Verbindung mit der täglichen Dekorations-Arbeit an der Thür unmöglich ihre rechte Wirkung auf Fräulein Rachel verfehlen. Das mochte sein, aber sie hatte in ihrem Schlafzimmer eine Photographie von Herrn Godfrey, die ihn darstellte, wie er sich bei einer öffentlichen Versammlung durch seine eigene Beredtsamkeit athemlos gemacht hatte und mit seinen höchst freundlichen Augen den Leuten das Geld aus der Tasche Zauberte.
Was sagen meine Leser dazu? Jeden Morgen, wenn meine Tochter Fräulein Rachel das Haar machte, sah, wie Penelope mir selbst gestanden hat, der Mann, den die Damen nicht entbehren konnten, im Bilde zu. Nach meiner Ueberzeugung sollte er bald die Stelle des Bildes einnehmen und in leibhaftiger Gestalt zusehen.
Der sechszehnte Juni führte ein Ereigniß mit sich, welches nach meiner Meinung Herrn Franklin’s Chancen noch geringer machte, als sie schon zuvor waren.
Ein sonderbarer Herr, der mit einem ausländischen Accente Englisch sprach, verlangte an jenem Morgen Herrn Franklin Blake in Geschäften zu sprechen. Das Geschäft konnte unmöglich etwas mit dem Diamanten zu thun haben, und zwar aus folgenden beiden Gründen: erstens, weil Herr Franklin mir nichts darüber mittheilte, und zweitens, weil er dagegen, nachdem der fremde Herr fortgegangen war, statt meiner Mylady eine Mittheilung darüber machte. Wahrscheinlich äußerte sie dann Etwas darüber gegen ihre Tochter. Wenigstens soll Fräulein Rachel an jenem Abend am Clavier Herrn Franklin harte Dinge über die Leute, unter denen er im Auslande gelebt und die Principien, die er daselbst angenommen, gesagt haben. Am nächsten Tage wurde zum ersten Male das Decoriren der Thür eingestellt.
Ich argwöhne, daß Herr Franklin an den Folgen einer auf dem Continent begangenen Unvorsichtigkeit mit Frauen oder einer dort contrahirten Schuld laborirte. Aber ich muß mich dabei aus Vermuthungen beschränken. Bei dieser Gelegenheit ließ mich nicht nur Herr Franklin, sondern merkwürdiger Weise auch Mylady im Dunkeln.
Am siebzehnten verzog sich allem Anscheine nach die Wolke wieder. Sie nahmen ihre Decorations-Arbeit an der Thür wieder auf und schienen wieder so gute Freunde zu sein, wie zuvor. Wenn man Penelope glauben durfte, so hatte Herr Franklin die Gelegenheit seiner Versöhnung mit Fräulein Rachel ergriffen, ihr einen Antrag zu machen den sie weder angenommen noch abgelehnt habe. Meine Tochter hielt sich durch gewisse Anzeichen, mit denen ich den Leser nicht zu behelligen brauche, fest überzeugt, daß ihre junge Herrin Herrn Franklin mit der Erklärung habe ablaufen lassen, daß sie nicht an den Ernst seines Antrags glaube und dann im Geheimen ihr Benehmen gegen, ihn bereut habe. Obgleich Penelope mit ihrem Fräulein auf vertrauterem Fuße stand, als Kammermädchen sonst mit ihren Damen zu stehen pflegen —— denn die Beiden waren fast wie Geschwister zusammen auferzogen —— so kannte ich doch Fräulein Rachel’s reservirtes Wesen zu gut, um zu glauben, daß sie irgend Jemandem ihre wahre Gesinnung würde verrathen haben. Was meine Tochter mir bei dieser Gelegenheit erzählte, war, wie ich vermuthet hatte, mehr was sie wünschte, als was sie wirklich wußte.
Am neunzehnten trug sich ein anderes Ereigniß zu. Wir hatten den Arzt im Hause. Er war gerufen, um einer Person, mit der ich den Leser bereits bekannt gemacht habe: unserem zweiten Hausmädchen Rosanna Spearman, etwas zu verschreiben. Dieses arme Mädchen, das mich bereits, wie sich der Leser erinnert, bei dem Zitterstrande in Verlegenheit gesetzt hatte, bereitete mir in der Zeit, von der ich jetzt rede, verschiedene Male neue Verlegenheiten. Penelope’s Idee, daß das Hausmädchen in Herrn Franklin verliebt sei (welche meine Tochter auf meinen Befehl ganz für sich behielt), schien mir noch immer eben so absurd, wie zu Anfang. Aber ich muß gestehen, daß Alles, was ich selbst und meine Tochter von dem Benehmen unseres zweiten Hausmädchens sahen, gelinde zu sagen, mysteriös zu werden anfing. So zum Beispiel trat das Mädchen Herrn Franklin beständig in den Weg, zwar sehr ruhig und vorsichtig, aber sie that es doch. Er nahm ungefähr so viel Notiz von ihr, wie von einer Fliege: niemals schien er auch nur einen Blick für Rosanna’s häßliches Gesicht übrig zu haben. Der Appetit des armen Geschöpfes, der nie groß war; nahm in erschreckender Weise ab und ihre Augen zeigten Morgens deutliche Spuren einer durchwachten und durch weinten Nacht. Eines Tages machte Penelope eine sonderbare Entdeckung welche wir aus der Stelle vertuschten. Sie ertappte Rosanna dabei, wie sie von Herrn Franklin’s Toilettetisch eine Rose, welche Fräulein Rachel ihm gegeben hatte, um sie im Knopfloche zu tragen, wegnahm und eine andere Rose, die sie selbst gepflückt hatte, dafür hinlegte. Nachdem war sie ein- oder zweimal impertinent gegen mich, als ich ihr einen wohlgemeinten Wink gab, vorsichtig in ihrem Betragen zu sein, und, was noch schlimmer, sie zeigte sich bei den wenigen Gelegenheiten, wo Fräulein Rachel mit ihr sprach, nicht besonders respectvoll.
Mylay, bemerkte diese Veränderungen in ihrem Wesen und fragte mich, was ich davon denke. Ich versuchte es, das Mädchen zu entschuldigen, indem ich antwortete, ich glaube, sie sei kränklich, und die Sache endete damit, daß am neunzehnten, wie bereits erwähnt, nach dem Doctor geschickt wurde. Er erklärte sie für nervenleidend und äußerte seine Bedenken, ob sie zum Dienen gemacht sei. Mylady erbot sich, sie zum Zwecke eines Luftwechsels auf einen unserer Pachthöfe im Innern des Landes zu schicken. Sie bat und flehte unter Thränen, bei uns bleiben zu dürfen, und in einer bösen Stunde rieth ich Mylady, es noch eine Zeitlang mit ihr zu versuchen. Wie die Folge lehrte und wie sich der Leser bald überzeugen wird, war das der schlechteste Rath, den ich hätte geben können. Wenn ich nur ein klein wenig in die Zukunft hätte sehen können, so würde ich Rosanna Spearman auf der Stelle mit eigener Hand aus dem Hause gebracht haben.
Am zwanzigsten traf ein Billet von Herrn Godfrey ein. Er hatte seine Reise so eingerichtet, daß er die nächste Nacht in Frizinghall, wo er seinen Vater in Geschäften zu sprechen wünschte, zubringen würde. Am Nachmittage des nächsten Tages würde er mit seinen beiden ältesten Schwestern rechtzeitig zu Tisch bei uns eintreffen. Ein elegantes kleines Schmuckkästchen von Porzellan begleitete das Billet, in welchem ihr Vetter Fräulein Rachel seine besten Glückwünsche aussprach. Herr Franklin hatte ihr nur ein unbedeutendes Medaillon, das nicht halb so viel werth war, geschenkt. Nichtsdestoweniger beharrte meine Tochter Penelope —— so eigensinnig sind die Frauen —— bei ihrer Meinung, daß er den Preis davontragen werde.
Und so sind wir endlich, dem Himmel sei Dank, bei dem Vorabend des Geburtstags angelangt! Der Leser wird mir denk’ ich, das Zeugniß geben, daß ich ihn, dieses Mal ohne mich unterwegs lange aufzuhalten, rasch an’s Ziel geführt habe. Und nun gehe ich getrost zu einem neuen Capitel über, das uns mitten in den Kern unserer Geschichte führen wird.

Neuntes Capitel
Der einundzwanzigste Juni, der Geburtstag, brach trübe und bewölkt an, aber gegen Mittag klärte sich das Wetter auf.
Wir Dienstboten begannen diesen glücklichen Jahrestag wie gewöhnlich damit, Fräulein Rachel unsere kleinen Geschenke mit der üblichen Anrede die ich jährlich als der erste Diener des Hauses hielt, darzubringen. Ich beobachtete dabei das von der Königin in ihren Thronreden befolgte System, indem ich regelmäßig jedes Jahr ungefähr dasselbe sagte. Bevor ich die Rede halte, wird sie wie die der Königin so genau erwogen, als ob noch nie etwas Aehnliches dagewesen wäre. Nachdem sie gehalten worden und es sich zeigt, daß sie der Erwartung des Publicums, etwas Neues zu hören, keineswegs entsprochen hat, wird ein bischen raisonnirt, aber gleich wieder dem nächsten Jahre mit neuen Hoffnungen entgegengesehen Die Menschen sind eben leicht zu lenken, in der Küche wie im Parlament, das ist die Moral von der Sache.
Nach dem Frühstück hielten Herr Franklin und ich eine vertrauliche Berathung in Betreff des Mondsteins, da jetzt die Zeit gekommen war, wo derselbe wieder aus der Bank in Frizinghall genommen und Fräulein Rachel übergeben werden mußte. Ob er sein Glück bei seiner Cousine auf’s Neue versucht hatte und entschieden abgewiesen worden war, oder ob sein Nacht für Nacht gestörter Schlaf die sonderbaren Widersprüche und Unschlüssigkeiten seines Wesens gesteigert hatte, weiß ich nicht. Aber gewiß ist, daß Herr Franklin sich am Morgen des Geburtstags nicht von der besten Seite zeigte. Er äußerte ungefähr zwanzig verschiedene Meinungen in Betreff des Diamanten im Verlauf von ebenso vielen Minuten. Ich meinerseits hielt mich fest an die einfachen Thatsachen, wie sie uns bekannt waren. Es war nichts geschehen, was uns berechtigt hätte, Mylady in dieser Angelegenheit zu beunruhigen, und nichts konnte Herrn Franklin von der ihm jetzt obliegenden rechtlichen Verpflichtung den Edelstein in die Hände seiner Cousine zu legen, befreien.
Das war meine Ansicht von der Sache, und mochte er sich drehen und wenden wie er wollte, er mußte sich schließlich nothgedrungen zu derselben Ansicht bekennen. Wir kamen überein, daß er nach dem zweiten Frühstück nach Frizinghall hinüberreiten und höchst wahrscheinlich in Begleitung von Herrn Godfrey und seiner Schwestern den Diamanten zurückbringen solle.
Nachdem wir uns darüber geeinigt hatten, ging unser junger Herr wieder zu Fräulein Rachel.
Sie brachten den ganzen Morgen und einen Theil des Nachmittags bei der nie endenden Arbeit der Thürdecoration zu; Penelope stand dabei und mischte die Farben nach Vorschrift, und Mylady ging, als die Stunde des zweiten Frühstücks herannahte, ihr Schnupftuch vor der Nase haltend (denn sie verbrauchten an jenem Tage eine gehörige Portion des Bindemittels) im Zimmer aus und ein und versuchte vergebens, die Künstler von ihrer Arbeit abzubringen Es war drei Uhr geworden, bis sie ihre Schürzen abnahmen, Penelope, die sich in Folge des Verkehrs mit dem Bindemittel schlecht befand, entließen und sich vom Farbenschmutz reinigten. Aber sie hatten ihren Zweck erreicht, sie waren am Geburtstage mit der Thür fertig geworden und waren nicht wenig stolz darauf. Die Greifen, Amoretten u. s. w. waren, wie ich bekennen muß, wunderhübsch anzusehen, obgleich sie Einem in ihrer großen Menge, in ihrer Verschlingung mit Blumen und Sinnbildern, in ihren verrenkten Stellungen und Bewegungen noch stundenlang, nack dem man sie sich betrachtet, im Kopfe wehthaten. Wenn ich hinzufüge, daß Penelope ihre Rolle bei der Morgenarbeit damit beschloß, daß sie sich nach der Waschküche begab, so geschieht das keineswegs in unfreundlicher Gesinnung gegen das Bindemittel. Nein, nein! Es hörte auf übel zu riechen, sobald es getrocknet war, und wenn die Kunst solche Opfer fordert, so sage ich, und wenn es auch meine eigene Tochter ist, die darunter leidet, diese Opfer müssen der Kunst gebracht werden.
Herr Franklin ließ sich kaum die Zeit, einen Bissen zu frühstücken und ritt nach Frizinghall, wie er Mylady erzählte, um seine Cousine herzubegleiten in der That aber, wie nur er und ich wußten, um den Diamanten zu holen.
Da an diesem Tage eine der festlichen Gelegenheiten war, bei welchen ich meinen Platz als Chef der bei Tisch aufwartenden Diener vor dem sideboard einnahm, fehlte es mir während Herrn Franklins Abwesenheit nicht an Beschäftigung, die mich vollauf in Anspruch nahm. Nachdem ich für den Wein gesorgt und über die männliche und weibliche Dienerschaft, die bei Tische aufwarten sollte, Musterung gehalten hatte, zog ich mich zurück, um mich bis zur Zeit des Diners zu sammeln. Ein Zug aus meiner Pfeife und ein Blick in ein gewisses Buch, das ich bereits zu erwähnen Gelegenheit gehabt habe, brachten Körper und Seele wieder in das gehörige Gleichgewicht. Ich wurde aus einem Zustand, der, glaube ich, nicht sowohl Schlummer als Träumerei war, durch draußen erschallendes Pferdegetrappel erweckt, ging vor die Thür und nahm eine Cavalcade in Empfang, die aus Herrn Franklin, seinem Vetter und seinen beiden Cousinen in Begleitung eines der Stallknechte des alten Herrn Ablewhite bestand.
Sonderbarer Weise frappirte es mich auf der Stelle, daß Herr Godfrey grade wie Herr Franklin heute nicht in seiner gewöhnlichen Stimmung zu sein schien. Er gab mir wie immer freundlich die Hand und sprach sehr höflich seine Freude darüber aus, seinen alten Freund Betteredge so wohl zu sehen. Aber seine Stirn war umwölkt, was ich mir auf keine Weise zu erklären wußte, und als ich ihn fragte, wie es mit der Gesundheit seines Vaters gehe, antwortete er etwas kurz: »Ganz wie gewöhnlich!« Die beiden Fräulein Ablewhite aber waren von einer ungeheuren Munterkeit, die das Gleichgewicht mehr als herstellte Sie waren beinahe eben so groß wie ihr Bruder, stattliche Gestalten mit blondem Haar, rosige, von blühender Gesundheit und Lebenslust strotzende Mädchen. Die armen Pferde zitterten unter ihrer Last, und die kühnen Reiterinnen sprangen, ohne einer helfenden Hand zu bedürfen, aus dem Sattel aus den Boden, als ob ihre Glieder aus Kautschuk gemacht wären. Alles, was die Fräulein Ablewhite sagten, fing mit einem großen O!, Alles, was sie thaten, mit ungestümem Gepolter an, und sie kicherten und schrien zu passender und unpassender Zeit bei der geringsten Veranlassung. Ich nannte sie nur die Dragoner.
Der Lärm den die jungen Mädchen machten, gestattete mir, Herrn Franklin unbemerkt ein Wort in der Vorhalle zu sagen.
»Haben Sie den Diamanten unversehrt bei sich, Herr Franklin?«
Er nickte und klopfte dabei auf die Brusttasche seines Rockes.
»Haben Sie irgend etwas von den Indiern gesehen?«
»Nicht die Spur« Nach dieser Antwort fragte er nach Mylady und ging, als er hörte daß sie in dem kleinen Wohnzimmer sei, geradeswegs dahin. Er konnte noch keine Minute im Zimmer gewesen sein, als es klingelte, und Penelope beordert wurde, Herrn Franklin zu sagen, daß Fräulein Rachel ihn zu sprechen wünsche.
Als ich ungefähr eine halbe Stunde später durch die Halle ging, ward ich plötzlich durch lautes, aus dem kleinen Wohnzimmer hervor dringendes Geschrei zum Stehen gebracht. Das Geschrei konnte mich durchaus nicht beunruhigen, denn ich erkannte in demselben alsbald das beliebte große Oh des Fräulein Ablewhite. Gleichwohl ging ich unter dem Vorwande, mir eine Ordre in Betreff des Mittagessens zu erbitten, in’s Zimmer, um herauszufinden, ob wirklich irgend etwas Ernstes vorgefallen sei.
Da stand Fräulein Rachel am Tisch, wie von einem Zauber gebannt, den unseligen Diamanten des Obersten in der Hand. Und zu ihren beiden Seiten knieten die beiden »Dragoner,« die den Edelstein mit den Augen verschlangen und in Exstase ausbrachen, so oft der Stein in einer neuen Farbe spielte. An der andern Seite des Tisches stand Herr Godfrey, klaschte in die Hände wie ein großes Kind und lispelte einmal über das andere: »Köstlich, köstlich!« Auf einem Stuhl neben dem Bücherschrank saß Herr Franklin, zupfte sich am Bart und blickte ängstlich nach dem Fenster hin. Der Gegenstand seiner Aufmerksamkeit aber war Mylady, die, den Auszug aus dem Testament des Obersten in der Hand, am Fenster stand und der ganzen Gesellschaft den Rücken zukehrte. Sie maß mich, mit den Augen, als ich um meine Ordres bat, und ich sah das der Familie eigenthümliche Zusammenziehen der Brauen über ihren Augen und die Familienlaune in ihren Mundwinkeln zucken. »Kommen Sie in einer halben Stunde zu mir in in mein Wohnzimmer,« antwortete sie, »ich habe Ihnen dann etwas zu sagen.« Mit diesen Worten verließ sie das Zimmer. Es war klar, daß sie durch dieselbe Schwierigkeit betroffen gemacht wurde, welche Herrn Franklin und mir bei unserer Beratung am Zitterstrand bereits so viel Kopfbrechen verursacht hatte. Mußte sie in dem Vermächtnisse des Mondsteins einen deutlichen Beweis dafür erkennen, daß sie ihren Bruder mit grausamer Ungerechtigkeit behandelt habe? Oder war dies Vermächtniß ein Beweis, daß die Schlechtigkeit seines Charakters noch ihre schlimmsten Erwartungen übertroffen habe? Das waren schwierige Fragen, welche Mylady entscheiden sollte, während ihre Tochter ohne von dem Charakter des Obersten irgend etwas zu wissen, das Geburtstagsgeschenk desselben in der Hand, unbefangen dastand.
Ich war im Begriff das Zimmer zu verlassen, als Fräulein Rachel, die immer gegen den alten Diener, der schon im Hause gewesen, als sie geboren wurde, freundlich und rücksichtsvoll war, mich zurückhielt. »Sehen Sie nur, Gabriel!« sagte sie, und ließ den Diamanten vor meinen Augen im Sonnenlicht spielen.
Da sah ich den Diamanten leibhaftig vor mir, so groß, oder doch beinahe so groß wie ein Möwen-Ei! Der Stein strahlte wie das Licht des Vollmonds. Wenn man in den Diamanten hineinblickte, so wurden die Augen von einem tiefen Gelb so mächtig angezogen, daß sie nichts Anderes zu sehen vermochten. Dieser kleine Stein, den man zwischen Zeigefinger und Daumen halten konnte, schien unermeßlich tief wie der Aether. Wir legten ihn in die Sonne und machten dann das Zimmer dunkel; da erhellte er dasselbe mit seinem wunderbar geisterhaft mondartigen Licht. Kein Wunder, daß Fräulein Rachel wie von einem Zauber gebannt war und daß ihre Cousinen laut aufschrien. Der Diamant machte auf mich selbst einen solchen Eindruck, daß ich in ein ebenso gewaltiges »Oh!« ausbrach, die Dragoner. Der einzige unter uns, der seine Fassung behielt, war Herr Godfrey. Er schlang seine Arme um seine beiden Schwestern und sagte, indem er mitleidig zwischen dem Diamanten und mir hin- und herblickte: »Kohlenstoff, Betteredge! nichts als Kohlenstoff, lieber Freund.«
Er wollte vermuthlich meine Kenntnisse vermehren. Die Wirkung seiner Anrede war jedoch nur, daß ich mich des Mittagsessens erinnerte. Ich begab mich daher zu meiner Aufwärter-Armee hinunter. Noch in der Thür hörte ich, wie Herr Godfrey sagte: »Der gute alte Betteredge! ich habe die größte Achtung für ihn!« Während er mir dieses ehrende Zeugnis; ausstellte, umarmte er seine Schwestern und liebäugelte mit seiner Cousine. War das Herz dieses Jünglings nicht offenbar eine unerschöpfliche Quelle von Liebe? Neben ihm erschien Herr Franklin wie ein Barbar.
Nach Verlauf einer halben Stunde stellte ich mich, wie mir befohlen, in Mylady’s Wohnzimmer ein. Die Unterhaltung meiner Herrin mit mir hatte ungefähr denselben Inhalt wie die zwischen Herrn Franklin und mir bei dem Zitterstrand geführte, mit dem Unterschied, daß ich meinen Rat in Betreff der Jongleurs dieses Mal für mich behielt, da ich fand, daß es durch Nichts gerechtfertigt sein würde, wenn ich Mylady in dieser Beziehung beunruhigen wollte. Als ich wieder entlassen wurde, war mir klar, daß sie die schlimmsten Motive bei dem Obersten voraussetzte, und daß sie entschlossen sei, den Mondstein bei der ersten Gelegenheit wieder aus dem Besitz ihrer Tochter zu bringen.
Auf dem Rückwege nach meinem Zimmer begegnete mir Herr Franklin. Er wollte wissen, ob ich irgend etwas von seiner Cousine Rachel gesehen habe. Ich hatte aber Nichts von ihr gesehen. Ob ich ihm sagen könne, wo sein Vetter Godfrey sei? Das wußte ich nicht, aber ich fing an zu argwöhnen, daß Vetter Godfrey nicht weit von Cousine Rachel sein werde. Offenbar waren Herrn Franklin’s Gedanken auf derselben Fährte. Er zupfte an seinem Bart, ging dann in das Bibliothekzimmer, wo er die Thür hinter sich verschloß, nachdem er sie in einer höchst ausdrucksvollen Weise hinter sich zugeschlagen hatte. Ich wurde nun nicht mehr in meinen Vorbereitungen für das Geburtstag-Diner unterbrochen, bis es Zeit für mich war, mich für den Empfang der Gäste festlich zu schmücken.
Als icb eben meine weiße Weste angezogen hatte, erschien Penelope bei meiner Toilette unter dem Vorwande, mir einige noch etwa auf meinem Rocke befindlichen Härchen abzubürsten und die letzte Hand an die Schleife meiner weißen Cravatte zu legen. Meine Tochter war sehr aufgeräumt, und ich merkte daß sie mir Etwas zusagen habe. Sie küßte mich aus meinen kahlen Schädel und flüsterte mir zu: »Ich habe Neuigkeiten für Dich, Vater! Fräulein Rachel hat seinen Antrag abgelehnt.«
»Wessen Antrag?« fragte ich.
»Des Damen-Comitée-Mannes, Vater!« antwortete Penelope. »Ein widerwärtiger Schleicher, ich hasse ihn, weil er es versucht hat, Herrn Franklin ans dem Sattel zu heben.«
Hätte ich zu Worte kommen können, so würde ich gewiß gegen diese unehrerbietige Art, über einen so ausgezeichneten Philantropen zu sprechen, Protest erhoben haben. Aber meine Tochter war gerade in dem Augenblick mit der Schleife meiner Cravatte beschäftigt und die ganze Gewalt ihrer Gefühle concentrirte sich in ihren Fingern. In meinem Leben war ich nie in so großer Gefahr gewesen, strangulirt zu werden.
»Ich habe gesehen,« sagte Penelope, »wie er mit ihr allein in dem Rosengarten ging, und ich stellte mich hinter die Hecke, um sie zurückkommen zu sehen. Auf dem Heimwege waren sie lachend Arm in Arm gegangen. Auf dem Rückwege gingen sie Beide, Jeder für sich mit höchst ernsthaftem Gesicht nach verschieden Seiten in einer Weise hinblickend, die nicht zu mißdeuten war. Vater! in meinem Leben habe ich mich nicht so gefreut! Es giebt also doch Ein weibliches Wesen in der Welt, das Herrn Godfrey Ablewhite zu widerstehen vermag, und wenn ich eine Dame wäre, so würde ich die zweite sein!« Gegen diese Worte würde ich abermals protestirt haben, aber in diesem Augenblicke hatte meine Tochter die Haarbürste ergriffen und ergoß jetzt mittelst dieser die ganze Gewalt ihrer Gefühle auf mich. Wer von meinen Lesern einen Kahlkopf hat, wird verstehen was das heißen will. Wer aber keinen Kahlkopf hat mag diese Stelle überschlagen und Gott danken, daß er auf seinem Schädel Etwas hat, womit er sich gegen zu gewaltsame Berührungen seiner Haarbürste schützen kann.
»Gerade an der anderen Seite der Hecke,« fuhr Penelope fort, »stand Herr Godfrey still.«
»Sie wünschen,« sagte er, »daß ich hier bleibe, als ob Nichts vorgefallen wäre?«
Wie ein Blitz wandte sich Fräulein Rachel nach ihm um.
»Sie haben die Einladung meiner Mutter angenommen,« antwortete sie, »und Sie sind hier, um andere Gäste zu treffen, und wenn Sie nicht Aufsehen erregen wollen, so müssen Sie natürlich bleiben!«
Sie ging wieder einige Schritte vorwärts und dann wieder etwas langsamer.
»Lassen Sie uns das Vorgefallene vergessen«, sagte sie, »und lassen Sie uns unser verwandtschaftliches Verhältniß aufrecht erhalten.« Dabei gab sie ihm die Hand. Er küßte sie, was ich ziemlich frei von ihm fand, und dann ging sie fort. Er blieb eine Weile mit gesenktem Kopfe allein stehen, grub mit seiner Hacke langsam ein Loch in den Kiesweg —— und sah so niedergeschlagen aus, wie du gewiß in deinem Leben keinen Menschen gesehen hast. »Fatal!« murmelte er zwischen den Zähnen, blickte dabei in die Höhe und ging in’s Haus, »sehr fatal!«
Wenn er damit seine Meinung über sich selbst aussprechen wollte, so hatte er ganz recht. Er ist fatal genug; das weiß Gott. Und das Ende von Allem, was ich Dir erzählt habe, Vater,« rief Penelope, indem sie mir zum letzten Male mit der Bürste über den Scheitel fuhr, »das Interessanteste ist: Herr Franklin ist der Mann!«
Ich ergriff die Haarbürste und öffnete meine Lippen, um einen Tadel auszusprechen, den, wie meine Leser zugestehen werden, die Sprache und das Benehmen meiner Tochter reichlich verdient hatten. Aber, ehe ich ein Wort sagen konnte, erklang draußen das Rollen von Wagenrädern und verhinderte mich am Reden. Die ersten Tischgäste waren erschienen. Penelope lief ohne Weiteres fort. Ich zog meinen Rock an und warf noch einen Blick in den Spiegel. Mein Kopf war so roth wie ein Hummer, aber im Uebrigen war ich für die festliche Gelegenheit so stattlich angethan, wie es sich schickte. Ich traf eben rechtzeitig in der Vorhalle ein, um die beiden ersten Gäste zu melden. Der Leser braucht sich für dieselben nicht besonders zu interessiren. Es waren nur der Vater und die Mutter des Philanthropen, Herr und Frau Ablewhite.

Zehntes Capitel.
Einer nach dem Andern folgten die übrigen Gäste den Ablewhites. Als die Gesellschaft versammelt war, zählte sie, die Familie mit einbegriffen, vierundzwanzig Mitglieder. Es war ein schöner Anblick, als sie um den Tisch saßen und der Pfarrer von Frizinghall mit klangvoller Stimme das Tischgebet sprach. Ich brauche meine Leser nicht mit der Aufzählung der Gäste zu langweilen; sie werden mit Ausnahme von Zweien wenigstens in dem Theil dieser Geschichte den ich aufzuzeichnen habe, keinem derselben wieder begegnen. Jene zwei saßen zu beiden Seiten von Fräulein Rachel, welche als Königin des Festes natürlich den Hauptanziehungspunkt in der Gesellschaft bildete.
Bei dieser Gelegenheit war sie noch ganz besonders der Mittelpunkt dem sich die Blicke Aller zuwandten; denn zu Mylady’s geheimem Verdruß trug sie ihr wundervolles Geburtstagsgeschenk, welches alles Uebrige verdunkelte, den Mondstein. Der Stein war nicht gefaßt, als er ihr übergeben wurde; aber unser Universalgenie, Herr Franklin, hatte es mittelst seiner geschickten Finger und ein wenig Silberdraht möglich gemacht, denselben als Broche an ihr weißes Kleid zu befestigen. Jedermann bewunderte die fabelhafte Größe und Schönheit des Diamanten; aber die einzigen beiden Personen in der Gesellschaft, welche mehr als das ganz Gewöhnliche über den Stein sagten, waren die erwähnten beiden Gäste, welche zu beiden Seiten von Fräulein Rachel saßen. Der Gast zur Linken war Herr Candy, unser Arzt in Frizinghall. Er war ein kleiner Mann und ein angenehmer Gesellschafter, nur mit dem einzigen Fehler, daß er zu viel Geschmack zu rechter und zu unrechter Zeit an seinen eigenen Witzen fand und daß er es zu sehr liebte, sich in eine lange Unterhaltung mit Fremden zu stürzen. Er beging fortwährend große Taktlosigkeiten indem er die Leute unabsichtlich verletzte. In seiner ärztlichen Praxis war er vorsichtiger, indem ihn hier, wie selbst seine Gegner zugestanden, ein gewisser Instinkt der Discretion leitete, der ihn das Rechte finden ließ, wo sorgsamere Aerzte leicht auf eine falsche Fährte geriethen. Was er Fräulein Rachel über den Diamanten sagte, war wie gewöhnlich ein Gemisch von Scherzen und Mystificationen. Er bat sie ganz ernsthaft, im Interesse der Wissenschaft ihm zu erlauben, den Diamanten mit nach Hause zu nehmen und zu verbrennen. »Wir wollen ihn erst,« sagte der Doctor, »bis zu einem gewissen Grade erhitzen, wollen ihn dann einem Luftstrome aussetzen und allmälig verdampfen lassen. Und so ersparen wir Ihnen eine Welt voll Angst und Sorgen um die sichere Aufbewahrung eines so kostbaren Juwels.« Mylady, die mit einem sorgenvollen Ausdruck zuhörte, schien zu wünschen, daß der Doktor ernsthaft spräche und daß er Fräulein Rachel veranlassen könnte, aus wissenschaftlichem Eifer ihr Geburtstagsgeschenk zu opfern.
Der andere Gast, der an der rechten Seite meines jungen Fräuleins saß, war eine berühmte Persönlichkeit, der bekannte indische Reisende Murthwaite, der mit Lebensgefahr und in Verkleidungen in Gegenden vorgedrungen war, welche nie zuvor ein europäischer Fuß betreten hatte. Er war ein langer, hagerer, muskulöser, sonnverbrannter, schweigsamer Mann. Trotz eines Ausdrucks von Abspannung war sein Blick scharf und aufmerksam. Es hieß, er sei des ewigen Einerlei des Lebens in unserer Gegend überdrüssig und sehne sich darnach, den Wanderstab wieder in die Hand zu nehmen und in die unerforschten Länder des Ostens zurückzukehren. Ich glaube, daß er mit Ausnahme dessen, was er zu Fräulein Rachel über ihren Diamanten sagte, während des ganzen Mittagessens keine sechs Worte sprach und kein einziges Glas Wein trank. Der Mondstein war der einzige Gegenstand, der ihm das mindeste Interesse einflößte. Der Ruf desselben schien an einigen jener gefährlichen indischen Orte, wohin ihn seine Wanderung geführt hatte, zu ihm gedrungen zu sein. Nach dem er denselben so lange schweigend angesehen hatte, daß Fräulein Rachel verlegen zu werden anfing, sagte er zu ihr in seiner kühlen, ruhigen Weise: »Wenn Sie je nach Indien gehen sollten, Fräulein Verinder, so hüten Sie sich, das Geburtstags-Geschenk Ihres Onkels mitzunehmen. Ein indischer Diamant ist zuweilen ein religiöses Symbol. Mir ist eine indische Stadt und ein Tempel in dieser Stadt bekannt, wo Sie, geschmückt wie Sie in diesem Augenblicke sind, nicht fünf Minuten lang Ihres Lebens sicher sein» würden.«
Fräulein Rachel, die sich in England vollkommen sicher fühlte, amüsirte sich sehr, von einer ihr in Indien drohenden Lebensgefahr zu hören; die »Dragoner« amüsirten sich noch mehr darüber. Sie ließen ihre Messer und Gabeln auf den Tisch fallen und brachen gemeinschaftlich in den heftigen Ausruf aus: »O, wie interessant!«
Mylady wurde offenbar nervös und leitete die Unterhaltung auf einen andern Gegenstand über.
Im Verlauf des Diners wurde es mir allmälig klar, daß dieses Fest keinen so fröhlichen Fortgang nehme, wie es andere ähnliche Feste bei uns gethan hatten. Wenn ich jetzt nach Allem, was seitdem geschehen ist, an den Geburtstag zurückdenke so bin ich fast geneigt zu glauben, daß der unselige Diamant wie ein Alp auf der Gesellschaft lastete. Ich füllte die Gläser fleißig und begleitete als eine privilegirte Person weniger beliebte Speisen bei ihrem Umgang um den Tisch, indem ich den Gästen vertraulich zuflüsterte: »Bitte, kosten Sie doch einmal davon; ich bin überzeugt, es wird Ihnen schmecken.« In den meisten Fällen befolgten sie meinen Rath, wie sie freundlich bemerkten aus Achtung für ihren alten Freund Betteredge. Aber das half Alles nichts. Es entstanden peinliche Pausen in der Unterhaltung, die mich persönlich unbehaglich stimmten. Kam die Unterhaltung dann wieder einmal in Fluß, so geschah es ganz unabsichtlich in der denkbar ungeschicktesten Weise und mit sehr unangenehmen Wirkungen. So sagte z. B. Herr Candy, der Arzt, mehr unpassende Dinge, als ich je früher von ihm gehört hatte.
Hier nur ein Beispiel und meine Leser werden verstehen, was ich, dem das fröhliche Gedeihen des Festes so sehr am Herzen liegen mußte, auf meinem Posten am Buffet auszustehen hatte.
Eine der Damen unserer Gesellschaft war die würdige Mrs. Threadgall, die Wittwe des verstorbenen Professors dieses Namens. Die gute Dame sprach fortwährend von ihrem verstorbenen Manne, ohne jemals gegen Fremde zu erwähnen, daß er todt sei. Sie glaubte vermuthlich, daß jeder Mensch in England das wissen müsse.
Nach einer jener peinlichen Pausen wurde das Gespräch auf den trockenen und widerwärtigen Gegenstand der menschlichen Anatomie gebracht, worauf die gute Mrs. Threadgall, wie gewöhnlich, ihres verstorbenen Mannes gedachte, ohne zu erwähnen, daß er todt sei. Sie bezeichnete die Anatomie als die Lieblings-Beschäftigung des Professors in seinen Mußestunden. Unglücklicherweise hörte Herr Candy, der über den verstorbenen Professor nichts wußte und unserer Dame gegenüber saß, diese Worte. Als der höflichste Mann auf der Welt ergriff er die Gelegenheit, sich auf der Stelle den anatomischen Unterhaltungen des Professors zuzugesellen »In dem Collegium der Wundärzte haben sie kürzlich einige wundervolle Skelette bekommen,« sagte Herr Candy mit lauter, munterer Stimme, »ich möchte dem Herrn Professor angelegentlichst empfehlen, verehrte Frau, sich in der ersten freien Stunde diese Skelette anzusehen.« Es entstand ein tiefes Schweigen. Die ganze Gesellschaft saß sprachlos da. Ich stand gerade hinter Mrs. Threadgall und schenkte ihr vertraulich ein Glas Rheinwein ein; sie senkte den Blick und sagte ganz leise: »Mein theurer Gatte ist nicht mehr!« Der unglückliche Herr Candy, der nichts gehört und keine Ahnung von dem wirklichen Sachverhalt hatte, fuhr lauter und höflicher als zuvor über Tisch fort: »Der Herr Professor weiß vielleicht nicht, daß er vermöge einer Mitgliedskarte an jedem Tage, außer Sonntags, in den Stunden von Zehn bis Vier in’s Colleg gelangen kann.« Mrs.Treadgall ließ ihr Haupt aus die Brust sinken und wiederholte mit noch leiserer Stimme die Worte: »Mein theurer Gatte ist nicht mehr!« Ich winkte Herrn Candy über den Tisch, Fräulein Rachel stieß ihn an, Mylady warf ihm vielsagende Blicke zu. Alles vergebens. Mit einer unbefangenen Heiterkeit, die auf keine Weise zu hemmen war, fuhr er fort: »Ich werde dem Herrn Professor mit dem größten Vergnügen meine Karte schicken, wenn »Sie die Güte haben wollen, mir seine jetzige Adresse anzugeben.«
»Seine jetzige Adresse, Herr Candy, ist das Grab,« erwiderte Mrs. Threadgall, die nun plötzlich ihre Fassung völlig verlor und diese Worte so heftig und emphatisch ausrief, daß die Gläser davon erklangen. »Der Professor ist seit zehn Jahren todt!«
»Mein Gott!« rief Herr Candy erschrocken.
Mit Ausnahme der »Dragoner«, die in ein Lachen ausbrachen, befiel die ganze Gesellschaft ein stummer Schrecken. Die übrigen Gäste waren in ihrer Unterhaltung kaum minder verletzend als der Doktor. Wo sie hätten sprechen sollen, schwiegen sie, und wenn sie sprachen, so sagten sie etwas Ungeschicktes. Herr Godfrey, der bei öffentlichen Gelegenheiten eine so große Beredtsamkeit zu entfalten pflegte, schien durchaus abgeneigt, sich an einer allgemeineren Conversation zu betheiligen. Ob aus Verdruß oder aus Scham nach seiner Niederlage im Rosengarten, weiß ich nicht. Er verwandte seinen ganzen Unterhaltungsstoff auf die neben ihm sitzende Dame: sie gehörte zu seinen Comité-Damen und war eine kirchlich gesinnte Frau mit einer stattlichen Entfaltung des Busens und einer starken Liebhaberei für Champagner, den sie wohlverstanden ohne Schaum in reichlichem Maße genoß.«
Da ich auf meinen Posten am Büffet dicht hinter diesen Beiden stand, so kann ich nach dem, was ich von ihrer Unterhaltung hörte, versichern, daß der Gesellschaft ein sehr belehrendes Gespräch entging, daß nur mir zu Statten kam, während ich die Flaschen entkorkte, den Hammelbraten tranchirte u. s. w. Was sie über ihre mildthätigen Unternehmungen sprachen, konnte ich nicht hören. Als ich Zeit hatte, zuzuhören, waren sie längst von ihren armen Wöchnerinnen und ihren gefallenen Mädchen abgekommen und mit sehr ernsten Dingen beschäftigt. Religion, sagten sie, soviel ich zwischen dem Aufziehen der Pfropfen und dem Geräusch des Tranchirmessers hören konnte, bedeute Liebe, und Liebe bedeute Religion, und die Erde sei ein etwas abgetragener Himmel, und der Himmel sei die wieder wie neu ausgeputzte Erde. Auf Erden wandelten zwar einige nichts weniger als tadellose Menschen, aber dafür würden alle Frauen im Himmel Mitglieder eines ungeheuren nie uneinigen Comités sein, bei dem alle Männer den Damen als dienstbare Engel zugesellt sein würden. »Herrlich! herrlich!«
Aber weiß der Teufel, warum Herr Godfrey Alles für sich und seine Dame behielt! Dagegen aber höre ich den Leser sagen, bot Herr Franklin doch gewiß Alles auf, die Gesellschaft in eine heitere Stimmung zu versehen? Weit gefehlt! Er schien zwar seine Fassung völlig wiedererlangt zu haben und war in Folge von Penelope’s Mittheilung über Herrn Godfrey’s Aufnahme im Rosengarten sehr gut aufgelegt Aber was er auch heute sagen mochte, fast immer kam es auf eine Tactlosigkeit heraus, so daß er am Ende Einige beleidigt und Alle verlegen gemacht hatte. Seine ausländische Erziehung, jene französische, deutsche und italienische Seite, von denen ich schon früher gesprochen habe, äußerte sich am gastlichen Tische Myladys in einer höchst unliebsamen Weise.
Was soll man z. B. dazu sagen, wenn er über den Grad sprach, bis zu welchem sich die Bewunderung einer verheiratheten Frau für einen andern Mann als ihren Gatten versteigen dürfe und diese Bemerkungen in seiner witzigen, scharfsinnigen, französischen Manier an die unverehelichte Tante des Predigers von Frizinghall richtete? Oder wenn er dann wieder die deutsche Seite hervorkehrte und einem großen Gutsbesitzer, einer anerkannten Autorität auf dem Gebiete der Viehzüchtung, als dieser seine Erfahrungen über die Mittel zur Herstellung ausgezeichneter Ochsen mittheilte, entgegnete, daß, genau genommen, Erfahrung gar nichts nütze, und daß vielmehr das rechte Mittel, gute Ochsen zu züchten, das sei, sich in sich selber zu versenken, aus seinem Innern die Idee eines vollkommenen Ochsen zu entwickeln und ihn dann herzustellen? Oder was soll man endlich zu Folgendem sagen? Als beim Käse und Salat ein Mitglied unserer Grafschaft sich über die Verbreitung der Demokratie in England in folgenden heftigen Worten erging: »Wenn wir einmal die alten Stützen unserer Verfassung verlieren, was meinen Sie, Herr Blake, was wir da noch übrig behalten?« antwortete unser Freund, auf dem diesmal der Italiener sprach: »Wir würden dann noch drei Dinge übrig behalten: Liebe, Musik und Salat.« Er choquirte nicht nur durch Ausbrüche wie diese die ganze Gesellschaft, sondern er verlor auch, als er dann wieder die englische Seite seines Wesens hervorkehrte, seine ausländische Höflichkeit und sagte, als die Unterhaltung auf den ärztlichen Beruf kam, so bitter-satyrische Dinge über Aerzte, daß er den gutmüthigen kleinen Herrn Candy in eine wahre Wuth versetzte.
Der Streit zwischen ihnen entspann sich, als Herr Franklin, ich weiß nicht mehr in welcher Veranlassung, erklärte, daß er neuerdings sehr schlecht geschlafen habe.
Herr Candy bemerkte darauf, daß sein Nervensystem offenbar angegriffen sei, und daß er unverzüglich Etwas dagegen gebrauchen müsse.
Herr Franklin erwiderte, daß sich ärztlich behandeln lassen und im Dunkeln tappen für ihn ganz gleichbedeutende Dinge seien.
Herr Candy gab ihm den Hieb geschickt zurück und sagte, daß Herr Franklin selbst, medicinisch gesprochen, im Dunkeln umhertappe, um Schlaf zu suchen, und daß nur die Medicin ihm zu diesem verhelfen könne.
Herr Franklin, an dem jetzt wieder die Reihe war, einen Hieb zu führen, bemerkte, daß er oft habe sagen hören, ein Blinder könne einen Blinden führen, daß er aber jetzt zum ersten Mal den wahren Sinn dieses Wortes verstehe.
In dieser Weise ging das Scharmützel eine Weile fort, bis beide anfingen heftig zu werden, namentlich Herr Candy, der in der Vertheidigung seines Berufs die Herrschaft über sich selbst so völlig verlor, daß Mylady sich genöthigt sah, dazwischen zu treten und die Fortsetzung des Gesprächs zu untersagen. Dieser nothgedrungene Act der Autorität von Seiten der Hausfrau brachte die matt glimmende Flamme der Geister völlig zum Erlöschen. Hie und da flackerte noch ein kurzes Gespräch auf, wiewohl aber immer nur, um wenige Augenblicke kümmerlich zu glimmen. Der Dämon des Diamanten waltete über diesem Mittagessen und Jedermann fühlte sich erleichtert, als meine Herrin endlich die Tafel aufhob und den Damen das Zeichen gab, die Herren ihrem Weine zu überlassen.
Ich hatte eben die Krystallflaschen in einer Reihe vor dem alten Herrn Ablewhite aufgestellt, welcher den Hausherrn vertrat, als plötzlich ein Ton von der Terrasse herauf erklang, der mich völlig aus meiner Butler-Fassung brachte. Herr Franklin und ich sahen einander an; es war der Ton der indischen Trommel, so wahr ich lebe! Es waren die Jongleurs die zugleich mit dem Mondstein zu unserem Hause zurückkehrten!
Als sie im Begriff waren, sich an der Ecke der Terrasse aufzustellen, humpelte ich hinunter, um sie wegzuschicken; aber ein unglücklicher Zufall wollte, daß die beiden »Dragoner« mir zuvorkamen. Sie platzten in ihrem ungeduldigen Verlangen, die Indier ihre Künste produciren zu sehen, auf die Terrasse los wie ein Paar Raketen. Die anderen Damen folgten ihnen; dann kamen auch die Herren hinzu. Ehe man sich’s versah, hatten die Spitzbuben angefangen ihre Begrüßungen zu machen, und waren die Dragoner damit beschäftigt, den hübschen kleinen Jungen zu liebkosen. Herr Franklin stellte sich an die eine Seite von Fräulein Rachel und ich postirte mich hinter sie. Wenn unser Argwohn begründet war, so präsentirte sie ohne Ahnung irgend einer Gefahr wie sie dastand den Diamanten an ihrer Brust den danach lüsternen Indiern! Was sie für Taschenspielerstücke und wie sie sie machten, kann ich nicht sagen.
Der unangenehme Verlauf des Mittagessens und das fatale Erscheinen dieser Spitzbuben, die eben im rechten Moment gekommen waren, um den Edelstein mit ihren eigenen Augen zu sehen, brachten mich nachgerade außer Fassung. Die erste bemerkenswerthe Thatsache war dann das plötzliche Erscheinen des indischen Reisenden, Herrn Murthwaite. Indem er aus dem Halbkreis« in welchem die Damen und Herren saßen oder standen, heraustrat, stellte er sich ruhig hinter die Jongleurs und fing plötzlich an, sich in ihrer Landessprache mit ihnen zu unterhalten.
Hätte er ihnen einen Bajonnettstoß versetzt, hätten sie sich schwerlich tigerartig wilder gegen ihn geberden können, als sie es bei den ersten indischen Worten, die er aussprach thaten.
Im nächsten Augenblick verbeugten sie sich gegen ihn — und begrüßten ihn in ihrer höflichsten und kriechendsten Manier.
Nachdem sie einige Worte in ihrer unverständlichen Sprache mit einander gewechselt hatten, entfernte sich Herr Murthwaite ebenso ruhig wieder, wie er gekommen war. Darauf näherte sich der Anführer der Indier, der ihnen als Dolmetscher diente, wieder den Damen und Herren. Es entging mir nicht, daß das kaffeefarbige Gesicht des Kerls grau geworden war, seit Herr Murthwaite mit ihm gesprochen hatte. Er verneigte sich gegen Mylady und erklärte ihr, daß die Vorstellung zu Ende sei.
Die »Dragoner,« welche über diesen plötzlichen Schluß unbeschreiblich desapointirt waren, brachen in ein lautes »Oh!« gegen den Urheber dieses unerwarteten Schlusses, Herrn Murthwaite, aus.
Der Anführer der Indier legte seine Hand demüthig auf seine Brust und sagte zum zweiten Mal, die Jongleur-Vorstellung sei vorüber.
Der kleine Junge ging mit einem Hute in der Hand umher. Die Damen zogen sich in den Salon zurück und die Herren gingen mit Ausnahme der Herren Franklin und Murthwaite wieder zu ihrem Wein. Ich und der Diener folgten den Indiern, bis wir überzeugt waren, daß sie unsern Grund und Boden verlassen hatten.
Aus unserem Rückwege längs der Büsche spürte ich Tabaksgeruch und fand Herrn Franklin und Herrn Murthwaite, den Letzteren eine indische Cigarre rauchend, langsam unter den Bäumen auf- und abgehend.
Herr Franklin forderte mich auf, mich zu ihnen zu gesellen.
»Das ist,« sagte Herr Franklin, indem er mich dem großen Reisenden vorstellte, »Gabriel Betteredge, der alte Diener und Freund unserer Familie, von dem ich so eben mit Ihnen gesprochen habe. Wiederholen Sie ihm, wenn ich bitten darf, was Sie mir gesagt haben.«
Herr Murthwaite nahm sein Cigarre aus dem Munde und lehnte sich in seiner müden Weise gegen einen Baumstumpf.
»Herr Betteregde,« fing er an, »die drei Indier sind so wenig Jongleurs, wie Sie und ich.«
Ich war natürlich sehr erstaunt und fragte den Reisenden, ob er schon je zuvor mit diesen Indiern zusammengetroffen sei.
»Niemals«, erwiderte Herr Murthwaite; »aber ich kenne das indische Jongleurwesen sehr genau. Alles, was Sie heute Abend davon gesehen haben, war nur eine elende und plumpe Nachahmung. Wenn mich nicht trotz einer langen Erfahrung Alles täuscht, sind diese Männer nichts Geringeres als Angehörige der Braminen-Kaste. Ich trat ihnen mit der Erklärung entgegen, daß sie entlarvt seien, und Sie haben selbst gesehen, wie das bei allem Geschick der Indier, ihre Gefühle zu verbergen, auf die Leute gewirkt hat. Es ist etwas Geheimnißvolles in ihrem Benehmen, was ich mir nicht zu erklären weiß. Sie haben zwiefach die Gesetze ihrer Kaste übertreten, einmal indem sie über das Meer fuhren, und dann indem sie sich als Jongleurs verkleideten. Das sind für indische Braminen ungeheuere Dinge. Sie müssen also sehr dringende Gründe für ihre Handlungsweise und ganz ungewöhnliche Momente zu ihrer Rechtfertigung haben, um hoffen zu können, wieder in ihre Kaste aufgenommen zu werden, wenn sie in ihr Vaterland zurückkehren.«
Ich war wie vernichtet. Herr Murthwaite rauchte seine Cigarre ruhig weiter.
Herr Franklin brach nach einer Pause, während deren er, wie mir schien, zwischen den verschiedenen Seiten seines, Charakters geschwankt hatte, das Schweigen mit folgenden von der italienischen und englischen Seite gleichmäßig eingegebenen Worten: »Ich trage Bedenken, Sie mit Familien-Angelegenheiten zu behelligen, Herr Murthwaite, die Sie nicht interessiren können und von denen ich außerhalb des Kreises unserer Familie lieber nicht reden möchte. Aber nach dem, was Sie eben gesagt haben, fühle ich mich im Interesse von Lady Verinder und ihrer Tochter verpflichtet, Ihnen etwas mitzutheilen, was Ihnen möglicherweise den Schlüssel zu dem Benehmen jener Leute geben kann. Ich rede zu Ihnen im Vertrauen und ich kann mich fest auf Sie verlassen, nicht wahr?«
Nach dieser Einleitung theilte er dem indischen Reisenden in seiner präcisen französischen Weise alles Das mit, was er mir bei dem Zitterstrand erzählt hatte. Selbst den unbeweglichen Herrn Murthwaite interessirten diese Mittheilungen so lebhaft, daß er seine Cigarre ausgehen ließ. »Und nun«, schloß Herr Franklin seine Erzählung, »was sagen Sie nach Ihren Erfahrungen dazu?«
»Nach meinen Erfahrungen,« antwortete der Reisende, »sage ich, daß Sie öfter einer drohenden Lebensgefahr glücklich entronnen. sind, Herr Blake, als ich, und das will viel sagen.«
Jetzt war es an Herrn Franklin seinerseits, erstaunt zu sein.
»Ist die Sache wirklich so ernsthaft?« fragte er.
»Nach meiner Ueberzeugung gewiß,« antwortete Herr Murthwaite »Nach dem, was Sie mir eben mitgetheilte haben, zweifle ich nicht, daß die Wiederbefestigung des Mondsteins an seiner ursprünglichen Stelle auf der Stirn des Götzen der Grund und die Rechtfertigung der Verstöße gegen die Vorschriften der Kaste ist, von denen ich vorhin gesprochen habe. Diese Leute werden eine günstige Gelegenheit mit der Geduld einer Katze abwarten, und dieselbe, sowie sie sich darbietet, mit der Wildheit eines Tigers ergreifen. Wie Sie ihnen entkommen sind, ist mir unverständlich.« sagte der berühmte Reisende, indem er sich seine Cigarre wieder anzündete und Herrn Franklin scharf in’s Auge faßte. »Sie haben den Diamanten zu wiederholten Malen transportirt,» hier und in London, und Sie sind noch am Leben! Sehen wir näher zu, ob wir eine Erklärung dafür finden, daß Sie diesen Gefahren entronnen sind. Es war, wenn ich nicht irre, beide Male bei Tage, daß sie den Edelstein aus der Bank in London nahmen?«
»Bei hellem Tage« antwortete Herr Franklin.
»Und wie viele Leute waren auf der Straße?«
»Sehr viele!«
»Sie hatten ohne Zweifel eine bestimmte Zeit festgesetzt, zu der Sie hier in Lady Verinder’s Haus eintreffen wollten? Zwischen der Station und dem Hause hier ist die Gegend sehr einsam. Haben Sie die festgesetzte Zeit eingehalten?«
»Nein, ich traf vier Stunden früher ein, als ich mich gemeldet hatte.«
»Nun, zu dieser Verfrühung Ihrer Ankunft sage ich Ihnen meinen herzlichsten Glückwunsch. Wann brachten Sie den Diamanten von hier nach nach der Bank in der Stadt?«
»Eine Stunde, nachdem ich hier damit angekommen war, und drei Stunden, bevor irgend Jemand mich in dieser Gegend erwartete.«
»Auch dazu sage ich Ihnen meinen herzlichsten Glückwunsch. Brachten Sie ihn dann allein hierher zurück.«
»Nein, ich ritt zufällig mit meinem Vetter, meinen Cousinen und dem Stallknecht.«
»Nun, so gratulire ich Ihnen zum dritten Mal. Sollten Sie jemals Neigung verspüren, Herr Blake, über die Grenze der civilisirten Welt hinauszureisen, so lassen Sie mich es wissen und ich will Sie begleiten. Sie sind ein vom Glücke wunderbar begünstigter Mensch!«
Hier fiel ich ein. Diese Art und Weise stimmte durchaus nicht mit meinen englischen Ideen.
»Sie wollen doch nicht im Ernste sagen, Herr Murthwaite,« fragte ich, »daß die Kerle Herrn Franklin um’s Leben gebracht haben würden, um ihren Diamanten zu bekommen, wenn er ihnen die Gelegenheit dazu geboten hätte?«
»Rauchen Sie, Herr Betteredge?« fragte der Reisende.
»Ja, Herr Murthwaite!«
»Bekümmern Sie sich viel um die Asche, die in Ihrer Pfeife zurückbleibt, wenn Sie sie ausklopfen?«
»Nein, Herr Murthwaite!«
»In dem Lande, aus welchem jene Leute kommen, machen sie sich genau so viel daraus, einen Menschen um’s Leben zu bringen, als Sie sich daraus machen, die Asche aus Ihrer Pfeife zu klopfen.
Wenn tausend Menschenleben zwischen ihnen und der Wiedererlangung des Diamanten ständen, und wenn sie glauben dürften, diese Leben unentdeckt zerstören zu können, so würden sie nicht das mindeste Bedenken tragen, sie alle zu opfern. Das Aufgeben einer Kaste ist eine sehr ernste Sache in Indien, die Vernichtung eines Menschenlebens aber bedeutet dort gar nichts.«
Ich äußerte darauf, daß nach meiner Meinung das Volk der Indier eine Raubmörderbande sei. Herr Murthwaite hingegen erklärte, daß sie ein höchst merkwürdiges Volk seien. Herr Franklin sprach gar keine Ansicht aus, sondern suchte die Unterhaltung wieder auf den vorliegenden Gegenstand zurückzulenken.
»Sie haben den Mondstein an Fräulein Verinder’s Brust gesehen« sagte er; »was ist jetzt zu thun?«
»Das, womit Ihr Onkel gedroht hat,« antwortete Herr Murthwaite »Herncastle kannte seine Leute. Schicken Sie den Diamanten morgenden Tages unter Bewachung von mehr als einem Mann zum Zerschneiden nach Amsterdam. Lassen Sie ein halbes Dutzend Diamanten statt eines einzigen daraus machen. Damit ist seiner geheiligten Identität mit dem Mondstein und damit zugleich der Verschwörung ein Ende gemacht.«
Herr Franklin wandte sich zu mir.
»Es hilft nichts, wir müssen morgen mit Lady Verinder sprechen!«
»Und warum nicht noch heute Abend?« fragte ich.
»Es wäre doch möglich, daß die Indier inzwischen wieder herkämen.«
Herr Murthwaite antwortete mir, bevor noch Herr Franklin reden konnte: »Die Indier werden es nicht riskiren, noch diesen Abend zurückzukommen; sie bedienen sich fast bei keiner Gelegenheit des direkten Weges, am wenigsten bei einer Affaire wie diese, wo das geringste Versehen für die Erreichung ihres Zweckes verhängnißvoll werden könnte.«
»Wenn nun aber die Spitzbuben verwegener wären, als Sie annehmen?« fuhr ich fort.
»Ja diesem Falle,« sagte Herr Murthwaite »lassen Sie die Hunde los! Haben Sie große Hunde hier auf dem Gut?«
»Zwei, Herr Murthwaite einen Kettenhund und einen Bluthund.«
»Das ist genug, die Hunde haben in unserm Fall den großen Vorzug, sich durch keine Scrupel über die Heiligkeit des menschlichen Lebens beirren zu lassen.«
Die Töne des Claviers drangen bei diesen Worten des Herrn Murthwaite aus dem Salon zu uns. Herr Murthwaite warf seine Cigarre weg und ergriff Herrn Franklins Arm, um zu den Damen zurückzukehren. Ich beobachtete, daß der Himmel sich rasch bewölkte, während ich ihnen in’s Haus folgte. Herr Murthwaite bemerkte dies gleichfalls; er wandte sich nach mir um und sagte in seiner sonderbar trocknen Weise: »Die Indier werden heute Abend ihre Regenschirme gebrauchen, Herr Betteredge!« Er konnte wohl über die Sache scherzen, aber ich war kein berühmter Reisender; mein Weg in dieser Welt hatte mich nicht daran gewöhnt, unter Dieben und Mördern in den entferntesten Gegenden der Welt Katze und Maus um mein Leben zu spielen.
Ich ging in mein kleines Zimmer, setzte mich, um mich abzukühlen, in meinen Lehnstuhl und dachte rathlos darüber nach, was jetzt zu thun sei.
In dieser ängstlichen Gemüthsverfassung hätten andere Menschen sich vielleicht zu einer fieberhaften Aufregung gesteigert. Ich machte es anders: ich zündete mir eine Pfeife an und fing an in Robinson Crusoe zu blättern.
Bevor ich noch fünf Minuten darin gelesen hatte, stieß ich auf folgende merkwürdige Stelle Seite 161:
»Die Furcht vor Gefahren ist zehntausendmal so beängstigend als die Gefahr selbst, wenn sie uns vor die Augen tritt, und die Last der Angst ist viel drückender als das Uebel selbst, vor dem wir uns fürchten.«
Um an einen solchen Ausspruch Robinson Crusoe’s nicht zu glauben, müßte Einer im Kopfe nicht recht richtig oder von Selbstüberhebung völlig verblendet sein.
Ich war schon lange bei meiner zweiten Pfeife und saß noch immer in Bewunderung dieses merkwürdigen Buches verloren da, als Penelope, die den Thee herumgereicht hatte, zu mir kam, um mir über den Zustand der Dinge im Salon Bericht zu erstatten. Bei ihrem Fortgehen hatten eben die Dragoner angefangen, ein Duett zu singen, dessen Text mit einem großen »Oh!« anfing. Mylady hatte sich zum ersten Male, so lange Penelope denken konnte, verschiedene Versehen beim Whistspiel zu Schulden kommen lassen. Der große Reisende war in einer Ecke eingeschlafen.« Herr Franklin hatte seinen Witz auf Kosten der Damenwohlthätigkeit an Herrn Godfrey ausgelassen, und Herr Godfrey hatte die Hiebe schärfer parirt, als einem Manne von so wohlwollendem Wesen anstand. Fräulein Rachel war damit beschäftigt gewesen, anscheinend Mrs. Threadgall zu beschwichtigen, indem sie ihre Photographieen zeigte, in der That aber Herrn Franklin verstohlene Blicke zuzuwerfen, welche einem intelligenten Kammermädchen nicht einen Augenblick entgehen konnten. Den Doctor Herrn Candy hatte sie vermißt: er war aus geheimnißvolle Weise aus dem Salon verschwunden, war dann plötzlich wieder ebenso geheimnißvoll zurückgekommen und hatte sich in eine Unterhaltung mit Herrn Godfrey eingelassen. Im Ganzen ging es besser, als man nach dem Verlauf des Mittagessens hätte hoffen können. Wenn die Sache sich nur noch eine Stunde halten ließ, so führte die alte Mutter Zeit die Wagen der Gäste und erlöste uns von ihnen Allen.
Alles in dieser Welt geht vorüber und selbst die tröstende Wirkung Robinson Crusoes ging worüber, als Penelope mich wieder verließ. Ich wurde wieder unruhig und beschloß, noch einmal durch den Garten zu gehen, bevor der drohende Regen zu fallen anfing. Statt des Dieners, der doch nur eine menschliche Nase hatte und mir daher bei möglichen Ereignissen nutzlos gewesen wäre, nahm ich den Bluthund mit mir, auf dessen sichere Spürnase man sich verlassen konnte. Wir gingen durch den ganzen Garten bis aus die Landstraße und kamen ebenso klug, wie wir gegangen waren, wieder zurück, denn es war uns kein herumstreifendes menschliches Wesen begegnet Ich kettete also den Hund wieder an, nahm meinen Weg wieder längs der Gebüsche und begegnete Zweien unserer Herren, die eben den Salon verlassen hatten. Es waren Herr Candy und Herr Godfrey noch immer wie vorher nach Penelopes Bericht in lebhafter Unterhaltung begriffen und über ihre eigenen Witze lachend. Es kam mir sonderbar vor, daß diese beiden Männer sich befreundet haben sollten, ich ging aber natürlich, anscheinend ohne mich irgend um sie zu kümmern, an ihnen vorüber.
Die Ankunft der Wagen schien das Signal für den Ausbruch des Regens zu sein. Es goß, als ob es die ganze Nacht nicht wieder aufhören wolle.
Mit Ausnahme des Doktors, für den ein offener Einspänner bereit stand, fuhr die übrige Gesellschaft wohlverwahrt in geschlossenen Wagen nach Hause. Ich drückte Herrn Candy meine Besorgniß aus, er werde vom Regen durchnäßt werden, worauf er, mir erwiderte, es wundere ihn, daß ich so alt geworden sei, ohne zu wissen, daß die Haut eines Arztes wasserdicht sein müsse. So fuhr er über seinen kleinen Selbstwitz lachend im Regen fort und so wurden wir unsere Mittagsgesellschaft los.
Was ich nun zunächst zu berichten habe, ist der Verlauf der Nacht.

Elftes Capitel.
Als die letzten Gäste weggefahren waren, ging ich wieder in die Halle, wo Samuel an dem Seitentisch mit Cognac und Sodawasser stand. Mylady und Fräulein Rachel traten eben, von beiden Herren gefolgt, aus dem Salon. Herr Godfrey nahm etwas von jenen Getränken, Herr Franklin aber nahm nichts zu« sich. Er sah sehr abgespannt aus und setzte sich nieder: die Unterhaltung an diesem Geburtstag war ihm, wie mir schien, zu viel geworden.
Mylady warf, indem sie den Herren gute Nacht sagte, noch einen scharfen Blick aus das Vermächtniß des bösen Obersten, das an der Brust ihrer Tochter glänzte. »Rachel,« fragte sie, »wo willst Du Deinen Diamanten heute Nacht hinlegen?«
Das Fräulein war in sehr ausgelassener Stimmung, so recht aufgelegt, dummes Zeug zu reden, wie es junge Mädchen am Ende eines aufregenden Tages wohl zu sein pflegen. Zuerst erklärte sie, sie wisse nicht, wohin sie den Diamanten legen solle. Dann sagte sie, natürlich aus ihren Toilette-Tisch mit ihren anderen Sachen. Dann erinnerte sie sich wieder, daß der Diamant sie mit seinem mondlichtartigen Scheine incommodiren und während des Dunkels der Nacht erschrecken konnte. Dann wieder fiel ihr ein indisches Schränkchen ein, das in ihrem Wohnzimmer stand, und sie beschloß sofort, den indischen Diamanten in das indische Schränkchen zu legen, damit die zwei schönen Producte desselben Landes sich einander Gesellschaft leisten könnten. Nachdem sie ihrem Gelüste, dummes Zeug zu schwatzen, soweit freien Lauf gelassen hatte, trat ihre Mutter dazwischen und machte der Sache ein Ende.
»Liebes Kind, Dein indisches Schränkchen hat ja gar kein Schloß,« sagte die Mutter.
»Guter Gott!« rief Fräulein Rachel »Sind wir hier in einem Hotel? Oder sind hier Diebe im Hause?«
Ohne von diesen Worten Notiz zu nehmen, wünschte Mylady den Herren gute Nacht, wandte sich dann zu Fräulein Rachel, küßte sie und fragte: »Soll ich nicht lieber den Diamanten diese Nacht zu mir nehmen?«
Fräulein Rachel war über diesen Vorschlag so entrüstet, wie sie vor zehn Jahren über die Zumuthung gewesen sein würde, sich von ihrer Lieblingspuppe zu trennen. Mylady sah, daß diesen Abend nicht vernünftig mit ihr zu reden sei.
»Rachel, komme morgen früh, so bald Du aufgestanden bist, zu mir in mein Zimmer! Ich habe Dir etwas zu sagen.«
Mit diesen Worten verließ sie uns langsam, ihren eigenen Gedanken nachhängend, die allem Anschein nach nicht sehr beruhigender Natur waren.
Nach ihr sagte auch Fräulein Rachel den Herren gute Nacht.
Sie gab zuerst Herrn Godfrey, der am anderen Ende der Halle stand und sich ein Bild ansah, die Hand, und wandte sich dann zu Herrn Franklin, der noch immer ermüdet und schweigsam in seiner Ecke saß.
Was sie mit einander redeten kann ich nicht sagen. Da ich aber ganz in der Nähe des alten großen Spiegels mit seinem Rahmen von schwerem Eichenholz stand, sah ich in demselben, wie sie das Medaillon, das ihr Herr Franklin geschenkt hatte, verstohlen aus ihrem Busen zog und es ihm, bevor sie die Halle verließ, mit einem sehr ausdrucksvollen Lächeln zeigte.
Dieser Vorfall machte mich in dem Vertrauen auf mein eigenes Urtheil etwas wankend. Ich fing an zu glauben, daß Penelope am Ende doch in Betreff der Neigung ihrer Herrin Recht haben könnte. Sobald Herr Franklin wieder für etwas Anderes in der Welt Augen hatte, wurde er meiner ansichtig. Sein wankelmüthiges Temperament, das ihn seine Ansichten über alle Dinge fortwährend wechseln ließ, hatte ihn auch in Betreff der Indier schon wieder zu einer neuen Ansicht gelangen lassen.
»Betteredge,« sagte er, »ich glaube fast, daß ich es mit dem, was Herr Murthwaite bei unserer Unterhaltung unter den Büschen gesagt hat, zu ernst genommen habe; ich bin versucht zu glauben, daß er sich mit einer Jagdgeschichte über uns lustig gemacht hat. Wollen Sie wirklich die Hunde loslassen?«
»Ich will ihnen ihr Halsband abnehmen, Herr Franklin,« antwortete ich, »und es ihnen möglich machen, sich während der Nacht frei zu bewegen, wenn sie in ihrer Nase eine Aufforderung dazu finden sollten.«
»Gut,« sagte Herr,Franklin, »wir wollen morgen weiter sehen. Betteredge; ich habe durchaus keine Lust, meine Tante ohne sehr dringende Gründe zu beunruhigen. Schlafen Sie wohl!«
Er sah so erschöpft und blaß aus, als er mir gute Nacht sagte und sein Licht ergriff, um in sein Zimmer zu gehen, daß ich ihm rieth, ein wenig Cognac und Wasser als Schlaftrunk zu nehmen.
Herr Godfrey, der vom andern Ende der Halle her auf uns zutrat, unterstützte diesen Vorschlag und drang in der freundschaftlichsten Weise in Herrn Franklin, vor dem Schlafengehen noch Etwas zu sich zu nehmen.
Ich thue dieser geringfügigen Umstände nur deshalb Erwähnung, weil es mir nach Allem, was ich an diesem Tage gesehen und gehört hatte, Vergnügen machte zu beobachten, daß unsere beiden Herren noch auf ebenso gutem Fuße standen wie vorher. Weder ihr Wortkampf, den Penelope im Salon mit angehört hatte, noch ihre Rivalität in der Bewerbung um Miß Rachels Neigung schien ihr gutes Verhältniß beeinträchtigt zu haben. Beide hatten ein glückliches Temperament und Beide waren Männer von Welt. Und das ist ein entschiedener Vorzug der Gebildeten, daß sie bei Weitem nicht so zanksüchtig sind wie Ungebildete.
Herr Franklin dankte für Cognac und Wasser und ging mit Herrn Godfrey hinaus, Beide in ihre neben einander liegenden Zimmer. Kaum oben angelangt, wurde aber Herr Franklin schon wieder, wie gewöhnlich, anderen Sinnes.
»Vielleicht brauche ich es doch während der Nacht.« rief er mir hinunter: »Schicken Sie mir etwas Cognac herauf!«
Ich schickte Samuel mit Cognac und Wasser hinauf, ging dann in den Hof und nahm den Hunden ihre Halsbänder ab. Beide schienen höchst erstaunt, sich zu so später Nachtstunde losgemacht zu sehen und sprangen wie ein paar junge Hunde auf mich los; der Regen aber kühlte sie bald wieder ab. Beide tranken ein wenig Wasser und krochen dann wieder in ihr Hundehaus zurück. Als ich wieder in’s Haus trat, bemerkte ich am Himmel Zeichen, welche eine Wendung des Wetters zum Bessern andeuteten. Augenblicklich regnete es noch heftig und der Boden war völlig aufgeweicht. Samuel und ich gingen durch’s ganze Haus und schlossen alle Thüren wie gewöhnlich. Ich untersuchte Alles selbst und überließ meinem Adjutanten bei dieser Gelegenheit nichts. Alles war sicher und wohl verwahrt, als ich zwischen Mitternacht und ein Uhr Morgens meine alten Glieder zur Ruhe brachte.
Die Anstrengungen des Tages waren, glaube ich, ein wenig zu viel für mich gewesen; wenigstens hatte ich diese Nacht einen Anfall von Herrn Franklin’s Krankheit. Erst bei Sonnenaufgang schlief ich endlich ein. Bis dahin aber hatte Grabesstille im Hause geherrscht. Kein Laut war vernehmbar, als das Fallen des Regens und das Rauschen des Windes in den Zweigen.
Ungefähr um halb acht Uhr erwachte ich und öffnete mein Fenster, um in einen schönen, sonnigen Morgen zu blicken. Die Uhr hatte acht geschlagen, und ich war eben hinausgetreten, um die Hunde wieder anzuketten, als ich plötzlich das Rauschen eines Frauenkleides aus der Treppe hinter mir vernahm. Ich drehte mich um und sah Penelope wie von Sinnen auf mich losstürzen »Vater!« schrie sie, »um Gottes willen! komm heraus, der Diamant ist fort!«
»Bist Du von Sinnen?« fragte ich.
»Fort!« sagte sie, »fort! Kein Mensch weiß, wie. Komm selbst hinaus und sieh!«
Sie schleppte mich hinter sich her in das Wohnzimmer unseres Fräuleins, das an ihr Schlafcabinet stieß. Da stand Fräulein Rachel an der Schwelle ihres Schlafzimmers, fast so weiß im Gesicht wie das weiße Morgengewand, das sie trug. Da stand auch das indische Schränkchen offen da, eines der Schuhfächer desselben war weit aufgezogen.
»Da sieh!« sagte Penelope, »ich habe selbst gestern Abend gesehen, wie Fräulein Rachel ihren Diamanten hineinlegte.« Ich trat an das Schränkchen. Das Schubfach war leer.
»Ist das wahr, Fräulein?« sagte ich.
Mit einem Blick und einer Stimme, die nicht ihr anzugehören schienen, antwortete Fräulein Rachel, wie meine Tochter geantwortet hatte: »Der Diamant ist fort.«
Mit diesen Worten zog sie sich in ihr Schlafzimmer zurück und verschloß dasselbe hinter sich.
Bevor wir noch hatten überlegen können, was zu thun sei, trat Mylady ein, die meine Stimme in dem Wohnzimmer ihrer Tochter vernommen hatte und begierig war, zu erfahren, was vorgefallen sei. Bei der Nachricht von dem Verschwinden des Diamanten schien sie wie versteinert; dann ging sie an die Thür von Fräulein Rachel’s Schlafzimmer und verlangte eingelassen zu werden. Fräulein Rachel öffnete.
Die Schreckensbotschaft, die wie Feuerlärm durch das Haus lief, erreichte zunächst die beiden Herren. Herr Godfrey war der Erste, der aus seinem Zimmer trat. Alles, was er that, als er von dem Vorgefallenen hörte, war, daß er seine Hände in einer Art von Verzweiflung in die Höhe hielt, was eben nicht sehr für seine Geistesgegenwart sprach.
Herr Franklin, von dessen klarem Kopfe ich zuversichtlich guten Rath in dieser Sache erwartet hatte, schien nicht weniger rathlos als sein Vetter, als er die Nachricht vernahm. Merkwürdiger Weise hatte er die vorige Nacht gut geschlafen, und der ungewohnte Genuß des Schlafes hatte ihn, wie er selbst sagte, anscheinend dumm gemacht; Als er jedoch seinen Kaffee getrunken hatte, den er nach ausländischer Sitte immer einige Stunden vor dem Frühstück nahm, klärte sich sein Kopf auf, seine scharfsinnige Seite trat wieder hervor und er nahm die Sache entschlossen und geschickt in folgender Weise in die Hand:
Er ließ zuerst die Dienerschaft zusammenkommen und befahl, alle Thüren und Fenster des Erdgeschosses, mit Ausnahme der Hauptthür die ich eben geöffnet hatte, völlig unberührt zu lassen, wie wir sie am Abend zuvor verschlossen hatten. Demnächst forderte er seinen Vetter und mich auf, uns, bevor wir irgend einen weitern Schritt thäten, zu überzeugen, daß der Diamant nicht irgendwohin gefallen sei, vielleicht hinter das Schränkchen oder hinter den Tisch, auf, welchem das Schränkchen stand.
Nachdem Herr Franklin beide Stellen durchsucht und nichts gefunden, dann Penelope befragt und nichts von ihr erfahren als das Wenige, was sie mir bereits mitgetheilt hatte, schlug er vor, nun Fräulein Rachel selbst zu befragen, und schickte Penelope ab, an ihre Schlafstubenthür zu klopfen. Mylady öffnete und schloß die Thür wieder hinter sich. Den nächsten Augenblick hörten wir, wie die Thür von innen von Fräulein Rachel wieder verriegelt wurde. Mylady kam wieder zu uns herein und sah ganz verstört und unglücklich aus. »Der Verlust des Diamanten scheint Rachel ganz außer sich gebracht zu haben,« sagte sie zu Herrn Franklin, »sie weigerte sich in der auffallendsten Weise, selbst mit mir davon zu reden; Sie können sie in diesem Augenblicke unmöglich sehen.«
Nach diesen Worten Mylady’s, welche unsere Verwirrung nur zu vermehren geeignet waren, gewann sie ihre Fassung wieder und handelte mit ihrer gewöhnlichen Entschlossenheit »Ich fürchte, da wird nicht zu helfen sein,« sagte sie ruhig. »Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl, als nach der Polizei zu schicken.«
»Und das Erste, was die Polizei zu thun haben wird,« fügte Herr Franklin ergänzend hinzu, »ist, die indischen Jongleurs zu verhaften, die gestern Abend hier ihre Künste producirten.«
Mylady und Herr Godfrey, denen von dem, was Herr Franklin und ich wußten, nichts bekannt war, schienen Beide erschreckt und erstaunt.
»Ich habe jetzt keine Zeit, mich näher zu erklären,« fuhr Herr Franklin fort, »ich kann Ihnen nur kurz soviel sagen, daß die Indier unzweifelhaft den Diamanten gestohlen haben. Geben Sie mir einen« Empfehlungsbrief an ein Mitglied des Magistrats in Frizinghall,« sagte er zu Mylady gewandt, »in welchem Sie einfach erklären, daß ich Ihre Interessen und Wünsche vertrete und lassen Sie mich auf der Stelle damit wegreiten. Unsere Chance, der Diebe habhaft zu werden, kann durch den Verlust einer einzigen Minute gefährdet sein.« (NB.: gleichviel, ob es die französische oder englische Seite war, jedenfalls schien er jetzt die rechte Seite hervorgekehrt zu haben; es fragte sich nur, wie lange es dauern würde.)
Er setzte Tinte, Feder und Papier vor seine Tante hin, welche, wie mir schien, den von ihm verlangten Brief ungern schrieb. Wenn es möglich gewesen wäre, von einem solchen Vorfalle, wie dem Verlust eines 20,000 Lstr. werthen Edelsteins keine Notiz zu nehmen, so würde Mylady, bei ihrer Meinung über ihren verstorbenen Bruder und ihrem Mißtrauen gegen sein Geburtstagsgeschenk, am liebsten, glaube ich, die Diebe mit ihrem Mondstein in Ruhe gelassen haben. Ich ging darauf mit Herrn Franklin in die Ställe und benutzte diese Gelegenheit ihn zu fragen, wie nach seiner Meinung wohl die Indier, auf die ich natürlich ebenso starken Verdacht hatte wie er, in das Haus gelangt sein könnten.
Einer von ihnen, meinte er, hätte sich bei der Verwirrung, die bei Aufbruch der Gesellschaft am gestrigen Abend entstanden sei, in’s Haus schleichen können.
»Der Kerl mag unter dem Sopha gelegen haben, während meine Tante und Fräulein Rachel sich darüber unterhielten, wohin man den Diamanten während der Nacht legen solle; er hätte dann nur zu warten nöthig gehabt, bis es im Hause stille geworden, und ihn dann aus dem Schränkchen wegnehmen können.«
Mit diesen Worten rief er dem Stallknecht zu, das Thor zu öffnen und ritt davon.
Das schien die einzige rationelle Erklärung zu sein. Aber wie war es dem Diebe gelungen, wieder aus dem Hause zu kommen? Ich hatte die Hauptthür, als ich sie am Morgen öffnen wollte, verschlossen und verriegelt gefunden, wie ich sie am Abend zuvor verlassen hatte. Die übrigen Thüren und Fenster waren noch diesem Augenblick so fest verschlossen wie vorher, und die Hunde, —— angenommen der Dieb hätte sich aus einem der Fenster des oberen Stockwerks herablassen können, wie konnte er unbemerkt an den Hunden vorbeikommen? Hatte er einschläfernde Bissen für sie bereit gehabt?
Als ich eben mit diesem Gedanken beschäftigt war, kamen die Hunde selbst um die Ecke auf mich zu gerannt, wälzten sich vor mir in dem nassen Grase so munter und ausgelassen, daß es nicht leicht war, sie zum Pariren zu bringen und sie wieder anzuketten. Je mehr ich mir die Sache überlegte, desto weniger befriedigend erschienen mir Herrn Franklins Erklärungen.
Wir frühstückten. Einerlei, was in einem Hause vorgeht: Raub und Mord: gefrühstückt muß werden. Als wir fertig waren, schickte Mylady nach mir und ich fand mich nun genöthigt, ihr Alles in Betreff der Indier und ihres Complottes. was ich bisher vor ihr verheimlicht hatte, zu erzählen.
Als eine Frau von großer Entschlossenheit überwand sie sehr bald den ersten erschreckenden Eindruck dessen, was ich ihr mitzutheilen hatte. Ihr Gemüth schien viel besorgter über den Zustand ihrer Tochter als über die heidnischen Räuber und ihre Verschwörung.
»Sie wissen,« sagte Mylady zu mir, »wie sonderbar Rachel und wie verschieden ihr Benehmen bisweilen von dem anderer junger Mädchen ist. Aber in ihrem ganzen Leben habe ich sie noch nicht so sonderbar und so verschlossen gefunden, wie bei dieser Gelegenheit.
Der Verlust ihres Edelsteins schien sie fast um ihren Verstand gebracht zu haben. Wer hätte es für möglich halten sollen, daß dieser schreckliche Diamant in so kurzer Zeit eine solche Umwandlung bei ihr würde bewirken können!«
Es war in der That sonderbar genug. Im Allgemeinen machte sich Fräulein Rachel bei Weitem nicht so viel aus Schmucksachen und Spielereien, wie die meisten jungen Mädchen; aber jetzt saß sie noch immer untröstlich in ihrem Schlafzimmer. Ich muß freilich bekennen, daß sie nicht die einzige Person im Hause ist, die ihre Fassung verloren hatte.
Herr Godfrey z. B. obgleich seinem Beruf nach eine Art Generaltröster, schien sich selbst völlig verloren zu haben. Da es ihm an erheiternder Gesellschaft und an Gelegenheit fehlte, zu erproben, was seine Erfahrungen mit unglücklichen Frauen zur Aufrichtung Fräulein Rachels vermögen würden, ging er in Haus und Garten unbehaglich und zwecklos aus und ab und hin und her. Er war sich offenbar nicht einig, was er nach dem unglücklichen Vorfall thun, ob er die Familie in ihrer gegenwärtigen Lage von der Last, ihn als Gast zu beherbergen, befreien, oder ob er im Hinblick auf die Möglichkeit, sich durch seine geringen Dienste nützlich zu machen, noch länger bleiben solle. Er entschied sich endlich für das Letztere, da es ihm angemessener schien, eine Familie in einer so eigenthümlichen Situation nicht zu verlassen. Besondere Lagen des Lebens lassen den wahren Character eines Mannes am besten erkennen. Die hier vorliegenden Umstände zeigten Herrn Godfrey von schwächerem Character, als ich ihm zugetraut hatte.
Die weiblichen Dienstboten standen mit Ausnahme Rosanna Spearman’s, die für sich allein blieb, in den Ecken umher und flüsterten sich einander ihre Vermuthungen zu, wie es die Art des schwächeren Geschlechtes ist, wenn irgend etwas Außerordentliches in einem Hause passirt. Ich selbst muß bekennen, daß ich höchst aufgeregt und schlecht gelaunt war. Der verwünschte Mondstein hatte uns allen die Köpfe verdreht.
Kurz vor 11 Uhr kam Herr Franklin zurück. Allem Anscheine nach war während der Zeit seiner Abwesenheit unter dem Gewicht der Ereignisse die entschlossene Seite in ihm wieder unterlegen. Er war im Galopp fortgeritten und kam im Schritt zurück. Beim Fortreiten war er wie von Eisen gewesen, bei der Rückkehr war er wie von Watte.
»Nun,« sagte Mylady, »kommt die Polizei?«
»Ja,« erwiderte Herr Franklin, »die Leute erklärten, sie würden, der Oberbeamte der Local-Polizei Seegreaf mit zwei seiner Unterbeamten, mir rasch zu Wagen folgen. Uebrigens wird die Sache nur eine Form sein, der Fall ist hoffnungslos.«
»Wie? haben sich die Indier davon gemacht?« fragte ich.
»Die armen Indier sind höchst unschuldigerweise verhaftet worden, « sagte Herr Franklin; » sie sind so unschuldig wie ein neugeborenes Kind.«
»Meine Idee, daß Einer von Ihnen sich im Hause versteckt haben könnte, ist, wie alle meine übrigen Ideen, in Rauch aufgegangen.«
»Es ist erwiesen, daß das völlig unmöglich ist.«
Nachdem Herr Franklin uns durch diese total neue Wendung in der Mondstein-Angelegenheit in Erstaunen gesetzt hatte, nahm unser junger Herr Platz und erklärte sich auf die Bitte seiner Tante näher.
Es schien, daß die entschlossene Seite bei ihm bis Frizinghall vorgehalten hatte: Er hatte der Magistratsperson den ganzen Fall klar vorgelegt und diese hatte sofort nach der Polizei geschickt. Die über die Indier alsbald angestellte Untersuchung ergab, daß sie nicht den leisesten Versuch gemacht hatten, die Stadt zu verlassen. Aus ferneren Nachforschungen ging hervor, daß alle drei am Abend zuvor zwischen 10 und 11 Uhr mit dem Knaben nach Frinzighall zurückgekehrt waren, was, wenn man die Zeit und die Entfernung berücksichtigte, zugleich bewies, daß sie direct von hier dahin gegangen waren, nachdem sie auf unserer Terrasse ihre Künste producirt hatten. Noch später, um Mitternacht, als die Polizei das Logirhraus, in dem sie wohnte, besichtigte, fanden sie sich dort alle drei mit ihrem kleinen Knaben wie gewöhnlich bei einander.
Bald nach Mitternacht hatte ich selbst das Haus fest verschlossen. Einen besseren Beweis zu Gunsten der Indier konnte es nicht wohl geben. »Die Magistratsperson erklärte, daß bis jetzt auch nicht einem Schatten von Verdacht gegen die Indier Veranlassung sei. Da es jedoch möglich war, daß die Polizei bei näherer Untersuchung unserer Angelegenheit zu Entdeckungen in betreff der Jongleurs gelangen konnte, so ließ der Magistrat sich bereit finden, sie als Vagabonden verhaften zu lassen und dieselben eine Woche lang zu unserer Verfügung zu halten. Sie hatten ohne es zu wissen irgend etwas, ich weiß nicht mehr was, in der Stadt begangen, was diese Verhaftung gesetzlich möglich machte.
Alle menschlichen Einrichtungen, die Gerechtigkeit nicht ausgenommen, lassen sich, wenn man sie nur richtig anfaßt, ein wenig dehnen. Die würdige Magistratsperson war ein alter Freund von Mylady und so wurde das indische Pack auf eine Woche ins Gefängniß gebracht.
So lautete Herrn Franklins Bericht über die Ereignisse in Frizinghall. Der indische Schlüssel zu dem Geheimniß des verlorenen Diamanten war allem Anschein nach in unseren eigenen Händen zerbrochen. Waren aber die Jongleurs unschuldig, wer in aller Welt konnte den Diamanten aus Fräulein Rachels Schubfach genommen haben?
Zehn Minuten später traf zu unserer größten Beruhigung der Oberbeamte Seegreaf in unserem Hause ein.
Er führte sich mit der Mittheilung ein, daß er Herrn Franklin in der Sonne sitzend (vermuthlich im Genusse seiner italienischen Seite) auf der Terrasse getroffen und daß derselbe ihn darauf aufmerksam gemacht habe, daß die Untersuchung, noch ehe sie ihren Anfang genommen, hoffnungslos sei.
Für eine Familie in unserer Lage war der Oberbeamte der Polizei von Frizinghall die beruhigendste Persönlichkeit, die man sich wünschen konnte. Herr Seegreaf war ein langer und stattlicher Mann von militairischen Manieren Er hatte eine schöne gebietende Stimme und ein sehr entschlossenes Auge und trug einen großen Frack, der bis an den Hals fest zugeknöpft war.
»Ich bin der Mann, den Sie brauchen,« stand ihm auf der Stirn geschrieben und er ertheilte die Befehle an seine Unterbeamten in einem Tone, der deutlich zeigte, daß mit diesem Manne nicht zu spaßen sei.
Er fing damit an, alle Räume in und außer dem Hause zu besichtigen. Das Ergebniß dieser Untersuchung war, daß keine Diebe von außen eingebrochen sein konnten und daß folglich der Raub von einer Person im Hause begangen sein müsse.
Ich überlasse es dem Leser, sich den Zustand vorzustellen, in welchen die offizielle Ankündigung dieses Ergebnisses der Untersuchung die Dienstboten versetzte.
Der Oberbeamte beschloß, die weitere Nachforschung mit einer Durchsuchung des Boudoirs zu beginnen und Dann die Sachen der Dienstboten zu durchsuchen. Zu gleicher Zeit postirte er einen seiner Leute auf die Treppe, welche zu den Schlafzimmern der Domestiken führte mit der Ordre, bis auf Weiteres Niemanden vorbeizulassen.
Bei dieser letzteren Procedur gerieth das schwächere Geschlecht sofort außer sich. Sie platzten aus ihren Ecken hervor, rannten Alle nach Fräulein Rachels Zimmer, diesmal Rosanna Spearman mit sich fortreißend, stürmten auf den Oberbeamten Seegreaf los und verlangten von ihm mit Gesichtern, nach denen man sie alle für gleich schuldig hätte halten können, daß er auf der Stelle erklären möge, wen von ihnen er im Verdacht habe. Aber der Oberbeamte zeigte sich auch dieser Situation gewachsen; er sah sie mit seinem entschlossenen Auge an und brachte sie mit seiner militairischen Stimme zum Schweigen.
»Macht, daß Ihr wieder hinunterkommt, ihr Weiber alle zusammen! ich will Euch hier nicht haben. Da seht,« sagte er, indem er auf einen kleinen Fleck an der Decorationsmalerei auf Fräulein Rachels Thür an der äußern Ecke gerade unter dem Schloß hinwies, »seht, was für Unheil eure Röcke bereits angerichtet haben! Macht, daß ihr wegkommt, rasch!«
Rosanna Spearman, die ihm und dem kleinen Fleck an der Thür zunächst stand, ging mit gutem Beispiele voran und eilte zu ihrer Arbeit; die Andern folgten ihr.
Der Oberbeamte fuhr mit seinen Durchsuchung des Zimmers fort und fragte mich, da er Nichts fand, wer den Raub zuerst entdeckt habe.
»Das war meine Tochter.«
Nach ihr wurde daher geschickt. Der Oberbeamte ging Anfangs ein wenig zu hart gegen meine Tochter vor.
»Komm her, mein Kind,« sagte er; »gieb Acht, daß Du die Wahrheit sagst.«
Penelope fuhr gegen ihn los. »Ich habe mein Leben lang nicht gelernt, die Unwahrheit zu sagen, Herr Polizei! Und wenn Vater dabei stehen und es ruhig mit anhören kann, wie ich der Lüge und des Diebstahls beschuldigt und aus meinem eigenen Schlafzimmer ausgesperrt werde und um meinen guten Ruf gebracht werden soll, der Alles ist, was ein armes Mädchen, wie ich, hat, so ist er nicht der gute Vater, für den ich ihn gehalten habe.«
Ein zu rechter Zeit von mir gesprochenes Wort brachte den Vertreter der Gerechtigkeit und Penelope auf einen bessern Fuß mit einander. Die Fragen und Antworten gingen nun ganz glatt vor sich und führten zu keinem Resultat. Das Letzte, was meine Tochter am Abend vorher gesehen, war gewesen, daß Fräulein Rachel den Diamanten ins Schubfach gelegt hatte. Als sie am nächsten Morgen um 8 Uhr Fräulein Rachel eine Tasse Thee in ihr Zimmer gebracht, hatte sie das Schubfach offen und leer gefunden und sofort das Haus alarmirt. Und damit endete Penelopens Aussage.
Darauf verlangte der Oberbeamte Fräulein Rachel selbst zu sprechen. Penelope meldete dieses Verlangen durch die Thür. Die Antwort gelangte auf demselben Wege zu uns.
»Ich habe dem Polizeibeamten nichts zu sagen, ich kann Niemanden sehen.«
Unser erfahrener Polizeibeamter sah ebenso überrascht als beleidigt aus, als er diese Antwort vernahm. Ich sagte ihm, mein junges Fräulein sei unwohl und bat ihn, ein bischen zu warten, um sie später sprechen zu können. Dann gingen wir wieder hinunter, wo wir Herrn Godfrey und Herrn Franklin, die eben durch die Halle gingen, trafen. Die beiden Herren wurden als Hausgenossen aufgefordert zu erklären, ob sie irgend etwas die Angelegenheit betreffend mitzutheilen hätten, aber Keiner von Beiden wußte etwas. Er fragte, ob sie irgend einen verdächtigen Lärm während der vorigen Nacht gehört hätten? Sie hatten nichts gehört, als das Herabfallen des Regens. Er fragte weiter, ob ich, der länger gewacht hatte, auch nichts gehört habe? Nichts. Als dieses Inquiriren zu Ende war, flüsterte mir Herr Franklin, der noch bei der Ansicht von der gänzlichen Vergeblichkeit der ganzen Untersuchung zu beharren schien, zu: »Der Mann wird uns nicht das Mindeste helfen; der Oberbeamte Seegreaf ist ein Esel.« Herr Godfrey seinerseits flüsterte mir zu: »Der Mann ist ein ausgezeichneter Beamter, Betteredge; ich habe das größte Vertrauen zu ihm.« So viel Köpfe, so viel Sinne, wie schon ein alter Weiser vor meiner Zeit gesagt hat.
Im Fortgang der Untersuchung ging der Beamte wieder mit mir und meiner Tochter in’s Bondoir zurück. Sein Zweck war in diesem Augenblick, zu entdecken, ob irgend ein Möbel während der Nacht von seinem gewöhnlichen Platze gerückt worden sei, da seine vorher vorgenommene Durchsuchung offenbar nicht gründlich genug gewesen war, um ihn über diesen Punkt zu vergewissern. Während wir an Tischen und Stühlen herumarbeiteten, öffnete sich nun die Thür des Schlafzimmers Fräulein Rachel, die sich bis dahin geweigert hatte, irgend Jemanden zu sehen, kam jetzt zu unserm Erstaunen aus eigenem Antriebe zu uns herein. Sie nahm ihren Gartenhut von einem Stuhl und ging dann gerade aus Penelope los und fragte diese: »Hat Herr, Franklin Blake Dich diesen Morgen mit einer Botschaft zu mir geschickt?«
»Ja, Fräulein!«
»Er wollte mich sprechen, nicht wahr?«
»Ja, Fräulein!«
»Wo ist er jetzt?«
Da ich eben Stimmen auf der Terrasse hörte, so blickte ich zum Fenster hinaus und sah, wie die beiden Herren auf der Terrasse auf- und abspazierten. Ich antwortete für meine Tochter und sagte: »Herr Franklin ist auf der Terrasse.«
Ohne ein Wort weiter zu sagen, ohne die mindeste Notiz von dem Beamten zu nehmen, der einen vergeblichen Versuch machte, mit ihr zu reden, bleich der Tod und in ihre eigenen Gedanken versenkt, verließ das Zimmer und ging zu ihrem Vetter hinab. So sehr es gegen den schuldigen Respect und die gute Sitte war, konnte ich es mir um Alles in der Welt nicht versagen, zum Fenster hinaus zu sehen. Als Fräulein Rachel die Herren auf der Terrasse erreichte, ging sie geradeswegs auf Herrn Franklin zu, scheinbar ohne Herrn Godfrey zu bemerken, der sich daraus zurückzog und die Beiden allein ließ. Sie schien sehr heftig mit Herrn Franklin zu reden. Die Unterhaltung dauerte nur eine kurze Weile, versetzte ihn aber, soweit ich sein Gesicht vom Fenster aus beobachten konnte, in ein unbeschreibliches Erstaunen. Während sie noch mit einander sprachen, erschien Mylady auf der Terrasse. Als Fräulein Rachel ihrer ansichtig wurde, flüsterte sie Herrn Franklin noch ein paar Worte zu und kehrte dann rasch ins Haus zurück, noch ehe ihre Mutter mit ihr hatte reden können. Mylady, die selbst erstaunt war und das Erstaunen« des Herrn Franklin sah, redete ihn an. Herr Godfrey trat zu ihnen und nahm an der Unterhaltung Theil. Herr Franklin ging mit Beiden etwas auf die Seite und theilte ihnen vermuthlich mit, was vorgefallen war, denn Beide standen plötzlich wie erschrocken still. Ich hatte diesen Vorgang eben beobachtet, als die Thür des Boudoirs sich heftig öffnete. Fräulein Rachel ging mit wildem Blick und flammenden Wangen, aufgeregt und zornig, rasch in ihr Schlafzimmer. Der Polizeibeamte machte abermals einen Versuch, sie zu befragen. An der Schwelle ihres Schlafzimmers drehte sie sich nach ihm um und rief heftig: »Ich habe nicht nach Ihnen geschickt ich will nichts von Ihnen, mein Diamant ist verloren; weder Sie noch irgend Jemand wird ihn wiederfinden.« Mit diesen Worten ging sie in ihr Zimmer und verriegelte die Thür hinter sich. Penelope die der Thür zunächst stand, hörte, wie sie in ihrem Zimmer sofort Thränen vergoß, die nur zuweilen von Zornausbrüchen unterbrochen wurden. Was hatte das zu bedeuten? Ich sagte dem Beamten, Fräulein Rachel sei durch den Verlust ihres Edelsteines ganz außer Fassung gebracht. Besorgt für die Ehre der Familie, wie ich war, berührte es mich peinlich, mein junges Fräulein sich selbst gegen einen Polizeibeamten vergessen zu sehen, und ich entschuldigte daher ihr Benehmen so gut ich konnte.
Fräulein Rachels ungewöhnliches Benehmen beunruhigte mich mehr als ich sagen kann. Nach den Worten, die sie an der Schwelle ihres Schlafzimmers gesprochen, mußte ich ich schließen, daß sie das Herbeiholen der Polizei als eine tödtliche Beleidigung gegen sich betrachte, und das Erstaunen des Herrn Franklin auf der Terrasse war vermuthlich dadurch veranlaßt worden, daß sie ihm ihren Unwillen über seine Mitwirkung bei jenem Herbeiholen der Polizei ausgedrückt hatte. Wenn dieser Schluß richtig war, so durfte man billig fragen, warum sie bei dem Verlust ihres Diamanten etwas gegen die Anwesenheit von Leuten im Hause habe, deren eigentliches Geschäft es war, das Verlorene für sie wiederzufinden, und woher in aller Welt sie wissen konnte, daß der Mondstein nicht wieder gefunden würde.
Wie die Dinge standen, war von Niemandem im Hause eine Antwort auf diese Fragen zu erwarten. Herr Franklin schien es für eine Ehrensache zu halten, einem Dienstboten, selbst einem so alten Diener wie ich es war, nichts von dem zu wiederholen, was Fräulein Rachel ihm auf der Terrasse gesagt hatte.
Herr Godfrey, der als Gentleman und ein Verwandter von Herrn Franklin wahrscheinlich ins Vertrauen gezogen worden war, respectirte dieses Vertrauen, wie es seine Pflicht war.
Mylady, die unzweifelhaft gleichfalls um das Geheimniß wußte und die allein zu Fräulein Rachel Zutritt hatte, gestand offen, daß sie nichts mit ihr anzufangen wisse.
»Du machst mich wahnsinnig, wenn Du vom Diamanten sprichst!« Dem ganzen Aufgebot des mütterlichen Einflusses gelang es nicht, mehr als diese Worte aus ihr herauszubringen.
So waren wir denn völlig im Dunkeln über Fräulein Rachel und über den Mondstein. In Betreff des Fräuleins war Mylady außer Stande, uns zu helfen. In Betreff des Mondsteins war Seegreaf, wie der Leser gleich sehen wird, sehr bald mit seinem Latein zu Ende.
Nachdem unser erfahrener Beamter das ganze Boudoir durchstöbert hatte, ohne in oder an den Möbeln Etwas zu entdecken, wandte er sich an mich mit der Frage, ob die Dienstboten im Allgemeinen die Stelle kannten, an die der Diamant während der Nacht gelegt worden sei, oder nicht.
»Um mit mir anzufangen,« antwortete ich, »so habe ich um den Platz gewußt, der Diener Samuel desgleichen; denn er war dabei, als die Herrschaften in der Halle darüber sprachen, wohin der Diamant während der Nacht gelegt werden solle. Meine Tochter ferner wußte ebenfalls darum, wie sie Ihnen bereits gesagt hat. Vielleicht daß Samuel der Sache gegen die anderen Dienstboten Erwähnung gethan hat, oder daß die übrigen Dienstboten das Gespräch durch die Seitenthür der Halle, welche nach der Hintertreppe führt und vielleicht offen stand, selbst mitangehört haben. Es ist also möglich, daß alle Leute im Hause um den Platz, auf dem der Diamant sich in dieser Nacht befand, gewußt haben.«
Da meine Antwort für den Verdacht des Beamten ein weites Feld darzubieten schien, so suchte er dasselbe zunächst durch Erkundigungen über die Charaktere der Dienstboten zu begrenzen.
Ich dachte auf der Stelle an Rosanna Spearman; aber es war weder meines Amtes, noch wünschte ich den Verdacht auf das arme Mädchen zu lenken, deren Rechtlichkeit, so lange ich sie gekannt hatte, über jeden Zweifel erhaben gewesen war. Die Hausmutter in der Besserungs-Anstalt hatte sie Mylady als ein Mädchen bezeichnet, daß ihr früheres Vergehen aufrichtig bereut habe und durchaus vertrauenswürdig sei. Es war die Sache des Beamten, selbst Verdachtsgründe gegen sie aufzufinden, und nur wenn er das gethan haben würde, aber auch nur dann würde es meine Pflicht sein, sagte ich mir, ihm mitzutheilen, wie sie in Mylady’s Dienste gekommen sei.
»Gegen keinen unserer Leute liegt irgend etwas vor,« sagte ich, »und Alle verdienen das Vertrauen, das ihre Herrin zu ihnen zeigt.«
Darauf gab es nur noch eine Sache für Herrn Seegreaf zu thun, nämlich sich selbst über die Persönlichkeiten der Dienstboten zu unterrichten. Einer nach dem Andern wurden sie inquirirt und Einer nach dem Andern hatten Nichts zu sagen und sagten dieses Nichts, sofern sie dem weiblichen Geschlecht angehörten, mit großer Ausführlichkeit und mit einem sehr entschiedenen Ausdruck der Entrüstung über das auf ihre Schlafzimmer gelegte Sequester.
Nachdem die Uebrigen wieder in die Küchenräume hinuntergeschickt waren, wurde Penelope vorgefordert und allein zum zweiten Male inquirirt.
Der kleine Zornausbruch meiner Tochter bei dem ersten Verhör in dem Boudoir, bei dem sie sich aus der Stelle beschuldigt geglaubt hatte, schien einen ungünstigen Eindruck auf unsern Polizeibeamten hervorgebracht zu haben. Ersichtlich beschäftigte ihn noch der Gedanke, daß sie die letzte Person gewesen war, welche den Diamanten am vorigen Abend gesehen hatte.
Als das zweite Verhör vorüber war, kam meine Tochter ganz außer sich zu mir. Es war kein Zweifel mehr, der Beamte hatte ihr so gut wie gesagt, daß sie die Diebin sei. Ich konnte kaum glauben, daß er ein solcher Esel sei, selbst wenn ich mir Herrn Franklin’s Auffassung aneignete. Aber gewiß ist, daß er meine Tochter mit keinem freundlichen Auge ansah.
Ich lachte über die Sache als über etwas, das zu abgeschmackt war, um ernsthaft behandelt zu werden. Innerlich aber war ich, glaube ich, närrisch genug, gleichfalls sehr aufgebracht darüber zu sein. Die Sache war in der That recht fatal. Meine Tochter setzte sich, ihr Gesicht mit der Schürze bedeckend, in eine Ecke und weinte bittetlich.
Vielleicht finden meine Leser das närrisch und finden, sie hätte warten können, bis er sie offen anklagte. Nun ja. Als gerechter und unparteiischer Mensch gebe ich das zu. Der Beamte hätte billig bedenken müssen, —— Ach, was! Hol’ ihn der Teufel!
Der nächste und letzte Schritt in der Untersuchung brachte die Dinge, wie man es nennt, zu einer Krisis. Der Beamte hatte eine Besprechung mit Mylady, bei der ich zugegen war. Nachdem er ihr mitgetheilt, daß der Diamant nothwendig von Jemandem im Hause genommen sein müsse, erbat er für sich und seine Leute die Erlaubniß, die Zimmer und Sachen der Dienstboten auf der Stelle durchsuchen zu dürfen.
Meine großmüthige und edeldenkende Herrin weigerte sich, uns wie Diebe behandeln zu lassen.
»Ja; werde niemals meine Zustimmung dazu geben,« sagte sie, »daß die treuen Leute, die in meinen Diensten stehen, so behandelt werden.«
Der Herr Oberbeamte verneigte sich mit einem Blick auf mich, in dem deutlich zu lesen stand: »Warum haben Sie mich kommen lassen, wenn Sie mir die Hände binden wollen?«
Als Chef der Dienerschaft fühlte ich auf der Stelle, daß es unsere Pflicht und Schuldigkeit gegen alle Betheiligten sei, bei dieser Gelegenheit von der Großmuth unserer Herrin keinen Gebrauch zu machen.
»Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet, gnädige Frau,« sagte ich; »aber wir bitten Sie um die Erlaubniß, das zu thun, was bei dieser Gelegenheit das Richtigste ist, indem wir unsere Schlüssel abgeben. Wenn Gabriel Betteredge mit gutem Beispiel vorangeht,« sagte ich, den Oberbeamten Seegreaf an der Thür zurückhaltend, so werden die übrigen Dienstboten folgen; dafür stehe ich Ihnen. Hier übergehe ich" Ihnen, um den Anfang zu machen, meine Schlüssel.«
Mylady ergriff meine Hand und dankte mir mit Thränen in den Augen. Herr Gott! was hätte ich nicht in dem Augenblick darum gegeben, wenn ich den Herrn Seegreaf hätte zu Boden werfen können!
Wie ich es vorhergesagt hatte, folgten die übrigen Dienstboten meinem Beispiel, natürlich mit Widerstreben, aber Alle in derselben Ueberzeugung in der ich gehandelt hatte. Es war der Mühe werth, die Frauenzimmer anzusehen. als die Polizeibeamten in ihren Sachen herumwühlten. Die Köchin sah aus, als ob sie den Herrn Oberbeamten lebendig auf dem Rost braten möchte, und die anderen Frauenzimmer, als ob sie ihn, wenn er gar wäre, gern verzehren würden.
Nachdem die Durchsuchung vorüber war und kein Diamant, auch nicht die Spur eines Diamanten sich gefunden hatte, zog sich Herr Seegreaf in ein kleines Zimmer zurück, um mit sich zu Rathe zu gehen, was nun zunächst zu thun sei. Er und seine Leute waren jetzt schon viele Stunden in unserem Hause und hatten uns noch keinen Zoll breit in der Auffindung des Mondsteins oder der Person, auf die man einen begründeten Verdacht werfen könnte, gefördert.
Während der Polizeibeamte noch so schweigend und nachdenklich da saß, wurde ich zu Herrn Franklin in die Bibliothek beordert. Zu meinem unaussprechlichen Erstaunen wurde die Thür des Bibliothekzimmers gerade in dem Augenblick, wo ich die Hand auf den Griff legte, plötzlich von innen geöffnet und heraus trat Rosanna Spearman. Nachdem die Bibliothek am Morgen gefegt und gereinigt war, hatte keines der Hausmädchen irgend etwas mehr im Zimmer zu thun. Ich hielt Rosanna Spearman an und machte ihr auf der Stelle Vorwürfe über ihren Verstoß gegen die häusliche Disciplin.
»Was hast Du zu dieser Tagesstunde in der Bibliothek zu thun?« fragte ich.
»Herr Franklin Blake hat einen seiner Ringe oben fallen lassen,« antwortete Rosanna, »und ich bin in die Bibliothek gegangen, um ihn ihm wieder zu bringen.»
Ein tiefes Roth überflog das Gesicht des Mädchens, als sie mir diese Antwort gab, und sie ging, indem sie den Kopf in den Nacken warf und mir einen hochmüthigen Blick zuwarf, den ich mir auf keine Weise zu erklären wußte. Ohne Zweifel hatten die Vorgänge im Hause allen Frauenzimmern im Hause den Kopf verdreht, aber mit Keiner war eine solche Veränderung vorgegangen, wie allem Anscheine nach mit Rosanna.
Ich fand Herrn Franklin am Bibliothektisch sitzend und schreibend. Er bat mich, sowie ich in’s Zimmer trat, ihm einen Wagen zu besorgen, um nach der Eisenbahnstation zu fahren. Der ernste Ton seiner Stimme überzeugte mich, daß die entschlossene Seite seines Wesens jetzt wieder entschieden die Oberhand gewonnen hatte. Der Wattenmann war verschwunden und der eiserne Mann saß wieder vor mir.
»Wollen Sie nach London, Herr Franklin?« fragte ich.
»Ich will nach London telegraphiren,« sagte er. »Meine Tante hat sich überzeugt, daß wir einen klareren Kopf, als den des Oberbeamten Seegreaf brauchen, um uns zu helfen, und sie hat mir erlaubt, an meinen Vater zu telegraphiren. Er kennt den Polizei-Chef in London und dieser wird uns schon einen Mann schicken, der es versteht, Licht in das Dunkel des Diamanten zu bringen. Beiläufig, da ich gerade von Geheimnissen, spreche,« sagte Herr Franklin mit leiserer Stimme, »ich thabe Ihnen noch etwas zu sagen, bevor Sie nach dem Stall gehen. Lassen Sie aber keinem Menschen etwas davon ahnen: Entweder Rosanna Spearman ist nicht ganz richtig im Kopf, oder sie weiß mehr über den Mondstein, als sie wissen sollte.«
Ich wüßte kaum zu sagen, ob mich diese Worte mehr entsetzten oder mehr betrübten. Wäre ich jünger gewesen, so hätte ich mich über diesen Eindruck gegen Herrn Franklin ausgesprochen; aber wenn man älter wird, eignet man sich eine vortreffliche Gewohnheit an: nämlich in Fällen, wo man seiner Sache nicht ganz gewiß ist, lieber zu schweigen.
»Sie war eben hier, um mir einen Ring zu bringen, den ich in meinem Schlafzimmer hatte fallen lassen,« fuhr Herr Franklin fort. »Als ich ihr gedankt hatte, erwartete ich natürlich, daß sie wieder fortgehen würde. Statt dessen stellte sie sich mir gegenüber an den Tisch und sah mich in der sonderbarsten Weise, halb schüchtern und halb vertraulich an.«
»Das, ist eine komische Geschichte mit dem Diamanten, Herr Franklin!« fing sie plötzlich in einem ängstlich-hastigen Ton an.
Ich sagte: »Ja wohl!« und war begierig zu hören, was sie weiter vorzubringen hatte. Auf mein Ehrenwort, Betteredge, ich glaube, das Mädchen ist nicht richtig im Kopfe. Sie sagte: »Sie werden den Diamanten nie finden, nicht wahr, Herr? nein, so wenig wie« den, der ihn genommen hat; dafür stehe ich!« Dabei nickte sie und lächelte mir zu; aber ehe ich sie noch fragen konnte, was sie damit meine, hörten wir Ihre Schritte vor der Thür.
Ich glaube, sie war bange, von Ihnen hier getroffen zu werden; jedenfalls wurde sie roth und ging rasch hinaus.«
Was in aller Welt hatte Das zu bedeuten? Selbst in diesem Augenblick konnte ich’s nicht über mich gewinnen, ihm die Geschichte des Mädchens zu erzählen. Das wäre beinahe so gut gewesen, als wenn ich ihm gesagt hätte, sie ist die Diebin. Und selbst wenn ich mich darüber ausgesprochen hätte, und selbst angenommen, sie wäre die Diebin gewesen, so war es doch damit um nichts klarer, warum sie gerade Herrn Franklin ihr Geheimniß hatte anvertrauen wollen.
»Ich kann den Gedanken nicht ertragen, das arme Mädchen unglücklich zu machen, nur weil ihre auffallenden Manieren und ihre sonderbare Sprache etwas Verdächtiges haben. Und doch, hätte sie dem Oberbeamten gesagt, was sie mir anvertraut hat, ich fürchte, trotz seiner Beschränktheit würde er ——« hier hielt er inne ——
»Das Beste wird sein,« sagte er, »wenn ich bei der ersten Gelegenheit Mylady zwei Worte über die Sache sage. Mylady nimmt sehr herzlichen Antheil an Rosanna, und am Ende ist das Mädchen doch nur voreilig und albern gewesen. Wenn irgend etwas im Hause begangen worden ist, so denken die weiblichen Dienstboten gern gleich das Schlimmste, sie meinen sich dadurch eine Art Wichtigkeit zu geben. Wenn Jemand im Hause krank ist, so werden sie sicher seinen Tod prophezeien, wenn ein Edelstein verloren ist, so werden sie ganz gewiß prophezeien, daß er nicht wiedergefunden werden wird.«
Diese Art, die Sache anzusehen, welche ich, offen gestanden, bei näherer Erwägung selbst für die richtige hielt, schien Herrn Franklin bedeutend zu erleichtern. Er legte sein Telegramm zusammen und ließ den Gegenstand fallen.
Auf meinem Wege nach dem Stall, wo ich den Ponywagen anspannen lassen wollte, warf ich im Vorbeigehen einen Blick in das Domestikenzimmer, wo die Leute gerade bei Tische saßen; Rosanna Spearman war nicht unter ihnen; als ich mich nach ihr erkundigte, erfuhr ich, daß sie plötzlich unwohl geworden und aus ihr Zimmer gegangen sei, um sich zu Bette zu legen.
»Sonderbar,« bemerkte ich, »sie schien vorhin noch ganz wohl.«
Penelope kam heraus, um mit mir zu gehen. »Bitte Vater,« sagte sie, »sprich nicht so vor den übrigen Leuten. Sie werden dadurch nur in ihrem Mißtrauen gegen Rosanna bestärkt. Das arme Ding härmt sich über Herrn Franklin Blake.«
Von dieser Seite hatte ich das Benehmen des Mädchens noch nicht angesehen. Wenn Penelope Recht hatte, so ließe sich Rosanna’s auffallendes Betragen und ihre sonderbare Sprache genügend dadurch erklären, daß sie in den Tag hineinredete, so lange sie nur Herrn Franklin dahin bringen konnte, sich mit ihr zu unterhalten. Wenn das die richtige Lösung des Räthsels war, so ließ sich damit auch vielleicht ihr übermüthiges Benehmen gegen mich, als sie mir in der Halle begegnete, erklären. Wenn er nur drei Worte mit ihr gesprochen, so hatte sie doch ihren Zweck erreicht —- er hatte sich mit ihr unterhalten.
Ich ließ das Pony anschirren. In der Stimmung, in die mich das höllische Netz von Geheimnissen und Ungewißheiten versetzte, in das wir verstrickt waren, empfand ich es als eine Wohlthat, zu beobachten, wie vortrefflich sich die Riemen und Schnallen des Pferdegeschirrs ineinanderfügten. Wenn man das Pony zwischen die Deichsel gespannt sah, so hatte man einen vollkommen klaren und sicheren Anblick vor sich und das war, wie ich den Leser versichern kann, in unserem Hause nachgerade einer der seltensten Genüsse geworden.
Als ich den Wagen vor die Hauptthür führte, fand ich nicht nur Herrn Franklin, sondern auch Herrn Godfrey und den Oberbeamten Seegreaf auf den Stufen der Treppe meiner wartend. Weiteres Nachdenken hatte den Herrn Oberbeamten, nachdem er in den Zimmern und Sachen der Domestiken vergeblich nach dem Diamanten gesucht, allem Anschein nach zu einem neuen Beschluß geführt. Indem er immer noch bei seiner Ansicht, daß Jemand im Hause den Edelstein gestohlen habe, beharrte, war unser erfahrener Beamter jetzt weiter zu dem Schluß gelangt, daß der Dieb (er hütete sich wohl, Penelope zu nennen, wenns er auch vielleicht an sie dachte) im Einverständniß mit den Indiern gehandelt habe, und proponirte demgemäß seine Untersuchungen jetzt auf die Jongleurs im Gefängniß von Frizinghall zu erstrecken. Als Herr Franklin von dieser neuen Wendung der Angelegenheit gehört, hatte er sich erboten, den Beamten nach der Stadt zu fahren, von wo aus er ebenso leicht wie von der Station nach London telegraphiren konnte. Herr Godfrey, der noch ebenso fest wie früher an Herrn Seegreaf glaubte und lebhaft wünschte, dem Verhör der Indier beizuwohnen, hatte um Erlaubniß gebeten, den Beamten nach Frizinghall begleiten zu dürfen.
Einer der beiden unteren Polizeibeamten sollte für den Fall, daß sich inzwischen irgend etwas ereignete, bei uns bleiben, der andere sollte mit dem Oberbeamten nach der Stadt zurückkehren. So waren also die vier Plätze im Ponywagen gerade besetzt. Bevor er die Zügel ergriff, um wegzufahren, nahm Herr Franklin mich noch einen Augenblick bei Seite.
»Ich werde mit dem Telegraphiren nach London warten,« sagte er, »bis ich sehe, was das Verhör der Indier ergiebt. Nach meiner festen Ueberzeugung tappt dieser dickköpfige Lokal-Polizeibeamte noch eben so sehr im Dunkeln wie früher und will nur Zeit gewinnen. Die Idee, daß irgend Jemand von unseren Domestiken mit den Indiern im Bunde sei, ist meiner Ansicht nach eine unerhörte Albernheit. Halten Sie sich zu Hause, Betteredge, bis ich zurückkomme, und sehen Sie zu, ob Sie über Rosanna Spearman in’s Klare kommen können. Ich verlange von Ihnen nichts, was Sie in Ihrer eigenen Achtung herabsetzen oder das arme Mädchen schwer kränken müßte. Ich bitte Sie nur, sie schärfer als gewöhnlich zu beobachten. Wir wollen die Sache vor meiner Tante so leicht wie möglich nehmen, aber sie ist von größerer Bedeutung, als Sie denken.«
»Ich weiß,« sagte ich, in der Meinung, daß er von dem Werth des Diamanten rede, »daß es sich um 20,000 Pfund handelt.«
»Es handelt sich vielmehr darum, Rachels Gemüth zu beruhigen,« erwiderte Herr Franklin, »ich bin sehr besorgt um sie.«
Mit diesen Worten ließ er mich plötzlich stehen, wie wenn er jede weitere Unterhaltung zwischen uns abschneiden wollte. Ich glaubte seine Gründe zu verstehen. Eine Fortsetzung unseres Gesprächs hätte mir vielleicht Das offenbaren können, was Fräulein Rachel ihm auf der Terrasse anvertraut hatte. Und so fuhren sie ab nach Frizinghall.
Ich wünschte in Rosanna’s eigenem Interesse ein Paar Worte im Vertrauen mit ihr zu reden, aber die passende Gelegenheit wollte sich nicht darbieten. Sie kam erst zur Theestunde wieder hinunter; sie war unruhig und aufgeregt bekam, wie sie es nennen, einen hysterischen Anfall, mußte auf Mylady’s Ordre etwas flüchtiges Salz nehmen und ward wieder zu Bett geschickt. Der Tag schleppte sich trübselig hin; Fräulein Rachel blieb auf ihrem Zimmer und erklärte, sie sei zu krank, um zum Essen herunter zu kommen. Mylady war so bekümmert über ihre Tochter, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, ihre Besorgniß noch durch den Bericht über das zu steigern, was Rosanna zu Herrn Franklin gesagt hatte. Penelope beharrte bei dem festen Glauben, daß ihr demnächst der Proceß gemacht und sie wegen Diebstahls verurtheilt und transportirt werden würde. Die andern weiblichen Domestiken nahmen ihre Zuflucht zu ihren Bibeln und Gesangbüchern und sahen essigsauer dabei aus, wie es nach meiner Beobachtung meistens den Leuten zu begegnen pflegt, wenn sie sich zu ungewohnten Tageszeiten frommen Uebungen hingeben. Ich selbst konnte mich nicht einmal dazu entschließen, meinen Robinson Crusoe aufzuschlagen. Ich ging in den Hof und setzte, da mich sehnlichst nach ein wenig heiterer Gesellschaft verlangte; meinen Stuhl an das Hundehaus und unterhielt mich mit den Hunden. Eine halbe Stunde vor Tischzeit kamen die beiden Herren von Frizinghall zurück, wo sie mit dem Oberbeamten Seagreaf verabredet hatten, daß er am nächsten Tage wieder zu uns kommen sollte. Sie hatten Herrn Murthwaite, dem indischen Reisenden, in seiner Wohnung in der Nähe der Stadt einen Besuch gemacht. Auf Herrn Franklin’s Ersuchen hatte er sich bereit finden lassen, ihnen mit seiner Kenntniß des Indischen behilflich zu sein, indem er als Dolmetscher bei den beiden Indiern, die kein Englisch verstanden, fungirte. Die sehr gründliche und langdauernde Untersuchung hatte zu nichts geführt, indem sie auch nicht den Schatten eines Anhaltspunktes für die Annahme ergab, daß die Jongleurs im Einverständniß mit unseren Domestiken ständen. Nach diesem negativen Resultat hatte Herr Franklin sein Telegramm nach London abgesandt, von wo wir erst morgen weitere Nachrichten erwarten konnten.
So viel über die Geschichte des Tages, welcher dem Geburtstage folgte.

Zwölftes Capitel.
Die Nacht vom Donnerstag auf Freitag ging vorüber, ohne daß sich irgend etwas Bemerkenswerthes ereignete. Der Freitag Morgen aber brachte zwei neue Momente: Erstens versicherte der Bäckerjunge, er sei Rosanna Spearman Tags zuvor am Nachmittage begegnet, wie sie, dicht verschleiert, auf dem Fußwege über das Moor nach Frizinghall zu gegangen sei. So auffallend es war, daß Jemand sich über die Person Rosanna’s, die durch ihre verwachsene Schulter nur zu kenntlich war, getäuscht haben sollte, so mußte sich unser Bäckerjunge doch geirrt haben, denn Rosanna war ja, wie der Leser weiß, den ganzen Donnerstag Nachmittag auf ihrem Zimmer gewesen.
Das zweite Novum brachte der Postbote. Als unser würdiger Herr Candy am Abend des Geburtstags beim Wegfahren gegen mich äußerte, daß die Haut eines Arztes wasserdicht sein müsse. war dies wieder eine der Unglücklichen Bemerkungen gewesen, deren er an jedem Tage schon so viele gemacht hatte. Trotz seiner wasserdichten Haut war die Nässe doch nicht ohne üble Folgen für ihn geblieben. Er hatte sich erkältet und lag jetzt im Fieber. Die letzten Nachrichten, die der Postbote brachte, meldeten, daß er im Fieber phantasire und eben so geläufig im Delirium rede wie sonst in gesunden Tagen. Der kleine Doctor that uns Allen sehr leid, Herr Franklin aber schien seine Krankheit ganz besonders Fräulein Rachel’s wegen zu bedauern. Nach dem, was ich ihn zu Mylady beim Frühstück sagen gehört hatte, schien er zu fürchten, daß, wenn die Ungewißheit über den Mondstein noch länger dauere, Fräulein Rachel sehr bald und dringend ärztlichen Rathes bedürfen werde.
Das Frühstück war noch nicht lange vorüber, als ein Telegramm von Herrn Blake sen. in Antwort auf das seines Sohnes erfolgte. Es benachrichtigte uns, daß er durch Vermittlung des ihm befreundeten Polizeichefs den rechten Mann für uns gefunden habe. Er hieß Polizeisergeant Cuff und wir durften ihn mit dem Morgenzuge erwarten.
Als Herr Franklin den Namen dieses Polizeisergeanten las, fuhr er aus. Er hatte, glaube ich, während seines Aufenthalts in London von dem Advokaten seines Vaters einige sonderbare Anecdoten über den Cuff gehört. »Ich fange an zu hoffen« sagte er, »daß wir uns dem Ende unserer ängstlichen Unsicherheit nähern. Wenn nur die Hälfte der Geschichten wahr ist, die ich über die Geschicklichkeit Cuff’s in der Enthüllung von Geheimnissen gehört habe, so hat er seines Gleichen in England nicht.« Wir wurden Alle aufgeregt und ungeduldig, als die Zeit herankam, wo wir diesen durch seine Gewandtheit berühmten Mann erwarten konnten. Der Oberbeamte Seegreaf der sich zur festgesetzten Zeit einstellte, schloß sich, sobald er von der bevorstehenden Ankunft des Polizeisergeanten hörte, mit Papier, Feder und Tinte in ein Zimmer ein, um sich Notizen für den Bericht zu machen, den er unzweifelhaft zu erstatten haben würde.
Ich wäre gern an die Station gegangen, um Cuff abzuholen, aber an Mylady’s Wagen und Pferde war selbst für den berühmten Cuff nicht zu denken; und der Ponywagen war bereits für eine spätere Stunde von Herrn Godfrey bestellt. Dieser Letztere bedauerte es auf’s Lebhafteste, daß er genöthigt sei, seine Tante in einem so peinlichen Augenblick zu verlassen, und war freundlich genug, die Stunde seiner Abreise bis zu dem letzten Zuge zu verschieben, damit er noch zuvor hören könne, was der gewandte Londoner Polizeibeamte über den Fall denke. Aber am Freitag Abend müsse er nothwendig wieder in London sein, da er am Sonnabend Morgen der Sitzung eines mildthätigen Damen - Comitées, das seines Rathes bedürfe, beizuwohnen habe.
Als die Zeit der Ankunft des Sergeanten herankam, ging ich an die Pforte des Parks, um nach ihm auszusehen. Gerade als ich bei dem Pförtnerhause anlangte, kam ein Wagen von der Eisenbahn angefahren, und heraus stieg ein graues, ältliches Männchen von so hagerem Körper, daß er aussah, als ob er Alles in Allem nicht ein Loth Fleisch auf den Knochen habe. Er war ganz schwarz gekleidet und trug eine weiße Cravatte. Sein Gesicht war so scharf wie ein Rasirmesser und seine Haut so welk, so trocken und so gelb wie Herbstlaub. Seine hellen, stahlgrauen Augen hatten etwas, was Einen aus der Fassung bringen konnte, als ob er mehr aus Einem herausbringen wolle, als dessen man sich selbst bewußt war. Sein Schritt war leise, seine Stimme hatte etwas Melancholisches, seine langen, hageren Finger waren wie Klauen gekrümmt, man hätte ihn für einen Pfarrer oder einen Leichenbestatter oder sonst irgend etwas nehmen können, nur nicht für das, was er war. Einen schärferen Gegensatz zu dem Oberbeamten Seegreaf als den Sergeanten Cuff und eine weniger angenehme und Vertrauen erweckende Persönlichkeit für eine Familie, die sich in einer peinlichen Lage, wie die unsrige, befand, hätte man sich in aller Welt nicht denken können.
»Ist dies Lady Verinder’s Landsitz?« fragte er.
»Ja, mein Herr.«
»Ich bin der Polizei-Sergeant Cuff.«
»Wollen Sie gefälligst mit mir kommen?«
Auf unserem Wege nach dem Hause machte ich ihn mit meinem Namen und meiner Stellung bekannt, um ihn zu überzeugen, daß er mit mir über die Angelegenheit, wegen derer Mylady ihn hatte kommen lassen, reden könne. Aber vergebens — er sprach kein Wort darüber. Er bewunderte den Park und bemerkte, daß er die Seeluft sehr erfrischend finde. Ich wunderte mich im Stillen, wie der berühmte Cuff zu seinem Rufe gekommen sei. Wir erreichten das Haus in der Stimmung zweier Hunde, die zum ersten Mal in ihrem Leben an ein und dieselbe Kette gelegt worden sind. Da wir hörten, daß Mylady sich in einem der Treibhäuser befinde, gingen wir nach dem hinter dem Hause liegenden Garten und schickten einen Diener ab, sie von unserer Ankunft zu benachrichtigen. Als wir so warteten, blickte Polizei-Sergeant Cuff durch den Bogen von immergrünem Laube zur Linken aus den Rosengarten und ging, zum ersten Male mit dem Anschein eines Interesses für irgend Etwas, ohne Weiteres hinein. Zum Erstaunen des Gärtners und zu meinem Verdruß erwies sich der berühmte Cuff als eine wahre Fundgrube des Wissens über einen so nichtigen Gegenstand wie die Rosenzucht.
»Ah, Sie haben hier die richtige Lage nach Süden und Südwesten,« sagte der Sergeant, indem er mit seinem grauen Kopf nickte und in dem Ton seiner melancholischen Stimme etwas von selbstgefälligem Behagen äußerte; »dies ist die wahre Form eines Rosengartens — ein Kreis innerhalb eines Vierecks —— ja, ja, mit Wegen zwischen allen Beeten —— aber die Wege müßten nicht mit Kies bestreut sein —— Graswege, Herr Gärtner, Graswege müßten Sie zwischen Ihren Beeten haben. Da haben Sie ein allerliebstes Beet von weißen und blaßrothen Rosen, die nehmen sich immer sehr gut zusammen aus, nicht wahr? Hier ist ja die weiße Monatsrose, Herr Betteredge, unsere alte, englische Rose, die es noch mit den schönsten und neuesten Sorten aufnimmt. Du liebes Ding!« sagte der Sergeant, indem er die Monatsrose mit seinen mageren Fingern liebkoste und mit ihr sprach, wie mit einem Kinde. Das war mir der rechte Mann, Fräulein Rachels Diamanten und den Dieb, der ihn gestohlen, zu entdecken.
»Sie scheinen ein Liebhaber von Rosen zu sein, Herr Sergeant,« bemerkte ich.
»Ich habe nicht viel Zeit zu Liebhabereien,« erwiderte Herr Cuff, »aber wenn ich einen freien Augenblick habe, Herr Betteredge, so widme ich ihn meistens den Rosen. Ich habe mein Leben in dem Kunstgarten meines Vaters unter Rosen begonnen und ich will wo möglich mein Leben unter ihnen beendigen. Ja, das will ich! Binnen Kurzem werde ich es mit Gottes Hilfe aufgeben, Diebe einzufangen und werde meine Hand an der Rosenzucht versuchen. Zwischen meinen Beeten aber will ich Graswege haben, Herr Betteredge,« sagte der Sergeant, dem die Kieswege unseres Rosengartens sehr zu mißfallen schienen.
»Eine sonderbare Liebhaberei,« erlaubte ich mir zu bemerken, »für einen Mann von Ihrem Lebensberuf.«
»Wenn Sie sich in der Welt umsehen (was die wenigsten Menschen thun),« erwiderte Cuff, »so werden Sie finden, daß die Liebhabereien der meisten Menschen im schärfsten Gegensatz zu ihrem Berufe stehen. Zeigen Sie mir zwei entgegengesetztere Dinge als eine Rose und einen Dieb und ich will meine Liebhaberei ändern, wenn ich nicht schon zu alt dazu bin. Sie finden die Monatsrose geeignet, die meisten zarten Sorten darauf zu Pfropfen, nicht wahr Herr Gärtner? Ja, das dachte ich wohl! Hier kommt eine Dame, ist es Lady Verinder?«
Er hatte sie gesehen, ehe wir, der Gärtner und ich, sie bemerkt hatten, obgleich er nicht, wie wir, wissen konnte, von welcher Richtung her sie kommen mußte. Ich fing an, ihn für gewandter zu halten, als er mir zuerst erschienen war. Das Aussehen oder der Zweck der Gegenwart des Sergeanten oder vielleicht beides schienen Mylady etwas verlegen zu machen. Zum ersten Male so lange ich mich erinnern konnte, wußte sie bei der ersten Begegnung mit einem Fremden nicht, was sie sagen solle; aber Sergeant Cuff wußte sie auf der Stelle a son aise zu setzen. Er fragte, ob schon irgend eine andere Person von uns mit der Erforschung des Diebstahls beauftragt worden sei, bevor wir zu ihm geschickt und bat, als er hörte, daß diese Person augenblicklich im Hause anwesend sei, um die Erlaubniß mit derselben zu sprechen, bevor etwas Weiteres geschehe.
Mylady ging voran; bevor er ihr folgte, sagte der Sergeant zum Abschied noch ein Wort über die Kieswege zum Gärtner.
»Suchen Sie von Mylady Graswege zu erlangen,« sagte er mit einem geringschätzigen Blick auf die Kieswege, »kein Kies, kein Kies!«
Warum der Oberbeamte Seegreaf bei seiner Begegnung mit dem Sergeanten Cuff in weniger als halber Lebensgröße erschien, das zu erklären geht über meine Kräfte. Ich kann nur die Thatsache constatiren, daß sie sich zusammen zurückzogen und lange Zeit gegen jeden sterblichen Eindringling abgesperrt blieben. Als sie wieder erschienen, war der Oberbeamte aufgeregt, während der Sergeant gähnte.
»Der Herr Sergeant wünscht Fräulein Rachels Wohnzimmer zu sehen,« sagte Seegreaf zu mir mit feierlicher Wichtigkeit. »Der Herr Sergeant haben vielleicht einige Fragen zu thun, bitte begleiten Sie den Herrn Sergeanten.«
Während ich auf diese Weise meine Ordre erhielt, sah ich mir den großen Cuff an. Der große Cuff seinerseits sah den Oberbeamten Seegreaf mit jenem ruhig überlegenen Blick an, den ich schon früher an ihm bemerkt hatte. Ich kann zwar nicht bestimmt behaupten, daß Cuff auf die Umwandlung seines Collegen in die Gestalt eines Esels wartete, aber mir kam es so vor. Ich ging den Beamten voran hinaus. Der Sergeant durchsuchte mit großer Ruhe das indische Schränkchen und das ganze Boudoir, indem er mir beständig und dem Oberbeamten gelegentlich Fragen vorlegte, deren wahrer Zweck, glaube ich, uns Beiden gleich unverständlich war.
Seine schrittweise Durchsuchung des Zimmers führte ihn auch an die Thür, gerade vor die Decorationsmalerei, von der der Leser bereits weiß. Er legte einen seiner hageren Finger prüfend auf den kleinen Fleck gerade unter dem Schlüsselloch, den auch Seegreaf bereits bemerkt hatte, als er Tags zuvor die weiblichen Dienstboten dafür schalt, daß sie sich Alle zusammen in das Zimmer gedrängt hatten.
»Wie schade,« sagte Cuff, »wie ist denn das gekommen?
Er richtete eine Frage an mich. Ich antwortete, daß die Mägde sich am vorigen Morgen ins Zimmer gedrängt und die Kleider einiger derselben das Unheil angerichtet hätten. Herr Seegreaf fügte ich hinzu, hieß sie noch rechtzeitig hinausgehen, ehe sie mehr Schaden anrichten konnten.«
»So ist es,« sagte der Oberbeamte in seiner militärischen Weise; »ich hieß sie hinausgehen; die Kleider sind schuld, Herr Sergeant, die Kleider!«
»Haben Sie bemerkt, welches Kleid es war?« fragte Herr Cuff, indem er sich noch immer nicht an seinen Collegen, sondern an mich wandte.
»Nein, Herr Sergeant!«
Darauf wandte er sich an Seegreaf und sagte: »Aber Sie haben sicherlich bemerkt!«
Der Oberbeamte sah ein wenig verlegen aus, suchte sich aber so gut wie möglich zu helfen. »Das kann ich wirklich nicht mehr sagen. Eine Kleinigkeit, Herr Sergeant, eine solche Kleinigkeit!«
Sergeant Cuff sah Seegreaf mit demselben Blick an, mit dem er die Kieswege im Rosengarten betrachtet hatte und gab uns in seiner melancholischen Weise den ersten Vorgeschmack seiner eigentlichen Specialität.
»In der vorigen Woche hatte ich eine Untersuchung vorzunehmen, Herr Seegreaf,« sagte er. »Das Ziel dieser Untersuchung war die Entdeckung eines Mordes, ihr Ausgangspunkt ein Tintenfleck auf einer Tischdecke, von dessen Entstehung Niemand Rechenschaft zu geben wußte. In allen meinen Erfahrungen, auf allen meinen Wegen, durch alle Schlupfwinkel dieser schmutzigen kleinen Welt habe ich noch nicht gelernt, irgend etwas als eine Kleinigkeit zu betrachten! Bevor wir einen Schritt weiter thun, müssen wir das Kleid finden, das diesen Flecken verursacht hat und müssen uns vergewissern, wie lange diese Farbe naß gewesen ist.«
Der Qberbeamte, den die erhaltene Zurechtweisung verstimmt hatte, fragte, ob er die Mägde kommen lassen solle. Nach einer kurzen Ueberlegung schüttelte Cuff seufzend den Kopf. »Nein,« sagte er, »wir wollen uns erst mit der Farbe hier beschäftigen. Es handelt sich dabei einfach um Ja oder Nein. Die Frage nach dem Frauenkleid ist weniger einfach. Wie viel Uhr war es, als die Mädchen gestern im Zimmer waren? War es 11 Uhr? Wie? Ist irgend Jemand im Hause, der sagen kann, ob die Farbe gestern Morgen um 11 Uhr trocken war?«
»Das muß Mylady’s Neffe, Herr Franklin Blake wissen,« sagte ich.
»Ist der Herr zu Hause?«
Herr Franklin war uns so nah wie möglich, denn er wartete nur auf die Gelegenheit, dem großen Cuff vorgestellt zu werden. Im nächsten Augenblick war er im Zimmer und machte seine Aussage wie folgt:
»Diese Thür, Herr Cuff, ist von Fräulein Rachel unter meiner Aufsicht, mit meiner Hilfe und mit einem von mir selbst verfertigten Bindetnittel gemalt worden. Das Bindemittel trocknet, gleichviel zu was für Farben es verwandt wird, in 12 Stunden.«
»Erinnern Sie sich, wann die ausgewischte Stelle bemalt worden?« fragte der Sergeant
»Genau,« sagte Herr Franklin »Das war gerade die Stelle, die zuletzt gemalt ward. Wir wollten gern am vorigen Mittwoch damit fertig sein, und ich selbst habe um 3 Uhr Nachmittags oder kurz nachher die letzte Hand daran gelegt.«
»Heute ist Freitag,« sagte Sergeant Cuff zu Seegreaf, »lassen Sie uns einmal zurückrechnen Also Mittwoch Nachmittag 3 Uhr war diese Stelle fertig bemalt; das Bindemittel machte dieselbe binnen 12 Stunden —— das heißt also bis um 3 Uhr Donnerstag Morgen trocken. Um 11 Uhr haben Sie hier Ihr Verhör vorgenommen —- ziehen Sie 3 von 11 ab —— bleibt 8. Die Malerei war schon acht Stunden trocken gewesen, als Sie annahmen, daß die Kleider der Mägde dieselbe übergewischt hatten.«
Das war der erste Schlag auf Herrn Seegreaf’s Haupt. Hätte er nicht Verdacht gegen Penelope gehabt, so hätte ich ihn bemitleidet!
Nachdem Sergeant Cuff den Farbepunkt auf diese Weise festgestellt hatte, gab er seinen Collegen als unbrauchbar auf und wandte sich an Herrn Franklin, von dem er sich bessern Beistand versprach.
»Es ist klar, Herr Blake,« sagte er, »daß Sie uns den rechten Schlüssel in die Hand geliefert haben.« Kaum hatte er diese Worte gesagt, als sich die Thür des Schlafzimmers öffnete und Fräulein Rachel zu uns hereintrat. Sie wandte sich an den Sergeanten, ohne die geringste Rücksicht darauf zu nehmen, daß er ihr völlig fremd sei. »Bemerkten Sie,« sagte sie, auf Herrn Franklin deutend, »daß er es sei, der den Schlüssel in Ihre Hand gelegt habe?«
»Dies ist Fräulein Verinder,« flüsterte ich dem Sergeanten zu.
»Dieser Herr, mein Fräulein,« erwiderte der Sergeant, indem er mit seinen stahlgrauen Augen Fräulein Rachel scharf in’s Gesicht blickte, »hat möglicher Weise den Schlüssel in unsere Hände gelegt.«
Sie wandte sich um und versuchte Herrn Franklin anzusehen —— ich sage versuchte, denn sie wandte sich plötzlich wieder ab, noch ehe ihre Augen den seinigen begegnet waren. Sie schien sich in einer ganz eigenthümlichen Gemüthsverfassung zu befinden; sie erröthete und wurde dann wieder blaß. Mit der Blässe gewann ihr Auge einen neuen Ausdruck —— einen Ausdruck, der mich entsetzte.
»Nachdem ich Ihre Frage beantwortet habe. mein Fräulein,« fing der Sergeant wieder an, »bitte ich um die Erlaubniß, nun meinerseits eine Frage an Sie zu richten. Auf der Farbe an der Thür ist etwas übergewischt —— wissen Sie zufällig, wann das geschehen ist oder wer es gethan hat?«
Statt jeder Antwort fuhr Fräulein Rachel mit ihren Fragen fort, als ob der Sergeant gar nicht gefragt oder sie ihn nicht gehört hätte.
»Sind Sie auch ein Polizeibeamter?« fragte sie.
»Ich bin Sergeant Cuff von der geheimen Polizei.«[ Geheime Polizei im englischen Sinne detectiv police, die für die Entdeckung von Verbrechern im Geheimen thätige Polizei. Anm. d. Uebers.]
»Halten Sie es der Mühe Werth, von einem jungen Mädchen einen Rath anzunehmen?«
»Ich werde ihn gern anhören, mein Fräulein.«
»Thun Sie Ihre Pflicht allein und lassen sich nicht von Herrn Franklin Blake helfen.«
Sie sprach diese Worte mit einem solchen Ausdruck von Hohn und Wuth, mit einem so furchtbaren Ausbruch des Hasses gegen Herrn Franklin in Stimme und Blick, daß ich, obgleich ich sie von ihrer frühesten Kindheit an kannte, obgleich ich sie nächst Mylady am meisten von allen Menschen ehrte und liebte, zum ersten Male in meinem Leben mich ihrer schämte.
Sergeant Cuffs unbewegliche Augen blieben unablässig auf sie geheftet.
»Ich danke Ihnen, mein Fräulein. Wissen Sie zufällig etwas über den Fleck auf der Farbe? Können Sie ihn selbst gemacht haben?«
»Ich weiß nichts von diesem Fleck.«
Mit diesen Worten ging sie wieder in ihr Schlafzimmer und schloß es hinter sich zu. Diesmal hörte ich sie wie früher Penelope in Thränen ausbrechen, sobald sie allein war. Ich konnte es nicht über mich gewinnen, Herrn Cuff anzusehen — ich blickte auf Herrn Franklin, der mir zunächst stand. Er schien von dem, was vorgegangen, noch peinlicher berührt als ich selbst.
»Ich habe Ihnen schon gesagt,« erwiderte er, »daß ich ihretwegen beunruhigt sei, und nun sehen Sie warum.«
»Fränlein Verinder scheint über den Verlust ihres Diamanten etwas ungehalten,« bemerkte der Sergeant. »Es ist ein kostbarer Edelstein; sehr begreiflich, sehr begreiflich!«
Hier übernahm also ein völlig Fremder dieselbe Entschuldigung unseres Fräuleins, die ich Tags zuvor, als sie sich gegen Seegreaf vergessen, vorgebracht hatte. Ein kalter Schauer überlief mich, ich wußte selbst nicht warum. Jetzt weiß ich, daß mir in jenem Augenblick die erste Ahnung davon gekommen ist, daß lediglich in Folge des Anblicks und der Reden von Fräulein Rachel dem Sergeanten Cuff ein neues und schreckliches Licht in der Sache ausgegangen sein könne.
»Man darf es mit den Worten einer jungen Dame nicht so genau nehmen,« sagte der Sergeant zu Herrn Franklin, »lassen Sie uns das eben Vorgefallene vergessen, und unser Geschäft ohne Unterbrechung fortsetzen. Dank Ihrer Mittheilung wissen wir, wann die Farbe trocken war. Was wir zunächst herauszufinden haben, ist, wann dieselbe zuletzt ohne den Fleck gesehen worden ist. Sie sind ein Mann von Einsicht und verstehen mich.«
Herr Franklin nahm sich zusammen und suchte seine Gedanken von Fräulein Rachel abzulenken und der Farben-Angelegenheit zuzuwenden.
»Ich glaube Sie zu verstehen, je enger wir die Frage der Zeit begrenzen können, desto enger begrenzen wir das Feld der Untersuchung.«
»So ist’s,« erwiderte der Sergeant.
»Haben Sie Ihre Arbeit noch nach ihrer Vollendung am Mittwoch Nachmittag angesehen?«
Herr Franklin schüttelte den Kopf, »das glaube ich nicht.«
»Haben Sie die Arbeit angesehen?« fragte Cuff mich.
»Auch ich kann das nicht behaupten.«
»Wer war die letzte Person, die sich am Mittwoch Abend in diesem Zimmer befunden hat?«
»Ich glaube Fräulein Rachel.«
Herr Franklin fiel ein: »Oder möglicher Weise Ihre Tochter, Herr Betteredge.« Er wandte sich zu Sergeant Cuff und erklärte ihm, daß meine Tochter Fräulein Rachel’s Kammermädchen sei.
»Herr Betteredge, ersuchen Sie Ihre Tochter, herauf zu kommen,« sagte der Sergeant, rief aber gleich darauf »Halt!« und nahm mich in eine Ecke an’s Fenster.
»Der Oberbeamte hier,« flüsterte er mir zu, »hat mir einen ziemlich vollständigen Bericht gegeben, wie er die Untersuchung geleitet hat. Unter Anderem hat er nach seiner eigenen Mittheilung die Dienstboten aufsässig gemacht, es ist höchst wichtig sie wieder zu beruhigen.
Theilen Sie gefälligst Ihrer Tochter und den übrigen Dienstboten mit meiner Empfehlung Folgendes mit, erstens daß ich bis jetzt keinen Beweis habe, daß der Diamant gestohlen, sondern daß ich nur weiß, daß er verloren ist; zweitens daß mein Verfahren gegen die Dienstboten sich einfach darauf beschränkt, sie zu bitten, sich zusammenzuthun und mir bei der Wiedererlangung behilflich zu sein.«
Ich fand in diesen Worten eine Bestätigung dessen, was ich von der Entrüstung der Dienstboten bei dem durch Seegreaf auf ihre Zimmer gelegten Sequester gesehen hatte.
»Mit Ihrer Erlaubniß möchte ich den Mägden noch ein Drittes sagen. Haben Sie etwas dagegen,« fragte ich, »daß sie Trepp auf Trepp ab laufen und in ihre Zimmer gehen, wann sie wollen?«
»Nicht das Mindeste,« sagte Herr Cuff.
Das wird das beste Mittel sein, sie alle von der Köchin bis zur Scheuermagd zu besänftigen.«
»Besorgen Sie diese Beruhigung sofort, Herr Betteredge.«
In weniger als fünf Minuten war die Sache gethan. Nur auf eine Schwierigkeit stieß ich. Es bedurfte einer ziemlich energischen Ausübung meiner Autorität als Chef, um zu verhindern, daß nicht die gesamte weibliche Dienerschaft mir und Penelopen in ihrem Eifer, Sergeant Cuff als freiwillige Zeugen behilflich zu sein, in das Boudoir hinauf folgte. Der Sergeant schien mit Penelopen zufrieden zu sein. Er sah etwas weniger melancholisch aus, und mehr wie damals, als er die weiße Rose betrachtete. Folgendes ist die Aussage meiner Tochter, wie der Sergeant sie zu Protokoll genommen hat. Sie machte ihre Aussage, glaube ich, sehr gut. Ja, sie ist ganz und gar mein Kind! Sie hat nichts von ihrer Mutter, so wahr mir Gott helfe, nichts von ihrer Mutter.
Das Protokoll lautete: Zeugin nahm lebhaftes Interesse an der Thürmalerei, da sie bei der Mischung der Farben behilflich gewesen war; hatte sich das Stückchen Malerei unter dem Thürschloß wohl gemerkt, weil es zuletzt gemalt war. Hatte es einige Stunden nach der Vollendung ohne Fleck gesehen; hatte es um Mitternacht ohne Fleck gesehen; hatte um diese Zeit ihrem jungen Fräulein gute Nacht gesagt; hatte die Uhr im Boudoir schlagen hören; hatte in dem Augenblick ihre Hand aus dem Griff der gemalten Thür; wußte, daß die Farbe noch naß sei, da sie, wie oben bemerkt, bei der Mischung geholfen hatte; nahm sich besonders in Acht, dieselbe nicht zu berühren; kann beschwören, daß sie ihr Kleid vorsichtig fest an sich nahm und daß in dem Augenblick die Malerei noch nicht übergewischt war; kann nicht beschwören, daß ihr Kleid nicht beim hinausgehen zufällig doch die Malerei berührt hat; erinnert sich des Kleides, das sie getragen, da es neu und ein Geschenk von Fräulein Rachel war; ihr Vater erinnerte sich desselben gleichfalls; erklärte sich bereit, es zu holen; holte es; das Kleid wird von ihrem Vater als das an jenem Abend von ihr getragene recognoscirt; das Kleid wird untersucht, ein großes Stück Arbeit wegen des vielen Zeuges; keine Spur eines Farbenflecks. Schluß von Penelopes charmanter und sehr überzeugender Aussage. Unterzeichnet Gabriel Betteredge.
Das Nächste war, daß der Sergeant mich fragte, ob große Hunde im Hause seien, welche in’s Zimmer gedrungen sein und mit ihren Schwänzen das Unheil angerichtet haben könnten. Nachdem ich ihn überzeugt hatte, daß das unmöglich sei, ließ er ein Vergrößerungsglas holen und betrachtete die übergewischte Stelle durch dasselbe. Keine Spur der Berührung durch eine menschliche Hand. Alle Anzeichen sprachen dafür, daß die Stelle durch irgend ein Kleidungsstück eines an der Thür Vorübergehenden übergewischt und daß, die Aussagen von Penelope und Herrn Franklin zusammengehalten, Jemand am Donnerstag Morgen zwischen zwölf und drei Uhr im Zimmer gewesen sein und die Stelle verdorben haben müsse.
Als die Untersuchung bis zu diesem Punkt gediehen war, bemerkte Sergeant Cuff, daß der Oberbeamte Seegreaf sich noch im Zimmer befand, und resumirte das Ergebniß seiner bisherigen Untersuchungen zum Besten seines Collegen, wie folgt: »Ihre Kleinigkeit,« sagte er, auf die Stelle an der Thür deutend, »hat einige Wichtigkeit gewonnen, seit Sie derselben zuerst Ihre Aufmerksamkeit zuwandten. In dem gegenwärtigen Stadium der Untersuchung handelt es sich nach meiner Ansicht, wenn man die übergewischte Stelle zum Ausgangspunkt nimmt, darum, Dreierlei zu entdecken: erstens, ob sich in diesem Hause ein Kleidungsstück mit dem betreffenden Farbenfleck findet; zweitens, wem dieses Kleidungsstück gehört; drittens, wie sich die betreffende Person darüber verantworten kann, daß sie zwischen Zwölf und Drei in diesem Zimmer gewesen ist und die Farbe übergewischt hat. Wenn die Person sich hierüber nicht genügend ausweisen kann, so werden wir nach dem Diamantendieb nicht weit zu suchen haben. Ich möchte diese Untersuchung mit Ihrer Erlaubniß allein fortsetzen und will Sie Ihren Berufsgeschäften in der Stadt nicht länger entziehen. Sie haben einen Ihrer Officianten hier, wie ich sehe; lassen Sie mir denselben hier für den Fall, daß ich seiner bedürfen sollte und erlauben Sie mir, Ihnen einen guten Morgen zu wünschen.«
Oberbeamter Seegreaf hatte großen Respect vor dem Sergeanten Cuff; noch größeren aber vor sich selber. Den scharfen Hieb, den ihm der berühmte Cuff versetzt hatte, suchte er, so gut er konnte, beim Fortgehen zu pariren.
»Ich habe mich bis jetzt jeder Meinungsäußerung enthalten,« bemerkte der Oberbeamte mit seiner vollkräftigen militärischen Stimme. »Ich erlaube mir, indem ich Ihnen diese Angelegenheit überlasse, nur die Eine Bemerkung. Es giebt Leute, Herr Sergeant, die aus einer Mücke einen Elephanten machen. Ich empfehle mich Ihnen.«
»Es giebt auch Leute, die eine Mücke gar nicht bemerken, weil sie ihnen zu klein ist.« Nachdem er das Compliment seines Collegen so erwidert hatte, drehte sich Sergeant Cuff um und trat allein an’s Fenster.
Herr Franklin und ich waren begierig zu sehen, was nun vor sich gehen solle. Der Sergeant sah die Hände in den Taschen, zum Fenster hinaus und pfiff die Melodie »Letzte Rose« sachte vor sich hin. Im Verlauf der Untersuchung bin ich später dahinter gekommen, daß er sich nur dann soweit vergaß zu pfeifen, wenn sein Kopf stark arbeitete und sich Schritt für Schritt den Weg zu dem von ihm selbst gesteckten Ziel bahnte, wobei ihm »die letzte Rose« offenbar gute Dienste leistete. Das Lied harmonirte, glaube ich, mit seiner Gemüthsverfassung; es erinnerte ihn an seine lieben Rosen, und war, wenn er es pfiff, die melancholischste Melodie, die man sich denken kann.
Nach einigen Minuten ging der Sergeant vom Fenster weg gerade in die Mitte des Zimmers, wo er in Gedanken versunken und die Augen auf die Thür von Fräulein Rachel’s Schlafzimmer geheftet stehen blieb. Nach einer kleinen Weile nickte er mit dem Kopfe, als wolle er sagen: »So wird’s gehen!« und beauftragte mich, Mylady zu ersuchen, ihm, sobald es ihr bequem sei, eine kurze Audienz zu gewähren.
Im Begriff das Zimmer mit diesem Auftrage zu verlassen, hörte« ich, wie Herr Franklin eine Frage an den Sergeanten richtete, und blieb an der Schwelle der Thür stehen, um auch die Antwort zu hören.
»Haben Sie schon eine Idee, wer den Diamanten gestohlen haben kann?« fragte Herr Franklin.
»Kein Mensch hat den Diamanten gestohlen,« erwiderte Cuff.
Ueber diese merkwürdige Ansicht waren wir Beide höchlich erstaunt und drangen in ihn, sich näher zu erklären.
»Warten Sie nur ein klein wenig,« sagte der Sergeant. Es fehlen nur noch einige Stücke an diesem Geduldspiel.«

Dreizehntes Capitel.
Ich fand Mylady in ihrem Wohnzimmer, sie fuhr auf und sah Verdrießlich aus, als ich ihr meldete, daß Sergeant Cuff sie zu sprechen wünschte.
»Muß ich ihn sprechen,« fragte sie, »können Sie mich nicht vertreten, Gabriel?«
Ich wußte nicht, was ich daraus machen sollte, und ließ diesen Eindruck vermuthlich deutlich auf meinem Gesicht sehen.
Mylady hatte die Güte, sich darauf näher zu erklären.
»Ich fürchte, meine Nerven sind angegriffen,« sagte sie. »Der Polizei-Sergeant aus London hat etwas in seinem Wesen, das mir, ich weiß nicht warum, widersteht. Ich habe ein Vorgefühl als ob er Verwirrung und Unglück in’s Haus bringen würde. Sehr thöricht und mir sehr Unähnlich, aber es ist einmal so.«
Ich wußte nicht, was ich darauf antworten sollte. Je mehr ich von Sergeant Cuff gesehen hatte, desto besser gefiel er mir.
Nachdem Mylady mir so ihr Herz geöffnet hatte, nahm sie ich, als eine Frau von großer Entschlossenheit, die sie war und wie ich sie bereits geschildert habe, wieder zusammen.
»Wenn ich ihn sehen muß, so muß ich es eben über mich ergehen lassen, ich kann mich aber nicht überwinden, ihn allein zu sprechen. Führen Sie ihn herein, Gabriel, aber bleiben Sie im Zimmer, solange er bei mir ist.«
Das war das erste Mal seit ihren Mädchenjahren, daß ich Mylady von ihren Nerven hatte reden hören. Ich ging zurück in’s Boudoir. Herr Franklin schlenderte in den Garten und trat zu Herrn Godfrey, dessen Abfahrtsstunde herannahte.
Sergeant Cuff und ich gingen direct zu Mylady. Bei seinem Anblick ward Mylady noch blässer als vorher, im Uebrigen aber beherrschte sie sich und fragte den Sergeanten, ob er etwas dagegen habe, wenn ich im Zimmer bliebe. Sie hatte die Güte hinzuzufügen, daß ich nicht nur ihr alter Diener, sondern auch ihr erprobter Rathgeber sei, und daß ich bei jeder die Familie betreffenden Angelegenheit die Person sei, die sie am liebsten zu Rathe ziehe.
Der Sergeant antwortete höflich, daß ihm meine Anwesenheit besonders angenehm sei, da er etwas über die Dienerschaft im Allgemeinen zu sagen und meine Erfahrungen in diesem Punkte bereits nützlich gefunden habe. Mylady wies uns zwei Stühle an und wir nahmen Platz, um unsere Conferenz zu beginnen.
»Ich habe mir über den vorliegenden Fall schon eine Meinung gebildet,« begann Sergeant Cuff, »welche vorläufig für mich behalten zu dürfen ich um Ihre Erlaubnis; bitte, Mylady. Ich habe hier zunächst zu melden, was ich in Fräulein Verinder’s Wohnzimmer entdeckt habe und was ich mit Ihrer Erlaubniß, Mylady, demnächst zu thun gedenke.«
Er berichtete dann über die Malerei mit ihrer über gewischten Stelle und über die Schlüsse, die er daraus ziehe, gerade wie er sich gegen Seegreaf ausgesprochen hatte, nur in gewählteren Ausdrücken.
»Eines,« schloß er, »ist sicher. Der Diamant ist nicht in dem Schubfach des Schränkchens. Ein Anderes ist so gut wie sicher: Die Spuren der Farbe müssen sich auf einem Kleidungsstücke irgend einer Person in diesem Hause befinden. Dieses Kleidungsstück müssen wir herausfinden, ehe wir einen Schritt weiter gehen.«
»Und diese Entdeckung,« bemerkte Mylady, »wird vermuthlich die Entdeckung des Diebes mit sich bringen.«
»Bitte um Vergebung, Mylady, ich behaupte nicht, daß der Diamant gestohlen ist; ich beschränke mich für jetzt darauf, zu sagen, daß er vermißt wird. Die Entdeckung des befleckten Kleidungsstückes kann möglicherweise zur Wiederauffindung führen.«
Mylady sah mich an. »Verstehen Sie das?« fragte sie.
»Sergeant Cuff wird es wohl verstehen,« erwiderte ich.
»Aus welche Weise denken Sie das befleckte Kleidungsstück zu finden?« fragte Mylady, sich wieder zum Sergeanten wendend. »Meine braven Diener und Dienerinnen, die seit Jahren in meinem Hause sind, haben sich, mit Beschämung spreche ich es aus, gefallen lassen müssen, ihre Zimmer und Sachen von dem andern Beamten durchsuchen zu lassen. Ich kann und will nicht zugeben, daß ihnen zum zweiten Male in dieser Weise zu nahe getreten wird.« (Sie war eine Herrin, eine Frau, wie man ihrer unter Zehntausend nicht Eine findet.)
»Das ist eben der Punkt, den ich mit Ihnen, Mylady, zu besprechen wünsche. Der erste Beamte hat die Untersuchung dadurch unendlich erschwert, daß er die Dienstboten hat merken lassen, er habe Verdacht auf sie. Wenn ich ihnen zum zweiten Male Veranlassung gebe zu glauben, daß man sie in Verdacht hat, so ist nicht abzusehen, was sie mir nicht alles in den Weg legen werden, besonders die Frauenzimmer. Andererseits müssen ihre Sachen durchaus noch einmal untersucht werden, aus dem einfachen Grunde, daß die erste Durchsuchung ihr Augenmerk lediglich aus den Diamanten richtete, während die zweite sich auf das befleckte Kleidungsstück erstrecken muß. Ich bin vollkommen mit Ihnen einverstanden, daß auf die Gefühle der Dienstboten Rücksicht genommen werden muß, aber eben so fest überzeugt, daß die Kleiderschränke durchsucht werden müssen.«
»Das klappt nicht« Das war der Sinn von dem, was Mylady in gewählteren Worten sagte.
»Ich wüßte ein Mittel der Schwierigkeit zu begegnen,« sagte Cuff, »wenn Sie darauf eingehen wollen, Mylady. Ich schlage vor, daß man den Leuten die Sache vorstellt.«
»Da werden die Frauen auf der Stelle wieder glauben, daß man Verdacht aus sie hat,« rief ich.
»Das werden die Frauen nicht, Herr Betteredge,« sagte Cuff, »wenn ich ihnen sagen kann, daß ich die Garderobe jeder Person, die in der Nacht Vom Mittwoch auf Donnerstag hier geschlafen hat, Mylady mit einbegriffen, untersuchen werde. Dies ist natürlich eine reine Formalität,« fügte er mit einem Seitenblick aus Mylady hinzu. »Aber die Dienstboten werden es als eine sie ehrende Gleichstellung ihrer Herrschaft mit ihnen auffassen, und werden, statt der Untersuchung etwas in den Weg zu legen, es als eine Ehrensache betrachten, dieselbe zu fördern.«
Dies leuchtete mir ein, und auch Mylady konnte sich nach der ersten Ueberraschung der Wahrheit des Gesagten nicht verschließen.
»Sie sind von der Nothwendigkeit der Durchsuchung durchdrungen?« fragte sie.
»Sie ist der kürzeste Weg zum Ziel, Mylady.«
Mylady stand auf, um nach ihrem Kammermädchen zu klingeln.
»Sie sollen,« sagte sie, »die Schlüssel zu meiner Garderobe in der Hand, mit den Leuten reden.«
Sergeant Cuff hielt sie mit einer unerwarteten Frage zurück. »Wäre es nicht besser,« fragte er, »daß wir uns erst der Zustimmung der übrigen Damen und Herren versicherten?«
»Die einzige andere Dame im Hause ist meine Tochter,« antwortete Mylady überrascht; »die einzigen Herren meine Neffen, Herr Blake und Herr Ablewhite. Von allen Dreien ist nicht das geringste Bedenken zu besorgen.«
Ich machte Mylady darauf aufmerksam, daß Mr. Godfrey im Begriff stehe, abzureisen. Kaum hatte ich dies gesagt, als Herr Godftey in’s Zimmer trat, um Abschied zu nehmen; mit ihm kam Herr Franklin, der ihn zur Station begleiten wollte. Mylady machte die Herren mit der vorliegenden Schwierigkeit bekannt. Herr Godfrey beseitigte, so viel an ihm war, dieselbe auf der Stelle. Er rief Samuel aus dem Fenster zu, seinen Koffer wieder hinaufzutragen, und übergab seinen Schlüssel dem Sergeanten. »Mein Gepäck kann mir nachgeschickt werden, sobald die Untersuchung beendigt ist.« Der Sergeant nahm den Schlüssel mit den gebührenden Entschuldigungen.
»Ich bedaure,« sagte er, »Ihnen wegen einer Formalität Unbequemlichkeit zu verursachen. Aber das Beispiel ihrer Herrschaft wird bei den Domestiken Wunder thun.«
Nachdem Herr Godfrey sehr zärtlichen Abschied von Mylady genommen, hinterließ er eine Botschaft für Miß Rachel, deren Ausdruck es mir zweifellos machte, daß er ihr Nein nicht für endgültig halte, und daß er ihr die Heirathsfrage bei der nächsten Gelegenheit wieder vorzulegen gedenke.
Herr Franklin erklärte dem Sergeanten, als er mit seinem Vetter fortging, daß alle seine Kleider, wie Alles was er besitze, in seinem Zimmer unverschlossen daliege und ohne Weiteres durchsucht werden könne. Sergeant Cuff dankte verbindlichst. Wie der Leser gesehen hat, hatte Cuff das bereitwilligste Entgegenkommen bei Mylady, bei Herrn Godfrey und bei Herrn Franklin gefunden. Es erübrigte nur noch, auch Fräulein Rachel’s Zustimmung einzuholen, bevor wir die Domestiken zusammenberiefen, um mit der Durchsuchung der Sachen zu beginnen.
Mylady’s unerklärliche Abneigung gegen den Sergeanten trat bei unserer Conferenz, als wir wieder allein waren, noch stärker hervor. »Wenn ich Ihnen noch die Schlüssel meiner Tochter heruntergeschickt haben werde,« sagte sie zu ihm, »so habe ich, denke ich, Alles gethan, was Sie augenblicklich von mir verlangen.«
»Um Vergebung, Mylady, bevor wir beginnen, möchte ich Sie, wenn es Ihnen recht ist, um Ihr Wäschebuch bitten. Das befleckte Kleidungsstück kann möglicher Weise zur Leibwäsche gehören. Wenn die Durchsuchung der Kleider nichts ergiebt, so muß ich dieselbe auf alle im Hause befindliche und zur Wäsche geschickte Leibwäsche erstrecken Wenn ein Stück fehlt, so wird wenigstens die Vermuthung nahe liegen, daß es das befleckte, und daß es geflissentlich gestern oder heute fortgebracht sei. Herr Seegreaf,« fügte Herr Cuff zu mir gewandt hinzu, »lenkte die Aufmerksamkeit der Mägde auf die übergewischte Stelle an der Thür, als sie sich zusammen in das Zimmer gedrängt hatten. Das wird sich vielleicht auch noch als einer von den vielen Mißgriffen des Herrn Seegreaf herausstellen.«
Mylady befahl mir, zu klingeln und das Waschbuch zu beordern. Sie blieb bei uns, bis es gebracht war, für den Fall daß Sergeant Cuff, nachdem er es durchgesehen, noch eine Frage an sie zu richten haben sollte.
Das Waschbuch ward von Rosanna Spearman gebracht. Das Mädchen sah an jenem Morgen noch jämmerlich blaß und verstört aus, war aber doch wieder wohl genug, um ihre gewöhnliche Arbeit verrichten zu können. Herr Cuff betrachtete das Gesicht und die verwachsene Schulter des Mädchens sehr aufmerksam.
»Haben Sie mir noch irgend etwas zu sagen,« fragte Mylady mit dem Ausdruck des sehnlichsten Verlangens, sich von der Gesellschaft des Sergeanten befreit zu sehen.
Der große Cuff schlug das Wäschebuch auf, fand sich in wenigen Augenblicken darin zurecht und schlug es wieder zu. »Ich muß Sie noch mit einer letzten Frage behelligen, Mylady. Ist das junge Mädchen, welches das Buch soeben hereinbrachte, schon so lange wie die übrigen Dienstboten in Ihrem Hause?«
»Weshalb fragen Sie danach?«
»Als ich sie zuletzt sah, saß sie eines Diebstahls wegen im Gefängniß« Es blieb nichts übrig, als ihm die Wahrheit zu sagen. Mylady betonte sehr entschieden das gute Verhalten Rosanna’s in ihrem Dienst und die gute Meinung, welche die Hausmutter in der Besserungs-Anstalt von ihr gehabt hatte. »Ich hoffe, Sie hegen keinen Verdacht gegen sie,« schloß Mylady.
»Ich erlaubte mir schon zu bemerken, Mylady, daß ich bis jetzt Niemanden hier im Hause in Verdacht habe, einen Diebstahl begangen zu haben.«
Darauf erhob sich Mylady, um hinauf zu gehen und Fräulein Rachel um ihren Schlüssel zu bitten.
Der Sergeant kam mir zuvor, die Thür zu öffnen, indem er sich tief verbeugte; Mylady fuhr zusammen, als sie an ihm vorüberging. Wir warteten und warteten, aber keine Schlüssel kamen. Sergeant Cuff machte keinerlei Bemerkung. Er blickte mit seinen melancholischen Augen zum Fenster hinaus, steckte seine magern Hände in die Taschen und pfiff »Die letzte Rose« trübselig vor sich hin. Endlich trat Samuel herein, ohne die Schlüssel, aber mit einem Zettel für mich. Ich holte meine Brille mit einiger Verlegenheit hervor, denn ich fühlte, daß Cuff’s scharfe Augen fest auf mich gerichtet waren. Das Papier enthielt zwei bis drei von Mylady mit Bleistift geschriebene Zeilen. Sie benachrichtigte mich, daß Fräulein Rachel sich entschieden weigere, ihre Garderobe durchsuchen zu lassen, und auf die Frage nach ihren Gründen lediglich mit Thränen geantwortet habe. Als Mylady in sie gedrungen, habe sie geantwortet: »Ich will nicht, weil ich nicht will, und ich werde mich nur der Gewalt fügen« Ich begriff, daß Mylady nicht mit einer solchen Antwort ihrer Tochter Sergeant Cuff gegenüberzutreten wünsche. Wäre ich nicht für die liebenswürdigen Schwächen der Jugend zu alt gewesen, so wäre ich selbst bei dem Gedanken, ihm mit dieser Antwort gegenüberzutreten, erröthet.
»Haben Sie Nachrichten über Fräulein Verinder’s Schlüssel?« fragte Cuff.
»Das Fräulein weigert sich, ihre Garderobe durchsuchen zu lassen.«
»Ei,« sagte der Sergeant; in seiner Stimme verrieth sich etwas von Erregung, von welcher sein Gesicht keine Spur zeigte. Sein »Ei« klang, als ob etwas eingetroffen sei, was er erwartet hatte. Seine Aeußerung ärgerte und erschreckte mich, warum, weiß ich nicht.
»Müssen wir die Untersuchung aufgeben?«
»Ja,« erwiderte der Sergeant, »sie muß aufgegeben werden, weil Ihr Fräulein sich weigert, sich derselben gleich den übrigen Hausbewohnern zu unterziehen. Wenn wir nicht alle Garderoben im Hause durchsuchen können, so nützt die ganze Durchsuchung nichts. Schicken Sie Herrn Ablewhite’s Gepäck mit dem nächsten Zuge nach London und geben Sie das Wäschebuch mit meiner Empfehlung und meinem Dank dem jungen Mädchen zurück, das es vorhin herein brachte.«
Er legte das Wäschebuch auf den Tisch, nahm sein Federmesser aus der Tasche und fing an, sich mit demselben die Nägel zu putzen.
»Die Sache scheint Sie nicht zu überraschen,« fragte ich.
»Nein,« antwortete Cuff, »nicht sehr.«
Ich versuchte ihm eine Erklärung zu entlocken »Warum widersetzt sich wohl Fräulein Rachel Ihrer Untersuchung? Wäre es gerade nicht in ihrem Interesse, Ihnen behilflich zu sein?«
»Warten Sie ein wenig, Herr Betteredge, warten Sie nur ein wenig!«
Klügere Leute als ich, oder Leute, die weniger auf Fräulein Rachel gehalten, hätten vielleicht seine Absicht durchschaut. Mylady’s Abneigung gegen ihn war, wie ich mir später gedacht habe, vielleicht dadurch zu erklären, daß sie seine Absicht, wie es in der Schrift heißt, »in einem dunkeln Spiegel schaute.« Gewiß ist, daß ich dieselbe noch nicht erkannte.
»Was ist nun zu thun?« fragte ich.
Sergeant Cuff beendete seine Arbeit an dem Nagel, an dem er eben beschäftigt war, sah denselben mit einem Blick melancholischen Interesses an und klappte sein Federmesser zu.
»Kommen Sie mit mir in den Garten,« sagte er, »und lassen Sie uns die Rosen noch ein wenig ansehen.«

Vierzehntes Capitel.
Der nächste Weg nach dem Garten, wenn man aus Mylady’s Wohnzimmer kam, führte längs dem Gebüsch hin, das der Leser schon kennt. Zum besseren Verständnis; dessen, was ich jetzt zu erzählen habe, füge ich hinzu, daß dieser Weg Herrn Franklin’s Lieblings-Spaziergang war. Wenn er sich im Freien aufhielt und wir ihn sonst nirgends finden konnten, so fanden wir ihn meistentheils schließlich hier. Ich kann nicht leugnen, daß ich ein etwas hartnäckiger alter Mann bin. Je fester Sergeant Cuff seine Gedanken vor mir verschloß, desto fester beharrte ich bei dem Versuch, in dieselben einzudringen. Als wir in den besagten Weg einlenkten, versuchte ich ihn aus andere Weise zu überlisten. »Wie die Sachen jetzt stehen,« sagte ich, »wäre ich an Ihrer Stelle mit meinem Latein zu Ende.
»Wenn Sie an meiner Stelle wären,« sagte der Sergeant, »so würden Sie sich eine Meinung gebildet haben, und wie die Sachen jetzt stehen, jeden Zweifel, den Sie vielleicht noch an der Richtigkeit Ihrer Schlüsse gehegt hätten, vollständig beseitigt finden. Gleichviel, Herr Betteredge, für jetzt, worin diese Schlüsse bestehen. Ich habe Sie nicht gebeten, mich hierher zu führen, um mich von Ihnen wie ein Dachs aus dem Loche locken zu lassen, sondern um mir eine Auskunft von Ihnen zu erbittert. Sie hätten mir dieselbe ohne Zweifel auch eben so gut im Hause geben können. Aber Thüren und Lauscher haben eine natürliche Neigung, sich einander zu nähern, und in meinem Beruf pflegen wir eine gesunde Vorliebe für frische Luft zu haben.«
Ich mußte es mir wohl vergehen lassen, diesen Mann zu überlisten. Ich ergab mich in mein Schicksal und wartete so geduldig wie möglich der Dinge, die da kommen würden.
»Wir wollen auf die Gründe Ihres Fräuleins nicht näher eingehen,« fuhr er fort. »Wir wollen uns damit begnügen zu sagen, es ist schade, daß sie sich weigert, mir behilflich zu sein, weil sie dadurch die Untersuchung schwieriger macht, als sie sonst gewesen sein würde. Wir müssen jetzt versuchen, das Geheimniß des Flecks aus der Malerei, welches, das können Sie mir aufs Wort glauben, identisch mit dem Geheimniß des Diamanten ist, auf anderem Wege zu ergründen. Ich habe beschlossen, die Domestiken kommen zu lassen, um anstatt ihrer Garderoben ihre Gedanken und Handlungen zu durchsuchen. Bevor ich jedoch damit beginne, möchte ich noch eine oder zwei Fragen an Sie richten.« Sie sind ein guter Beobachter. Haben Sie seit der Entdeckung des Verlustes des Diamanten bei irgend einem der Dienstboten, abgesehen von den ganz natürlichen Wirkungen des Schrecks, dem Zusammenstecken der Köpfe, dem Flüstern u. s. w. irgend etwas Auffallendes bemerkt: einen besonderen Streit unter ihnen, eine ungewöhnliche Gemüthserregung ein unerwartetes Aufbrausen oder ein plötzliches Unwohlsein und dergleichen?«
Ich hatte eben noch Zeit, an Rosanna Spearman’s gestriges Unwohlsein bei Tische zu denken, aber nicht mehr Zeit zum Antworten, denn plötzlich blickte Cuff seitwärts nach dem Gebüsch und sagte leise zu sich: »Halloh!«
»Was giebt’s?« fragte ich.
»Ein rheumatisches Zucken im Rücken,« sagte der Sergeant mit lauter Stimme, als ob er wünsche, daß eine dritte Person uns höre. »Das Wetter wird sich bald ändern!« Ein paar Schritte weiter brachten uns an die Ecke des Hauses; wir machten rechtsum kehrt, traten auf die Terrasse und gingen die Mitteltreppe hinab in den Garten. Hier wo man einen freien Ueberblick nach allen Seiten hin hatte, stand Sergeant Cuff still.
»A propos wegen der jungen Person Rosanna Spearman,« fing er an, »es ist nach ihrem Aeußern nicht sehr wahrscheinlich, daß sie einen Liebhaber hat. Aber um ihrer selbst willen muß ich Sie doch gleich fragen, ob das arme Ding, wie alle andern Mädchen, einen Schatz hat.«
Was in aller Welt konnte ihn veranlassen, mir unter den gegenwärtigen Umständen diese Frage zu stellen? Statt aller Antwort sah ich ihm starr in’s Gesicht.
»Ich habe Rosanna Spearman im Vorübergehen im Gebüsch versteckt gesehen.«
»Als Sie Halloh riefen?«
»In demselben Augenblick. Wenn sie einen Schatz hat, so hat das Verstecken nichts zu bedeuten, hat sie aber keinen, so ist es, wie die Dinge hier stehen, ein höchst verdächtiger Umstand, und ich werde zu meinem Bedauern genöthigt sein, demgemäß vorzugehen.«
Was sollte ich darauf sagen? —— Ich wußte, daß der Weg am Gebüsch Herrn Franklins Lieblingsspaziergang war, ich wußte, daß er höchst wahrscheinlich bei seiner Rückkehr dorthin gehen würde, ich wußte, daß Penelope hundertmal Rosanna sich dort hatte herumtreiben sehen, und daß sie immer behauptet hatte, der einzige Zweck des Mädchens dabei sei, Herrn Franklins Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wenn meine Tochter Recht hatte, so ist es nur zu wahrscheinlich, daß Rosanna in Erwartung von Herrn Franklin’s Rückkehr auf der Lauer stand. Ich befand mich also in der unangenehmen Alternative, entweder Penelopes Meinung als die meinige auszusprechen, oder das unglückliche Geschöpf den Folgen, den ernsten Folgen des Verdachts von Sergeant Cuff auszusetzen.
Aus reinem Mitleiden für das Mädchen —— auf Ehre und Gewissen, aus reinem Mitleiden gab ich dem Sergeanten den nöthigen Aufschluß, und erzählte ihm, daß Rosanna närrisch genug gewesen sei, sich in Herrn Franklin zu verlieben.
Sergeant Cuff lachte niemals —— bei den seltenen Gelegenheiten, wo ihn etwas ergötzte, zuckte er ein wenig mit den Mundwinkeln —— weiter nichts So zuckte er jetzt.
»Würden Sie nicht richtiger gesagt haben, sie ist närrisch genug, häßlich und nur ein Dienstmädchen zu sein?« fragte er. »Das Verlieben in einen Mann von Herrn Blakes Aussehen und Benehmen scheint mir bei Weitem nicht das Närrischste an ihrem Betragen. Indessen bin ich froh, die Sache aufgeklärt zu sehen. Es gewährt immer eine Beruhigung, wenn man klar sieht. Ja, ich werde die Sache für mich behalten, Herr Betteredge. Ich habe gern Nachsicht mit menschlichen Schwächen obgleich ich in meinem Beruf nicht viel Gelegenheit habe, diese Tugend zu üben. Glauben Sie, daß Herr Blake eine Ahnung von der Leidenschaft des, Mädchens für ihn hat? Wenn sie hübsch wäre, würde er es rasch genug gemerkt haben. Die häßlichen Mädchen haben ein trauriges Loos in dieser Welt, hoffen wir, daß es ihnen in der anderen besser gehen wird.
Nun sehen Sie einmal selbst, wie viel besser sich die Blumen zwischen Gras als zwischen Kies ausnehmen. Nein, ich danke, ich will keine Rose, es schneidet mir ins Herz, sie zu brechen, gerade wie es Ihnen ins Herz schneidet, wissen Sie, wenn im Domestikenzimmer etwas verkehrt geht. Haben Sie etwas Auffallendes an irgend einem der Dienstboten unmittelbar nach dem Verlust des Diamanten bemerkt?«
Bis jetzt war ich ganz gut mit dem Sergeanten ausgekommen; aber die Schlauheit, mit der er diese Frage herbeigeführt hatte, machte mich behutsam. Offen gestanden, sagte es mir durchaus nicht zu, ihm seine Fragen über meine Mitdienstboten zu beantworten.
»Ich habe nichts bemerkt,« sagte ich, außer daß wir Alle, ich selbst nicht ausgenommen, den Kopf verloren hatten.«
»O,« erwiderte Cuff, »ist das Alles, was Sie mir mitzutheilen haben?«
Ich antwortete mit, wie ich mir schmeichelte, undeutlicher Miene: »Alles!«
»Herr Betteredge,« sagte er, » geben Sie mir die Hand. Sie gefallen mir ganz außerordentlich!«
Warum er gerade den Augenblick, wo ich ihn hinterging, wählte, mir diesen Beweis seiner Hochachtung zu geben, übersteigt meine Fassungskraft. Ich war stolz, es erfüllte mich in der That mit einigem Stolz, daß der berühmte Cuff einmal seinen Mann gefunden hatte!
Wir gingen wieder ins Haus, wo mich der Sergeant bat, ihm ein Zimmer anzuweisen und ihm die zum Hause gehörenden Dienstboten, einen nach dem andern in der Reihenfolge ihres Ranges zu schicken. Ich führte den Sergeanten in mein eigenes Zimmer und rief dann die Dienstboten in die Halle zusammen.
Rosanna war unter ihnen und zeigte in ihrem Benehmen nichts Auffallendes. Sie war in ihrer Weise nicht weniger scharfblickend als der Sergeant in seiner und ich glaube beinahe, daß sie gehört hatte, was er über die Dienstboten im Allgemeinen gerade bevor er ihrer ansichtig wurde, zu mir gesagt hatte. Jedenfalls sah sie jetzt aus, als ob sie in ihrem Leben von einem Weg am Gebüsch nie etwas gehört habe. Ich schickte die Leute, einen nach dem andern, wie Sergeant Cuff gewünscht, zu ihm hinein.
Die Köchin war die erste, an welche die Reihe kam, die in einen Gerichtssaal verwandelte Stube zu betreten. Sie blieb nur eine kurze Weile dort. Ihr Bericht beim herauskommen lautete: »Sergeant Cuff ist in übler Stimmung, aber Sergeant Cuff ist ein vollendeter Gentleman.« Myladys Kammermädchen war die nächste. Sie berichten: »Wenn Sergeant Cuff einem respectablen Mädchen nicht glauben will, so sollte er wenigstens seine Meinung für sich behalten.« Dann kam Penelope; sie blieb nur wenige Augenblicke und berichten: »Sergeant Cuff ist sehr zu bedauern, er muß als junger Mann Unglück in der Liebe gehabt haben.« Auf Penelope folgte das erste Hausmädchem sie blieb, wie Myladys Kammermädchen, ziemlich lange und berichtete: »Ich habe die Stelle bei Mylady nicht aufgenommen, Herr Betteredge, um mir von einem niedrigen Polizeibeamten in’s Gesicht sagen zu lassen, daß er mir nicht glaubt.« Die nächste war Rosanna Spearman; sie blieb länger als irgend eine der Andern; sie berichtete nichts, sondern hielt ihre todtenbleichen Lippen fest verschlossen. Auf Rosanna folgte der Diener Samuel, der nur wenige Minuten blieb und berichtete: »Der Kerl, der Sergeant Cuffs Stiefel gewichst hat, sollte sich schämen!« Das Küchenmädchen Nancy war die letzte. Sie blieb nur wenige Minuten und berichtete: »Sergeant Cuff ist ein guter Mann, er erlaubt sich keine Späße mit einem armen Mädchen, Herr Betteredge!«
Als ich, nachdem das Verhör vorüber war, in den Gerichtssaal trat, um zu hören, ob etwas von mir gewünscht werde, fand ich den Sergeanten wieder bei seiner Lieblingsbeschäftigung Er sah zum Fenster hinaus und pfiff die »letzte Rose«. »Haben Sie etwas entdeckt, Herr Cuff?«
»Wenn Rosanna Sperman um Erlaubniß bittet, auszugehen, lassen Sie das arme Mädchen gehen, aber sagen Sie mir vorher Bescheid.«
Ich hätte doch wohl besser gethan, über Rosanna und Herrn Franklin zu schweigen. Es war klar, das Unglückliche Mädchen war trotz Allem, was ich dagegen thun mochte, dem Sergeanten verdächtig »Ich hoffe,« wagte ich zu bemerken, »Sie sind nicht der Ansicht, daß Rosanna etwas mit dem Verlust des Diamanten zu thun hat.« Der Sergeant zuckte mit den Mundwinkeln und sah mich scharf an, gerade wie er es im Garten gethan.
»Ich glaube, lieber Herr Betteredge, es ist besser, wenn ich Ihnen darauf nicht antworte. Sie möchten sonst, wissen Sie, Ihren Kopf zum zweiten Male verlieren.«
Jetzt stiegen leise Bedenken in mir auf, ob Sergeant Cuff wirklich seinen Mann an mir gefunden habe. Ich fühlte mich erleichtert, als wir hier durch Klopfen an der Thür und eine Botschaft von der Köchin unterbrochen wurden, Rosanna habe um Erlaubniß gebeten auszugehen, aus demselben Grunde wie gewöhnlich, weil sie Kopfschmerzen habe und gern frische Luft schöpfen wolle. Auf ein Zeichen des Sergeanten sagte ich »ja.« »Wo pflegen die Dienstboten hinaus zu gehen?« fragte er, als der Bote wieder fort war. Ich zeigte es ihm. »Schließen Sie Ihr Zimmer ab und sagen Sie, wenn Jemand nach mir fragt, ich sei hier und gehe mit mir zu Rath.«
Er zuckte wieder mit den Mundwinkeln und verschwand.
Als ich mich so allein fand, trieb mich eine verzehrende Neugierde, zu versuchen, ob ich nicht für mich allein etwas entdecken könne. Es war klar, daß Cuff’s Verdacht gegen Rosanna durch etwas, was er beim Verhör der Dienstboten entdeckt hatte, bestärkt worden war. Nun waren die einzigen beiden Dienstboten, welche außer Rosanna etwas längere Zeit verhört worden waren, Mylady’s Kammermädchen und das erste Hausmädchen, also dieselben, welche bei den Redereien gegen Rosanna die Andern immer angeführt hatten. Nachdem ich mir dies überlegt hatte, suchte ich mich wie zufällig im Domestikenzimmer an die Beiden zu machen und setzte mich zu ihnen an den Theetisch. Denn wohlgemerkt, ein Schluck Thee ist für eine weibliche Zunge so viel wie ein Tropfen Oel für eine ausgehende Lampe. Mein Vertrauen auf den Theetopf als einen Verbündeten ward nicht getäuscht. In weniger als einer halben Stunde wußte ich so viel wie der Sergeant selber. Weder das Kammermädchen noch das Hausmädchen hatten, wie es schien, an Rosanna’s Unwohlsein geglaubt. Diese beiden Teufel (ich bitte den Leser um Verzeihung, aber wie soll man boshafte Frauenzimmer anders nennen) hatten sich am Donnerstag zu wiederholten Malen hinaufgeschlichen Rosanna’s Thür verschlossen gefunden, hatten geklopft und keine Antwort bekommen, hatten gehorcht und nicht das leiseste Geräusch gehört. Als das Mädchen dann zum Thee heruntergekommen und, anscheinend noch leidend, wieder hinaufgeschickt worden war, hatten die besagten beiden Teufel die Thür abermals untersucht und wieder verschlossen gefunden, hatten durch’s Schlüsselloch sehen wollen und es verstopft gefunden, hatten um Mitternacht durch die Thürspalten einen Lichtschein wahrgenommen und hatten um vier Uhr Morgens das Geprassel eines Kaminfeuers vernommen —— Kaminfeuer im Zimmer eines Dienstmädchens im Juni! Alles das hatten sie vor dem Sergeanten Cuff ausgesagt, der aber zum Lohn für ihre Beflissenheit, ihn aufzuklären, sie mit einem sauern und argwöhnischen Blick entlassen und ihnen deutlich gezeigt hatte, daß er Keiner glaube. Daher die ungünstigen Berichte über ihn, welche diese beiden Mädchen nach dem Verhör erstattet hatten, daher auch, abgesehen von der Wirkung des Theetopfes ihre Bereitwilligkeit, ihren Zungen über das unfreundliche Benehmen des Sergeanten freien Lauf zu lassen. Da ich schon etwas von der feinen Art und Weise des großen Cuff kennen gelernt und ihn darauf bedacht gesehen hatte, Rosanna unbemerkt zu folgen, schien es mir klar, daß er es nicht für gerathen gehalten habe, Mylady’s Kammermädchen und dem Hausmädchen merken zu lassen, einen wie wesentlichen Dienst sie ihm geleistet hatten. Sie waren gerade die Art von Mädchen, die, wenn er ihre Aussage als glaubwürdig behandelt hätte, übermüthig geworden und im Stande gewesen wären, etwas zu thun oder zu sagen, was Rosanna veranlaßt hätte, auf ihrer Hut zu sein.
Ich ging in den schönen Sommerabend hinaus, wegen des armen Mädchens sehr besorgt, und über die Wendung der Dinge im Allgemeinen sehr ungehalten. Am Gebüsch traf ich Herrn Franklin auf seinem Lieblingsspaziergang. Er war schon eine Zeitlang von der Station zurück und hatte eine längere Unterredung mit Mylady gehabt. Sie hatte ihm die unbegreifliche Weigerung Fräulein Rachel’s, ihre Garderobe untersuchen zu lassen, mitgetheilt, und hatte ihn dadurch in eine so verdrießliche Stimmung versetzt, daß er durchaus nicht geneigt schien, sich über die Angelegenheit zu unterhalten. Zum ersten Male, so lange ich ihn kannte, sah ich ihn diesen Abend mit dem Ausdruck des Familien-Temperaments auf seinem Gesicht.
»Nun, Betteredge, wie behagt denn Ihnen die Atmosphäre von Geheimniß und Verdacht, in der wir jetzt leben? Erinnern Sie sich des Morgens, an dem ich hier zum ersten Mal mit dem Mondstein erschien? Wollte Gott, wir hätten ihn damals in den Zittersand versenkt.«
Nach diesem Ausbruch schwieg er, bis er sich wieder gefaßt hatte. Wir gingen ein paar Minuten schweigend neben einander her, bis er mich fragte, was aus Sergeant Cuff geworden sei. Es war unmöglich ihn mit der Ausflucht, daß der Sergeant in meinem Zimmer mit sich zu Rathe gehe, abzuspeisen, und ich berichtete ihm, was vorgefallen war, namentlich auch, was Myladys Kammermädchen und das Hausmädchen über Rosanna ausgesagt hatten. Herrn Franklins klarer Kopf ersah die Fährte, auf welcher sich Cuffs Verdacht befand, im Nu.
»Sagten Sie mir nicht diesen Morgen, daß der Bäckerjunge gestern auf dem Fußwege nach Frizinghall Rosanna begegnet sei, während wir sie unwohl auf ihrem Zimmer glaubten?«
»Ja wohl, Herr Blake.«
»Wenn die beiden Mädchen die Wahrheit gesagt haben, so können Sie sich darauf verlassen, daß der Junge ihr wirklich begegnet ist. Ihr Unwohlsein war nur erheuchelt, um uns zu hintergehen. Sie hatte ihre Gründe, die Stadt im Geheimen aufzusuchen. Das befleckte Kleidungsstück war das ihrige, und das Feuer, das die Mädchen um 4 Uhr Morgens in ihrem Zimmer prasseln hörten, hatte sie angezündet, um dasselbe zu verbrennen. Rosanna Spearman hat den Diamanten gestohlen! Ich will sogleich hineingehen und meine Tante von der Wendung der Dinge in Kenntniß setzen.«
»Noch nicht, wenn ich bitten darf,« sagte eine melancholische Stimme hinter uns.
Wir drehten uns um und fanden uns Cuff gegenüber.
»Warum jetzt noch nicht?« sagte Herr Franklin
»Weil, wenn Sie die Sache Mylady jetzt mittheilen, diese sie wieder Fräulein Verinder erzählen wird.«
»Und wenn nun? Was weiter?« Herr Franklin sprach mit Erregtheit und Heftigkeit, als ob der Sergeant ihn tödtlich beleidigt hätte.
»Halten Sie es für weise,« sagte der Sergeant ruhig, »mir eine solche Frage in einem Augenblicke wie dieser vorzulegen?« Es entstand eine Pause. Herr Franklin trat dicht an den Sergeanten heran, Beide sahen sich scharf ins Gesicht, Herr Franklin brach zuerst das Schweigen in einem Tone, »der eben so plötzlich wieder gedämpft klang, wie er kurz vorher leidenschaftlich gewesen war. »Sie vergessen hoffentlich nicht, Herr Cuff, daß es sich hier um eine delicate Affaire handelt.«
»Es ist nicht das erste Mal, daß ich mit delicaten Affairen zu thun habe,« antwortete der Andere, so unbeweglich wie je.
»Habe ich Ihre Worte dahin zu verstehen, daß Sie mir untersagen, meiner Tante das Vorgefallene mitzutheilen?«
»Sie haben mich gefälligst dahin zu verstehen, daß ich mich völlig von dieser Sache zurückziehen werde, wenn Sie Lady Verinder oder irgend Jemanden ohne meine Einwilligung Mittheilungen machen.«
Damit war die Sache abgemacht Herrn Franklin blieb keine Wahl, er mußte sich fügen; er wandte sich ärgerlich ab und verließ uns. Ich hatte während ihres Zwiegesprächs zitternd dagestanden, ohne zu wissen, was ich von der ganzen Sache denken solle. In meiner Verwirrung waren mir doch zwei Dinge klar geworden: erstens, daß unser Fräulein, mir unerklärlich, die eigentliche Ursache der scharfen Worte war, welche die Beiden gewechselt hatten; zweitens, daß sie, ohne vorher mit einander gesprochen zu haben, sich vollkommen verstanden.
»Herr Betteredge,« fing der Sergeant wieder an, »Sie haben in meiner Abwesenheit etwas sehr Verkehrtes gethan, Sie haben mir ein bischen in’s Handwerk gepfuscht In Zukunft möchte ich Sie freundlichst ersuchen sich dieser Beschäftigung nur in Gemeinschaft mit mir zu überlassen.« Er nahm meinen Arm und zog mich mit sich fort. Ich muß bekennen, daß sein Vorwurf nicht unbegründet war, dennoch wollte ich ihm nicht behilflich sein, Rosanna Fallen zu stellen. Ob sie die Diebin war oder nicht, ob ihre Handlungen vor dem Gesetz bestehen würden oder nicht, gleichviel, ich hatte Mitleid mit ihr. »Was wollen Sie von mir?« fragte ich, indem ich mich von ihm losmachte und stillstand.
»Nichts als eine kleine Auskunft über die hiesige Gegend.« Gegen eine Erweiterung von Sergeant Cuffs geographischen Kenntnissen konnte ich nichts einzuwenden haben.
»Giebt es in jener Richtung einen Weg, der von der Seeküste nach dem Hause führt?« fragte er, indem er auf die Tannenpflanzung wies, die zu dem Zitterstrande führte.
»Ja, es ist dort ein Weg.«
»Zeigen Sie ihn mir.«
Und alsbald machten wir uns an jenem trüben Sommerabend auf den Weg nach dem Zitterstrande.
Der Sergeant blieb still in Gedanken versunken, bis wir in die Tannenpflanzung traten, die zu dem Zitterstrand führt. Hier erwachte er wieder aus seiner Träumerei, wie Jemand der mit sich einig geworden ist, und fing wieder an mit mir zu reden.
»Herr Betteredge,« begann er, »da Sie mir die Ehre erweisen, mit mir an einem Strang zu ziehen und da Sie mir, wie ich hoffe, noch heute Abend behilflich sein werden, so sehe ich nicht ein, wozu wir einander noch länger mystificiren sollen und ich will Ihnen mit dem guten Beispiel einer offenen Sprache vorangehen. Sie sind entschlossen, mir keine nachtheilige Auskunft über Rosanna Spearman zu geben, weil sie sich gegen Sie gut betragen hat und weil Sie Mitleid mit ihr haben. Diese humanen Rücksichten machen Ihnen alle Ehre; es trifft sich aber in diesem Falle, daß diese humanen Rücksichten durchaus überflüssig sind. Rosanna ist nicht im Entferntesten in Gefahr, in Ungelegenheiten zu gerathen, selbst dann nicht, wenn ihre Betheiligung an dem Verschwinden des Diamanten so klar wäre, wie daß wir hier neben einander hergehen.«
»Meinen Sie,. daß Mylady sie unbehelligt lassen wird?«
»Ich meine; daß Mylady sie unbehelligt lassen muß Rosanna ist nur das Werkzeug in der Hand. einer andern Person und Rosanna wird dieser andern Person wegen unbehelligt bleiben.«
Er sprach wie Jemand der es ernst meint, darüber konnte mir kein Zweifel bleiben; dennoch erregte er in mir eine unheimliche Empfindung.
»Können Sie diese andere Person nicht nennen?«
»Können Sie sie nicht nennen, Herr Betteredge?«
»Nein.«
Sergeant Cuff stand wieder still und betrachtete mich mit melancholischer Theilnahme.
»Es gereicht mir immer zum Vergnügen, menschliche Schwächen mit zarter Rücksicht zu behandeln; in diesem Augenblick fühle ich mich zu solcher Rücksichtnahme gegen Sie gezwungen. Und Sie haben aus demselben Motive das zarteste Mitgefühl für Rosanna Spearman, nicht wahr, Herr Betteredge? Wissen Sie zufällig, ob Rosanna kürzlich mit neuer Leibwäsche ausgestattet ist?«
Was er mit dieser plötzlichen unerwarteten Zwischenfrage beabsichtigte war mir völlig unklar. Da ich keinen denkbaren Nachtheil für Rosanna zu erblicken vermochte, wenn ich die Wahrheit sagte, antwortete ich, daß sie bei ihrem Eintritt in unser Haus ziemlich dürftig versehen gewesen sei, und daß Mylady sie zur Belohnung für ihr gutes Betragen (ich betonte ihr gutes Betragen) vor noch nicht vierzehn Tagen ganz neu ausgestattet habe.
»Eine jämmerliche Welt!« rief Cuff aus. »Das menschliche Leben gleicht einer Schießscheibe, nach welcher das Unglück unablässig zielt und in welcher es immer das Schwarz: trifft. Hätte Rosanna diese Ausstattung nicht bekommen, so würden wir unter ihren Sachen ein neues Nachthemd oder einen neuen Unterrock gefunden und sie auf diese Weise überführt haben. Sie verstehen mich doch? Sie haben ja die Mädchen selbst verhört und wissen, welche Entdeckungen zwei von ihnen vor Rosannas Thür gemacht haben? Ohne Zweifel wissen Sie auch, was das Mädchen gestern, nachdem sie sich nicht wohl fühlte, begonnen hat. Nicht? Das ist doch so klar, wie der Lichtstreifen dort auf den Bäumen. Am Donnerstag Morgen um 11 Uhr zeigt der Oberbeamte Seagreaf —— dieser Klumpen menschlicher Beschränktheit —— allen weiblichen Dienstboten die übergewischte Stelle an der Thür Rosanna hat ihre guten Gründe, ihre eigenen Sachen für verdächtig zu halten. Sie ergreift die erste Gelegenheit auf ihr Zimmer zu kommen, findet den Farbefleck auf ihrem Nachthemd oder ihrem Unterrock, oder ihrem was weiß ich, stellt sich krank, und schleicht sich aus dem Hause nach der Stadt, kauft das Zeug zu einem neuen Nachthemd oder Unterrock, macht das Kleidungsstück in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ihrem Zimmer fertig, zündet ein Feuer an — nicht um das befleckte zu vernichten; zwei ihrer Mitmädchen suchen sie vor ihrer Thür auszuspioniren und sie ist zu klug, um Brandgeruch zu verbreiten und sich einen Haufen angebrannter Lumpen aufzuladen, den sie bei Seite schaffen müßte, —— zündet also ein Feuer an, sage ich, um das neue Kleidungsstück nachdem sie es gewaschen, zu trocken und zu plätten, hält das befleckte Kleidungsstück versteckt (wahrscheinlich an ihrem Leibe) und ist in diesem Augenblick damit beschäftigt, sich dessen an einer passenden Stelle, z. B. an jener einsamen Küstenstrecke, die vor uns liegt, zu entledigen. Ich habe sie diesen Abend nach Ihrem Fischerdorf, und zwar in eine bestimmte Hütte gehen sehen, der wir möglicher Weise einen Besuch abzustatten haben werden, bevor wir zurückkehren. Sie blieb eine Zeit lang in der Hütte und hielt, als sie wieder herauskam, wenn ich mich nicht irre, etwas unter ihrem Mantel verborgen. Ein Mantel auf dem Rücken eines Frauenzimmers ist ein Symbol der christlichen Liebe, er bedeckt eine Menge Sünden. Ich sah sie dann nordwärts längs der Küste gehen. Gilt Ihre Küste hier eine besonders schöne Seelandschaft, Herr Betteredge?«
Ich antwortete mit einem möglichst knappen »Ja«.
»Der Geschmack ist verschieden,« sagte Sergeant Cuff. »Von meinem Standpunkt aus betrachtet kann es keine häßlichere geben. Wenn Sie zufällig in der Lage sind, einer Person längs Ihrer Seeküste folgen zu müssen und diese Person sich umsieht, haben Sie auch nicht das kleinste Gebüsch, sich dahinter zu verstecken. Ich hatte nur die Wahl, entweder Rosanna aus den bloßen Verdacht hin zu verhaften, oder sie vor der Hand unbeachtet zu lassen. Aus Gründen, mit denen ich Sie nicht behelligen will, entschloß ich mich, lieber Alles im Stich zu lassen, als schon heute Abend eine gewisse Person, die wir Beide nicht nennen wollen, zu beunruhigen. Ich ging also in’s Haus zurück, um Sie zu bitten, mich auf einem andern Wege nach dem Nordende der Küste zu führen.
Sand ist in Anbetracht, daß er die Spuren menschlicher Fußtritte bewahrt, einer der besten Gehilfen der geheimen Polizei. Wenn wir Rosanna auf diesem Wege nicht begegnen, so wird uns der Sand verrathen, wohin sie gegangen ist, vorausgesetzt, daß es lange genug hell bleibt. Hier ist der Sand. Wenn Sie’s nicht übel nehmen wollen, möchte ich Sie bitten, sich still zu verhalten und mich vorangehen zu lassen.«
Wenn es in der medicinischen Wissenschaft eine Krankheit giebt, die man das Entdeckungsfieber nennen könnte, so hatte mich diese Krankheit jetzt in vollstem Maaße erfaßt. Sergeant Cuff ging voran über die Sandhügel hinunter an den Strand. Ich folgte klopfenden Herzens und wartete in einiger Entfernung ab, was geschehen werde.
Als ich näher zusah, fand es sich, daß ich fast auf derselben Stelle stand, wo Rosanna und ich damals miteinander gesprochen hatten, als Herr Blake nach seiner eben erfolgten Ankunft von London plötzlich vor uns stand. Während meine Blicke dem Sergeanten folgten, beschäftigte sich mein Geist unwillkürlich mit dem was vorgegangen war. Jener Moment stand wieder so lebendig vor mir, daß ich fast die Hände des Mädchens in den meinigen fühlte, wie sie sie dankbar gedrückt hatte, weil ich ihr freundlich zusprach; daß ich ihre Stimme hörte, wie sie mir erzählte, daß der Zitterstrand eine geheimnißvolle Anziehungskraft auf sie übe, so oft sie an den Strand gehe; daß ich ihr vor Freude strahlendes Gesicht sah als Herr Franklin durch die Hügel munter auf uns zu kam. Ich wurde traurig als ich dieser Dinge gedachte, und der Anblick der einsamen kleinen Bucht stimmte mich nur noch trüber. Die Sonne ging nun völlig unter und über der einsamen Gegend lag eine geheimnißvolle drückende Stille. Die Fluthwellen ergossen sich lautlos über die große Sandbucht; weiter hinaus. lag das Meer regungslos da. Schmutzig gelber Schaum setzte sich am Strande und am Fuße der nördlich und südlich in die See hinausragenden Felsen ab, wo noch ein letzter Strahl ihn traf. Es war eben der Moment des Eintritts der Fluth, und die braune Oberfläche des Zittersandes begann sich in Bewegung zu setzen — das einzige Bewegliche in dieser Einöde. Ich sah, wie der Sergeant mit Ueberraschung das Zittern des Sandes betrachtete, dann wandte er sich um und kehrte zu mir zurück.
»Hier» ist nichts zu sehen, Herr Betteredge, keine Spur von Rosanna Spearman.«
Er nahm mich mit sich weiter hinunter an den Strand, wo ich mich überzeugte, daß seine und meine Fußtritte die einzigen waren, deren Abdruck im Sande erkennbar blieben.
»In welcher Richtung liegt das Fischerdorf?«
»Cob’s Hole (so heißt das Fischerdorf) liegt in südlicher Richtung,« erwiderte ich.
»Ich sah das Mädchen heute Abend in nördlicher Richtung von Cob’s Hole, folglich hierher gehen. Liegt Cob’s Hole an der andern Seite der Landspitze und können wir jetzt, wo noch Ebbe ist, längs des Strandes hingelangen?«
Ich bejahte beide Fragen.
»Wenn’s Ihnen recht ist, wollen wir unverzüglich hingeben. Ich möchte die Stelle, wo sie den Strand verlassen hat, finden, ehe es völlig Nacht ist.«
Wir mochten ein paar Hundert Schritte in der Richtung nach Cob’s Hole gemacht haben, als Cuff sich aus die Kniee warf, dem Anschein nach, von einem plötzlichen Bedürfniß sein Gebet zu verrichten, ergriffen.
»Hier endlich zeigt es sich, daß Ihre Seelandschaft doch zu etwas gut ist; hier sind weibliche Fußstapfen. Herr Betteredge, nehmen wir an, es seien Rosanna’s, bis wir einen Beweis des Gegentheils finden. Sehr undeutliche Fußspuren, wie Sie bemerken werden, absichtlich undeutlich, scheint mir; das arme Ding versteht sich auf die polizeilichen Eigenschaften des Sandes so gut wie ich; doch scheint sie in zu großer Eile gewesen zu sein, um die Spuren gänzlich zu verwischen; hier sind Spuren in der Richtung von Cob’s Hole auf hier, dort wieder andere in entgegengesetzter Richtung. Erkennen Sie nicht in diesen Spuren, die auf den Rand des Wassers zuführen, die Spitze ihres Schuhes? Und sind nicht das da weiterhin, auch am Rande des Wassers, zwei Hackenspuren? Ich will Sie nicht kränken, aber ich fürchte, Rosanna ist schlau. Es sieht aus, als habe sie beabsichtigt nach der Stelle, von der wir kommen, hinzugehen und jede Spur ihrer Tritte zu verwischen?
Wollen wir annehmen, daß sie von hier bis zu den Felsen und wieder zurück durchs Wasser ging und den Strand wieder betrat, wo die Hackenspuren sichtbar sind?
Ja, das wollen wir annehmen; das scheint auch mit meiner Annahme zu stimmen; daß sie etwas unter ihrem Mantel trug, als sie die Hütte verließ; —— nicht etwas, was sie vernichten wollte, wozu wären dann alle Vorsichtsmaßregeln gewesen, um das Ausfindig machen ihres Weges zu verhindern. Wahrscheinlicher wird, das sie etwas zu verstecken hatte. Vielleicht verhilft uns ein Besuch in der Hütte dazu, es herauszufinden!«
Bei diesem Vorschlage kühlte mein Entdeckungsfieber plötzlich ab.
»Dazu,« sagte ich, »bedürfen Sie meiner nicht, was kann ich Ihnen dabei nützen?«
»Je länger ich das Vergnügen Ihrer« Bekanntschaft genieße, Herr Betteredge, desto mehr Tugenden entdecke ich an Ihnen. Du lieber Gott, wie selten findet man Bescheidenheit in dieser Welt. Und wie viel besitzen Sie von dieser seltenen Tugend. Wenn ich allein in die Hütte gehe, werden die Leute bei der ersten an sie gerichteten Frage verstummen, wenn ich aber mit Ihnen komme, so erscheine ich von einem mit Recht geachteten Manne eingeführt, und eine zwanglose Unterhaltung muß sich sogleich entspinnen. Das ist meine Meinung, wie denken Sie darüber?«
Da ich keine so treffende Antwort, wie ich sie zu geben gewünscht hätte, bereit hatte, versuchte ich durch die Frage Zeit zu gewinnen, nach welcher Hütte er gehen wolle.
Nach der Beschreibung des Sergeanten erkannte ich die Hütte als die des Fischer Yolland, der dieselbe mit seiner Frau und zwei erwachsenen Kindern, Sohn und Tochter, bewohnte. Der Leser wird sich erinnern, daß ich, als ich Rosanna zuerst einführte, erzählte, sie besuche aus ihren Spaziergängen nach dem Zitterstrand bisweilen Freunde in Cob’s hole. Diese Freunde waren Yollands, ordentliche, in gutem Rufe stehende Leute. Rosanna’s Bekanntschaft mit ihnen war durch die Tochter vermittelt, die einen mißgestalteten Fuß hatte und unter dem Namen der hinkenden Lucy bekannt war. Die beiden verwachsenen Mädchen hatten vermuthlich eine Art Sympathie für einander; gewiß ist, daß Rosanna und die Yollands, wenn sie zusammenkamen, im besten Vernehmen zu stehen schienen. Die Thatsacha daß Sergeant Cuff dem Mädchen bis zu ihrer Hütte nachgegangen war, ließ meine Hilfsleistungen bei diesen Nachforschungen in einem ganz neuen Lichte erscheinen. Rosanna hatte nur einen ihrer gewöhnlichen Wege gemacht; und wenn ich nachweisen konnte, daß sie sich in der Gesellschaft des Fischers und seiner Familie befunden habe, so war das so gut wie ein Beweis dafür, daß sie bis dahin in einer durchaus unschuldigen Weise beschäftigt gewesen, war. Ich würde daher dem Mädchen nicht einen Schaden zufügen, sondern vielmehr einen Dienst leisten, wenn ich mich von Sergeant Cuffs Logik leiten ließ. Ich erklärte mich also für völlig überzeugt. Wir gingen nun nach Cob’s Hole und sahen uns auf unserm Wege fortwährend, so lange das Dämmerlicht es noch gestattete, von den Fußstapfen im Sande begleitet. In der Hütte angelangt, erfuhren wir, daß der Fischer und dessen Sohn in ihrem Boot ausgefahren seien, und daß die hinkende Lucy, die immer schwach und kümmerlich war, oben auf ihrem Bette liege. Die gute Frau Yolland empfing uns allein in ihrer Küche. Als sie hörte, daß Sergeant Cuff eine berühmte Londoner Persönlichkeit sei, stellte sie eine Flasche Genever und ein Paar reine Pfeifen auf den Tisch und starrte ihn an, als ob sie sich nicht satt an ihm sehen könne. Ich setzte mich ruhig in eine Ecke und war begierig, zu hören, wie der Sergeant das Gespräch auf Rosanna Spearman bringen werde. Bei dieser Gelegenheit schien er sich seinem Gegenstande noch auf weiteren Umwegen als gewöhnlich nähern zu wollen Wie er es anfing, hätte ich selbst in jenem Augenblick nicht zu sagen gewußt und wüßte ich heute noch weniger zu sagen. Ich weiß nur so viel, daß er zuerst von der königlichen Familie, den ersten Methodisten und dem Preis der Fische sprach, und daß er wie auf einem geheimnißvoll unterirdischen Wege zu dem Verschwinden des Mondsteins, dem Groll unseres ersten Hausmädchens gegen Rosanna und dem unfreundlichen Benehmen unserer weiblichen Dienstboten insgesammt gegen dieselbe gelangte. Nachdem er die Unterhaltung aus diese Weise endlich auf den Punkt gebracht hatte, wo er sie haben wollte, schilderte er als den Zweck seiner Untersuchung in Betreff des verlornen Diamanten theils die Auffindung desselben, theils die Reinigung Rosanna’s von den ungerechten Verdächtigungen ihrer Feinde im Hause. Nach Verlauf einer Viertelstunde war die gute Frau Yolland fest überzeugt, daß sie mit Rosanna’s bestem Freunde rede, und drang in den Sergeanten, sich mit einem Schnaps den Magen zu stärken und seine Lebensgeister aufzufrischen. Da ich fest überzeugt war, daß der Sergeant seine Beredtsamkeit an Frau Yolland verschwende amüsirte ich mich an ihrer Unterhaltung ungefähr, wie ich mich ehedem im Theater zu amüsiren pflegte. Der große Cuff entwickelte eine wunderbare Geduld, indem er unverdrossen sein Glück auf alle Weise versuchte und so zu sagen Schuß aus Schuß aufs Gerathewohl abfeuerte, in der Hoffnung, doch irgendeinmal das Schwarze zu treffen. Aber er mochte versuchen, was er wollte, Alles in der ganzen Unterhaltung mit der redseligen, vom vollsten Vertrauen zu Cuff beseelten Frau Yolland lautete zu Rosanna’s Gunsten, nichts zu ihrem Nachtheil. Er machte noch einen letzten Versuch, nachdem wir nach unserer Uhr gesehen hatten und bereits ausgebrochen waren.
»Ich muß Ihnen nun gute Nacht sagen, liebe Frau,« sagte Cuff, »Und,« fuhr er fort, ich habe nur noch zu sagen, daß Rosanna Spearman an mir, Ihrem ergebenen Diener, einen aufrichtigen Freund hat.
Aber, lieber Gott, in ihrer jetzigen Stelle wird sie nie zu etwas kommen, und ich würde ihr rathen, dieselbe zu verlassen.«
»Sie,will sie ja auch verlassen,« rief Frau Yolland.
Rosanna uns verlassen! Bei diesen Worten spitzte ich die Ohren. Es war, gelinde gesagt, sehr ausfallend, daß sie nicht vor allen Dingen Mylady oder mir ihre Absicht sollte kundgegeben haben. Es stieg eine leise Vermuthung in mir auf, daß Sergeant Cuff mit diesem letzten Schuß am Ende doch das Schwarze getroffen haben möchte. Ich fing wieder an zu zweifeln, ob mein Antheil an demVerfahren ganz so harmlos sei, wie ich mir eingebildet hatte. Es mochte dem Sergeanten in seinem Kram passen, eine rechtschaffene Frau zu mystificiren und in ein Lügengewebe zu verstricken, aber mir, als gutem Protestanten, lag es ob, nicht zu vergessen, daß der Teufel der Vater der Lüge ist und daß, wo der Teufel seinen Sitz aufgeschlagen bat, das Unheil nie weit entfernt ist. Da ich Unrath witterte, suchte ich den Sergeanten hinauszubringen; er aber setzte sich nieder und bat um einen letzten Tropfen Labsal aus der Geneverflasche. Frau Yolland setzte sich ihm gegenüber und gab ihm das Verlangte. Ich ging in höchst unbehaglicher Stimmung an die Thür, sagte, ich müsse ihnen gute Nacht wünschen, ging aber doch nicht.
»Also sie will fort,« begann der Sergeant wieder. »Und was denkt sie weiter zu thun? Das arme Kind hat ja in der Welt keinen Freund als Sie und mich.»
»O doch,« erwiderte Frau Yolland »Sie kam diesen Abend, wie ich Ihnen schon erzählt habe, hierher, und bat, nachdem sie sich eine Zeit lang mit mir und Lucy unterhalten hatte, um die Erlaubniß, allein auf Lucy’s Zimmer gehen zu dürfen. Da steht unser einziges Schreibzeug. Ich möchte einen Brief an einen guten Freund schreiben, sagte sie, und drüben im Hause kann ich vor dem Gucken und Spioniren der anderen Domestiken nicht dazu kommen. An wen der Brief war, kann ich nicht sagen, aber nach der Zeit, die sie dabei zubrachte, muß er ungeheuer lang gewesen sein. Als sie herunterkam, bot ich ihr eine Briefmarke an —— sie hatte aber den Brief nicht in der Hand und wollte auch die Marke nicht. Ein bischen verschlossen ist sie ja immer über Alles, was sie betrifft und thut. Aber daß sie irgendwo einen Freund hat, ist sicher, und zu diesem Freunde wird sie gehen, darauf können Sie sich verlassen.«
»Und bald?« fragte Cuff
»Sobald sie kann,« antwortete Frau Yolland.
Bei diesen Worten tratt ich wieder von der Schwelle ins Zimmer. Als Mylady’s Haushofmeister durfte ich nicht zugeben, daß in solcher Weise über das Bleiben und Fortgehen eines unserer Dienstboten in meiner Gegenwart gesprochen werde.
»Sie müssen sich in Betreff Rosanna’s irren,« sagte ich, »wenn sie beabsichtigte, ihre jetzige Stelle zu verlassen, so würde sie mir zuerst Anzeige davon gemacht haben.«
»Irren?« rief Frau Yolland. »Warum hat sie denn vor einer Stunde in diesem Zimmer von mir selbst einige Sachen gekauft, deren sie zu einer Reise bedarf? —— Dabei fällt mir ein,« sagte die langweilige Person, indem sie plötzlich in ihrer Tasche kramte, »daß ich etwas an Rosanna wegen ihres Geldes zu sagen habe. Wird Einer von Ihnen Sie noch sehen, wenn Sie nach Hause kommen?«
»Ich werde mit dem größten Vergnügen eine Bestellung an das arme Mädchen übernehmen,« erwiderte Sergeant Cuff, bevor ich ein Wort einschalten konnte. Frau Yolland holte aus ihrer Tasche einige Shillings- und Sixpence-Stücke und zählte sie mit der ermüdendsten und ängstlichsten Sorgfalt in ihrer flachen Hand auf. Sie gab sie dem Sergeanten mit dem Ausdrucke großen Schmerzes über die Trennung von denselben.
»Darf ich Sie bitten, Rosanna dies mit meinen besten Grüßen zu bringen?« sagte Frau Yolland. »Sie bestand darauf, die paar Sachen, die sie diesen Abend gern von mirhaben wollte, zu bezahlen, und Geld ist bei uns immer sehr willkommen, das kann ich nicht leugnen. Es drückt mich aber doch, daß ich von den Ersparnissen des armen Dinges etwas genommen habe, und die Wahrheit zu gestehen, ich glaube auch, mein Mann würde böse sein, wenn er morgen früh bei seiner Rückkehr nach Hause erführe, daß ich Rosanna Geld abgenommen habe. Bitte, sagen Sie ihr, daß ich ihr die Sachen, die sie von mir gekauft hat, gern schenke. Und lassen Sie das Geld keinen Augenblick auf dem Tisch liegen,« sagte Frau Yolland, indem sie es dicht vor den Sergeanten hinlegte, als ob es ihr in der Hand brenne —— »denn es sind schlechte Zeiten und das Fleisch ist schwach und ich könnte in Versuchung gerathen, das Geld wieder in die Tasche zu stecken.«
»Bitte, kommen Sie mit,« sagte ich nun, »ich kann nicht länger warten, ich muß nach Hause.«
»Ich folge Ihnen gleich,« sagte Cuff.
Zum zweiten Male ging ich an die Thür, zum zweiten Male konnte ich, ich mochte es versuchen wie ich wollte, mich nicht dazu bringen, die Schwelle zu überschreiten.
»Es ist eine delicate Sache,« hörte ich« Cuff sagen, »Geld zurückzugeben Sie haben ihr die Sachen gewiß billig überlassen.«
»Billig?« sagte Frau Yolland. »Urtheilen Sie selbst« Sie nahm ein Licht und leuchtete in eine Ecke der Küche. Und wenn es mir das Leben gekostet hätte, ich mußte ihr folgen. In der Ecke lag ein Hausen Gerümpel (meistens altes Metall), welches der Schiffer sich zu verschiedenen Malen von gestrandeten Schiffen angeeignet und für das er noch keinen Käufer gefunden hatte. Frau Yolland versenkte sich in dies Gerümpel und holte eine alte lackirte zinnerne Büchse hervor, mit einem Deckel und einem Haken zum Aufhängen, —— eine Art Behälter, wie man sich ihrer auf Schiffen zum Schutz von Seekarten und dergleichen gegen Nässe bedient.
»Das« sagte sie. »Eine ganz ähnliche Büchse wie diese hat Rosanna heute Abend gekauft. Die ist grade gnt,« sagte sie, »um meine Kragen und Manchetten glatt hineinzulegen, damit sie nicht im Koffer kraus werden.
Dafür habe ich einen Shilling und neun Pence genommen, Herr Cuff, so wahr ich lebe, keinen Heller mehr.«
»Spottbillig!« sagte der Sergeant mit einem tiefen Seufzer.«
Er wog die Büchse in seiner Hand. Mir kam es vor, als hörte ich ihn ein paar Töne der letzten Rose summen, als er sie ansah. Kein Zweifel mehr! Er hatte wieder eine Entdeckung zu Rosanna’s Nachtheil gemacht, und das an einem Ort, wo ich sie gegen jede Beschuldigung sicher geglaubt hatte, und noch dazu durch meine Hilfe.
Ich überlasse es dem Leser, sich meine Empfindungen auszumalen und sich vorzustellen, wie sehr ich bereute, die Bekanntschaft von Frau Yolland und Sergeant Cuff vermittelt zu haben.
»Nun ist’s genug,« sagte ich. »Wir müssen wirklich fort.«
Ohne die geringste Notiz von mir zu nehmen, versenkte sich Frau Yolland zum zweiten Male in’s Gerümpel und langte eine Hundekette hervor.
»Bitte, wiegen Sie das in Ihrer Hand« sagte sie zum Sergeanten »Wir hatten drei solche Ketten und Rosanna hat mir zwei davon abgenommen. Was wollen Sie mit Hundekettem liebes Kind?« fragte ich sie. »Wenn ich sie an einander befestige,« antwortete sie, »werde ich sie um meinen Koffer schlingen können« »Ein Strick ist aber billiger,« sagte ich. »Aber Ketten sind sicherer,« erwiderte sie. »Wer hat sein Lebtag gehört, daß ein Koffer mit Ketten zugebunden wird?« sagte ich wieder. »O, Frau "Yolland,« entgegnete sie, »machen Sie keine Einwendungen, geben Sie mir, bitte, die Ketten!« Ein sonderbares Mädchen, Herr Cuff, ein Herz wie Gold und wie eine Schwester gegen meine Lucy, aber immer ein bischen sonderbar. Nun, ich that ihr den Gefallen. Ich forderte drei Shilling sechs Pence, auf mein ehrliches Wort, Herr Cuff, drei Shilling sechs Pence!«
»Für jede?« fragte Cuff.
Für beide zusammen drei Shilling sechs Pence,« lautete ihre Antwort.
»Geschenkt, liebe Frau,« sagte der Sergeant kopfschüttelnd, »rein geschenkt!«
»Da ist das Geld,« sagte Frau Yolland, indem sie sich wieder dem Häufchen Silber auf dem Tische zuwandte, als ob es sie unwiderstehlich anziehe. Die Blechbüchse und die Hundeketten waren das Einzige, was sie von mir kaufte und mitnahm. Ein Shilling neun Pence und drei Shilling sechs Pence macht zusammen fünf Shilling und drei Pence. Geben Sie sie ihr, bitte, mit meinen Grüßen zurück —— ich könnte es nicht über mich gewinnen, einem armen Mädchen ihre Ersparnisse abzunehmen, die sie ja gewiß selbst so nöthig, hat.«
»Und ich kann es nicht übers Herz bringen, das Geld wieder zu geben,« sagte Sergeant Cuff, »Sie haben ihr ja die Sachen so gut wie geschenkt.«
»Ist das wirklich Ihre Meinung?« fragte Frau Yolland mit einem strahlenden Gesicht.
»Wie können Sie daran zweifeln,« erwiderte der Sergeant. »Fragen Sie Herrn Betteredge.« Das half ihm zu nichts —— Alles, was sie aus mir herausbrachten, war: »Gute Nacht.«
»Ueber das elende Geld!« sagte Frau Yolland.
Mit diesen Worten schien sie alle Herrschaft über sich zu verlieren, packte das Geld mit einem Griff zusammen und steckte es hastig wieder in ihre Tasche.
»Ich kann es nicht aushalten, es da liegen zu sehen, ohne daß Jemand es zu sich nimmt,« rief die unvernünftige Person, setzte sich wieder hin und sah den Sergeanten an, als wollte sie sagen: »Jetzt ist’s wieder in meiner Tasche, holen Sie es sich heraus, wenn Sie können.«
Diesmal begnügte ich mich nicht an die Thür zu treten, sondern ging wirklich auf die Straße. Ohne mit erklären zu können warum, war mir zu Muthe, als ob einer von Beiden oder Beide mich tödtlich beleidigt hätten. Bevor ich drei Schritte gethan, hörte ich den Sergeanten hinter mir.
»Meinen besten Dank für Ihre Einführung, Herr Betteredge,« sagte er. »Ich verdanke der Fischersfrau eine ganz neue Empfindung. Frau Yolland hat mich irre gemacht.«
Ich hatte ein scharfes Wort auf der Zunge, nicht weil ich angehalten auf ihn, sondern weil ich angehalten auf mich selbst war. Als er aber gestand, irre geworden zu sein, fuhr mir der tröstliche Zweifel durch den Sinn, ob überhaupt etwas Schlimmes geschehen sei. Ich verharrte in vorsichtigem Schweigen, um mehr zu hören.
»Ja,« sagte der-Sergeant, als ob er meine Gedanken trotz der Dunkelheit läse, »bei Ihrem Interesse an Rosanna wird es Ihnen lieb sein zu hören, daß Sie, statt mich auf die richtige Fährte zu bringen, mich in die Irre geführt haben. Was das Mädchen diesen Abend gethan hat, ist klar genug. Sie hat die beiden Ketten zusammen an den Haken der Zinnbüchse befestigt. Sie hat die Büchse in’s Wasser oder in den Zittersand versenkt. Sie hat das lose Ende der Kette an eine nur ihr bekannte Stelle unter dem Felsen befestigt, und sie wird die Büchse an ihrem Anker sicher verwahrt ruhig liegen lassen, bis die gegenwärtige Untersuchung zu Ende ist; nachher wird sie die Büchse in einem gelegenen Augenblicke wieder aus dem Versteck holen. So weit ist Alles vollkommen klar. Aber,« fuhr der Sergeant mit einem ungeduldigen Ton fort, den ich znm ersten Mal bei ihm hörte, »das Geheimniß ist: was zum Teufel hält sie in der Büchse versteckt?«
Ich dachte bei mir: den Mondstein. Zum Sergeanten sagte ich aber nur: »Können Sie es nicht errathen?«
»Der Diamant ist es nicht,« sagte Cuff »Alle Erfahrungen meines Lebens sind nichtig, wenn Rosanna Spearman den Diamanten hat!«
Bei diesen Worten ergriff mich wieder das höllische Entdeckungsfieber, Ich vergaß mich völlig über dem gespannten Interesse, dies neue Räthsel zu lösen. Ich sagte rasch: »Das befleckte Kleidungsstück.«
Sergeant Cuff stand still und legte seine Hand auf meinen Arm. »Ist jemals etwas, das man in den Zittersand geworfen, wieder auf die Oberfläche gekommen?« fragte er.
»Niemals,« antwortete ich. »Was man in den Zittersand wirft, gleichviel ob leicht oder schwer, wird von dem selben aufgesogen und kommt nicht wieder zum Vorschein.«
»Weiß Rosanna das?«
»So gut wie ich.«
»Was in aller Welt hatte sie dann weiter nöthig, als einen Stein an das befleckte Kleidungsstück zu binden und es so in den Zittersand zu werfen? Da ist nicht der Schatten eines Grundes, warum sie dasselbe verstecken sollte und doch muß sie es verfteckt haben. ——«
»Die Frage ist«, fuhr er weiter gehend fort, »ist das mit Farbe befleckte Kleidungsstück ein Unterrock oder Nachthemd, oder etwas Anderes, welches sie trotz aller Gefahr aufzubewahren gute Gründe hat? Herr Betteredge, wenn nichts dazwischen kommt, muß ich morgen nach Frizinghall, um herauszufinden, was sie dort gekauft hat, als sie das Zeug für ein neues Kleidungsstück anschaffte. Es ist freilich etwas gewagt, das Haus zu verlassen, wie die Dinge jetzt stehen, aber es ist noch gewagter noch länger im Dunkeln zu tappen. Entschuldigen Sie, wenn ich etwas verdrießlich bin; ich fühle mich in meiner eigenen Achtung herabgesetzt —— Rosanna Spearman hat mich irregeführt.«
Bei unserer Rückkehr saßen die Dienstboten beim Abendessen. Der Erste, dem wir im Hofe begegneten, war der Polizei-Officiant, den Seegreaf zu des Sergeanten Disposition zurückgelassen hatte. Cuff fragte, ob Rosanna zurückgekehrt sei?
»Ja«
»Wann?«
»Ungefähr vor einer Stunde.«
»Was hatte sie dann gethan?«
»Sie war hinauf gegangen, um Hut und Mantel abzulegen —— und saß jetzt ruhig mit den Uebrigen beim Abendessen.«
Ohne eine Bemerkung zu machen ging Sergeant Cuff weiter nach der Hinterseite des Hauses, tiefer und tiefer in seiner eigenen Achtung sinkend. Er verfehlte die Thür unn Dunkeln und ging, ohne auf mein Rufen zu achten, bis an ein Gitterpförtchen, das in den Garten führte. Als ich zu ihm trat, um ihn auf den rechten Weg zu führen, fand ich ihn aufmerksam nach einem der Fenster in der Schlafstuben-Etage, an der Hinterseite des Hauses blicken.
Als ich auch hinblickte, fand ich, daß der Gegenstand seiner Betrachtung Fräulein Rachel’s Fenster war, und daß sich Lichter vor demselben auf und abbewegten, als ob etwas Ungewöhnliches vorgehe.
»Ist das nicht Fräulein Verinders Zimmer?« fragte Cuff.
«Ich bejahte die Frage und forderte ihn auf, mit mir, zum Abendessen zu gehen. Er blieb ruhig stehen und sagte etwas über den Genuß der Abendlust im Freien. Ich überließ ihn diesem Genuß und hörte, als ich in’s Haus trat, einige Töne der »Letzten Rose« vom Gitterpförtchen her. Sergeant Cuff hatte offenbar eine neue Entdeckung gemacht! Und diesmal vermittelst des Fensters unseres jungen Fräuleins. Diese Erwägung führte mich zum Sergeanten zurück, dem ich höflich erklärte, ich könne es nicht übers Herz bringen, ihn allein zu lassen.
»Sehen Sie da oben irgend etwas Auffallendes?« fügte ich hinzu, auf Fräulein Rachel’s Fenster deutend. Nach dem Tone seiner Stimme zu urtheilen, hatte Sergeant Cuff die Achtung vor sich selbst auf einmal wieder gewonnen. »Ihr seid hier in Yorkshire stark im Wetten, nicht wahr?«
»Und wenn nun?«
»Wenn ich ein Yorkshiremann wäre,« fuhr der Sergeant, mich beim« Arme nehmend, fort, »würde ich Ihnen eine Wette von einem Sovereign anbieten, daß Ihr Fräulein plötzlich den Entschluß gefaßt hat, das Haus zu verlassen. Wenn ich die Wette gewönne, würde ich noch einen Sovereign pariren, daß ihr die Idee erst vor einer Stunde gekommen ist.«
Die erste Vermuthung erschreckte mich, die zweite berührte sich gewissermaßen in meinem Kopf mit dem Bericht des Polizei-Officianten, daß Rosanna vor einer Stunde vom Strande zurückgekehrt sei. Beide Vermuthungen zusammen brachten eine sonderbare Wirkung auf mich hervor, als wir zum Essen hineingingen. Ich machte mich vom Sergeanten los und drängte mich, meiner gewöhnlichen Höflichkeit uneingedenk, vor ihm in die Thür, um mich selbst zu erkundigen.
Der Diener Samuel war der Erste, aus den ich stieß.
»Die gnädige Frau wünscht Sie und Sergeant Cuff zu sprechen,« rief er mir entgegen, bevor ich eine Frage an ihn richten konnte.
»Seit wann wünscht sie uns zu sprechen?« ertönte die Stimme des Sergeanten hinter mir.«
»Seit einer Stunde.«
Das stimmte abermals. Rosanna war nach Hause gekommen. Fräulein Rachel hatte einen ungewöhnlichen Entschluß gefaßt, und Mylady hatte den Sergeanten zu sprechen gewünscht —— alles seit einer Stunde.
Es war keine angenehme Entdeckung, daß so verschiedene Dinge und Personen sich auf diese Weise zu einem Ganzen zusammenfügten. Ich ging hinauf ohne den Sergeanten anzusehen oder mit ihm zu reden. Meine Hand zitterte, als ich sie erhob, um an die Thür meiner Herrin zu klopfen.
»Es sollte mich nicht wundern,« flüsterte der Sergeant mir zu, »wenn wir heute Abend noch einen Auftritt im Hause erlebten. Aber seien Sie ruhig! Ich habe schon schwierigere Familien-Differenzen beigelegt, als diese.«
Als er so sprach, hörte ich Mylady’s Stimme »Herein!« rufen.

Fünfzehntes Capitel
Wir fanden Mylady in ihrem nur durch eine kleine Arbeitslampe erleuchteten Zimmer. Ihr Gesicht war von dem Lampenschirm beschattet. Statt in ihrer gewohnten raschen Weise uns anzusehen, heftete sie ihre Augen fest auf ein vor ihr liegendes offenes Buch.
»Herr Beamter,« sagte sie, »ist es für die von Ihnen geleitete Untersuchung von Wichtigkeit, daß Sie davon in Kenntniß gesetzt werden, ob eine im Hause befindliche Person dasselbe zu verlassen wünscht?«
»Von der größten Wichtigkeit, Mylady.«
»In diesem Fall habe ich Ihnen mitzutheilen, daß Fräulein Verinder beabsichtigt, ihre Tante, Mrs. Ablewhite, in Frizinghall zu besuchen. Sie hat ihre Einrichtungen getroffen, uns morgen in aller Frühe zu verlassen.«
Sergeant Cuff sah mich an. Ich that einen Schritt vorwärts, um Mylady anzureden, da ich aber fühlte, daß mir der Muth dazu fehlte, that ich den Schritt wieder zurück und sagte nichts.
»Darf ich Sie fragen, Mylady, wann Fräulein Verinder den Entschluß gefaßt hat, ihre Tante zu besuchen?« fragte der Sergeant.
»Vor ungefähr einer Stunde.«
Der Sergeant sah mich zum zweiten Male an. Man sagt, alte Leute seien der Aufregung wenig unterworfen! Mein Herz hätte mit fünfundzwanzig Jahren nicht stärker schlagen können, als in diesem Augenblick.
»Ich habe kein Recht,« sagte Cuff, »Fräulein Verinder in ihren Handlungen zu behindern. Alles, was ich Sie zu thun bitte, ist, wo möglich zu bewirken, daß sie etwas später abreist. Ich muß morgen früh selbst nach Frizinghall, und werde spätestens um zwei Uhr zurück sein. Wenn Fräulein Verinder bis dahin zurückgehalten werden könnte, möchte ich ihr gern, bevor sie abreist, ohne daß sie darauf vorbereitet wäre, zwei Worte sagen.«
Mylady hieß mich dem Kutscher die Ordre überbringen, daß der Wagen für Fräulein Rachel morgen nicht vor zwei Uhr vorfahren solle.
»Haben Sie mir noch etwas zu sagen?« fragte sie dann den Sergeanten.
»Nur noch ein Wort, gnädige Frau. Sollte Fräulein Verinder über diese veränderten Dispositionen erstaunt sein, so wollen Sie gefälligst nicht erwähnen, daß ich dieselben veranlaßt habe.«
Mylady blickte plötzlich von ihrem Buch aus, als ob sie noch etwas sagen wolle —— that sich aber Gewalt an und entließ uns dann schweigend mit einer Handbewegung.
»Das ist eine ausgezeichnete Frau,« bemerkte Sergeant Cuff in der Halle »Wenn sie sich nicht so zu beherrschen wüßte, so wäre es mit dem Geheimniß, das Sie, Herr Betteredge, so quält, zu Ende.«
Bei diesen Worten drang die Wahrheit endlich in meinen dummen alten Kopf. Im ersten Augenblick war ich, glaube ich, ganz von Sinnen. Ich faßte den Sergeanten beim Kragen und drückte ihn gegen die Wand.
»Hol’ Sie der Teufel« rief ich — »mit Fräulein Rachel ist etwas nicht in Ordnung und das haben Sie schon die ganze Zeit vor mir geheim gehalten.«
Sergeant Cuff sah zu mir auf, ohne eine Hand aufzuheben oder auch eine Muskel seines melancholischen Gesichts zu zucken.
»Was Sie sagen?« antwortete er, »haben Sie es endlich errathen?«
Ich ließ ihn los und mein Kopf sank auf meine Brust.
Der Leser möge sich zur Entschuldigung für meine Heftigkeit erinnern, daß ich der Familie fünfzig Jahre lang gedient habe. Fräulein Rachel war als Kind oft genug auf meine Knie geklettert und» hatte mich am Backenbart gezupft Fräulein Rachel war nach meiner Meinung trotz aller ihrer Fehler die hübscheste und beste junge Herrin, die jemals ein alter Diener verehrt und bedient hatte. Ich bat Sergeant Cuff um Verzeihung, aber ich that es, fürchte ich, mit Thränen in den Augen und in einer nicht sehr angemessenen Weise.
»Bettrüben Sie sich nicht, Herr Betterredge,« sagte der Sergeant in einem freundlicheren Tone, als ich von ihm zu erwarten irgend berechtigt war. »Wenn Leute meines Berufs leicht empfindlich sein wollten, so wären sie nicht das Salz zur Grütze werth. Bitte, fassen Sie mich getrost noch einmal am Kragen, wenn es Sie irgend erleichtert. Sie verstehen sich ganz und gar nicht darauf; aber in Betracht Ihrer gerechtfertigten Empfindungen will ich Ihnen Ihre Ungeschicklichkeit zu Gute halten.«
Er zuckte in seiner melancholischen Weise mit den Mundwinkeln und schien zu glauben, daß er einen sehr guten Witz gemacht habe.
Ich führte ihn in mein kleines Zimmer und schloß die Thür hinter uns. »Sagen Sie mir die Wahrheit, Sergeant,« sagte ich. »Wohin geht Ihr Verdacht? Es wäre nicht freundlich von Ihnen, es noch länger vor mir zu verbergen.«
»Ich habe gar keinen Verdacht,« sagte der Sergeant. »Ich bin meiner Sache gewiß.«
Mein unglückliches Temperament fing wieder an, die Herrschaft über mich zu gewinnen.
»Wollen Sie mir damit zu verstehen geben,« rief ich aus, »daß Fräulein Rachel ihren eignen Diamanten gestohlen hat?«
»Ja,« antwortete der Sergeant, »das meine ich und das sage ich Ihnen. Fräulein Verinder hat sich von Anfang an heimlich im ungestörten Besitz des Mondsteins befunden und Rosanna Spearman in ihr Vertrauen gezogen, weil sie voraus zu sehen glaubte, daß wir Rosanna des Diebstahls für schuldig halten würden. Da haben Sie die ganze verwickelte Geschichte in zwei Worten. Fassen Sie mich nur getrost wieder am Kragen, Herr Betteredge. Wenn es Ihrem Herzen die mindeste Erleichterung verschafft, fassen Sie mich nur wieder an.«
Gott sei mir gnädig! Das konnte mir keine Erleichterung verschaffen. »Theilen Sie mir Ihre Gründe mit,« war Alles, was ich sagen konnte.
»Meine Gründe sollen Sie morgen hören; wenn Fräulein Verinder sich weigert, den Besuch bei ihrer Tante aufzuschieben, wie es unzweifelhaft geschehen wird, so werde ich morgen genöthigt sein, Ihrer Herrin den ganzen Fall vorzulegen, und da ich nicht weiß, wozu das führen kann, werde ich Sie bitten gegenwärtig zu sein, um zu hören, was auf beiden Seiten gesprochen wird. Lassen Sie die Sache jetzt ruhen, Herr Betteredge, heute Abend bekommen Sie kein Wort über den Mondstein mehr aus mir heraus. Hier ist das Abendbrod für uns bereit. Das ist eine der menschlichen Schwächen, die ich mit Vorliebe behandle. Wollen Sie klingeln, so will ich das Tischgebet sprechen. Für alle gute Gabe. . .«
»Ich wünsche Ihnen guten Appetit dazu, Sergeant,« sagte ich. »Mir ist der Appetit vergangen. Ich will dafür sorgen, daß Sie gut bedient werden, und dann mit Ihrer gütigen Erlaubniß fortgehen und sehen, ob ich nicht allein wieder zu Gange kommen kann.«
Ich sorgte dafür, daß ihm die besten Bissen vorgesetzt wurden und wäre nicht böse gewesen, wenn er an diesen besten Bissen erstickt wäre. In diesem Augenblick trat der Obergärtner Begbie mit seiner Wochenrechnung herein. Der Sergeant ließ sich auf der Stelle in ein Gespräch über Rosen und die Vorzüge von Graswegen vor Kieswegen mit ihm ein.
Ich überließ die Beiden einander und ging mit schwerem Herzen hinaus. Das war seit vielen Jahren der erste Verdruß, den ich nicht durch einen Zug aus meiner Pfeife loswerden konnte und der selbst den Wirkungen Robinson Crusoe’s widerstand.
In meiner Ruhelosigkeit und traurigen Gemüthsverfassung machte ich, da es mir in diesem Augenblick an einem eigenen Zimmer fehlte, einen Gang auf der Terrasse und überdachte die Sache in Ruhe und Frieden. Auf das, was ich dachte, kommt nicht viel an. Ich fühlte mich jämmerlich alt und abgenutzt und meiner Stelle nicht mehr gewachsen und fing zum ersten Mal in meinem Leben darüber nachzudenken an, wann es Gott wohl gefallen werde mich zu sich zu nehmen. Bei alledem aber hielt ich fest an meinem Vertrauen auf Fräulein Rachel. Wenn Sergeant Cuff der König Salomo in aller seiner Glorie gewesen wäre und mich versichert hätte, daß mein junges Fräulein in ein unwürdiges und schuldvolles Complott verwickelt sei, so hätte ich auch für den weisen Salomo nur die einzige Antwort gehabt: Sie kennen sie nicht und ich kenne sie.
Aus meinem Nachdenken wurde ich durch Samuel aufgestört. Er brachte mir eine geschriebene Botschaft von meiner Herrin. Während ich mit ihm in’s Haus ging, um die Ordre bei Licht zu lesen, bemerkte Samuel, daß das Wetter sich zu ändern scheine. Mein bekümmerter Gemüthszustand hatte mich verhindert, darauf zu achten. Aber jetzt, wo ich aufmerksam geworden war, hörte ich die Hunde ängstlich bellen und den Wind leise stöhnen. Zum Himmel aufschauend sah ich die Wolken vom Winde gejagt sich immer schwärzer zusammenballen und immer rascher den Mond verhüllen. Ein böses Wetter war im Anzuge —— Samuel hatte Recht.
Die Botschaft Mylady’s benachrichtigte mich, daß sie von dem Magistrat in Frizinghall eine Zuschrift in Betreff der drei Indier erhalten habe, demzufolge die Spitzbuben Anfangs nächster Woche nothwendig wieder in Freiheit gesetzt werden müßten. Falls wir noch weitere Fragen an sie zu richten hätten, wäre daher keine Zeit zu verlieren. Da sie dies bei ihrer letzten Begegnung mit Sergeant Cuff gegen ihn zu erwähnen vergessen habe, so bat mich meine Herrin jetzt, es nachträglich zu thun.
Die Indier waren mir total entfallen, wie es ohne Zweifel auch dem Leser ergangen sein wird. Ich vermochte nicht einzusehen, wozu es dienen könne, aus sie zurückzukommen Indessen parirte ich selbstverständlich aus der Stelle meiner Ordre.
Ich fand Sergeant Cuff und den Gärtner mit einer Flasche schottischen Whisky zwischen sich bis über die Ohren in eine Diskussion über Rosenzucht vertieft. Der Sergeant war von derselben so eingenommen, daß er mir die Hand mit einer Bewegung entgegenhielt, welche mich das Gespräch nicht unterbrechen hieß. So weit ich dasselbe verstand, war die Frage, um die es sich zwischen ihnen handelte, ob die weiße Moosrose, um gut zu gedeihen, auf die wilde Rose gepfropft werden müsse oder nicht. Der Obergärtner Begbie sagte »Ja«; Sergeant Cuff sagte »Nein«. Sie appellirten an mich mit dem hitzigen Eifer von einem Paar streitenden Knaben. Da ich von der Rosenzucht absolut gar nichts verstand, so steuerte ich einen mittleren Curs —— gerade wie es die Richter machen, wenn das Züngelchen an der Wage der Gerechtigkeit genau einsteht.
»Meine Herren« bemerkte ich, »es läßt sich viel für beide Ansichten sagen.«
Während des durch diesen unparteiischen Ausspruch zeitweilig eingetretenen Waffenstillstands legte ich Mylady’s geschriebene Botschaft auf den Tisch unter die Augen des Sergeanten.
Ich hatte in jenem Augenblick schon einen herzhaften Groll gegen den Sergeanten gefaßt, aber, der Wahrheit die Ehre zu geben, sein Scharfsinn war wahrhaft bewundernswerth.
Eine halbe Minute, nachdem er die Botschaft gelesen, hatte er sich des Berichts des Oberbeamten Seegreaf erinnert, den Theil desselben in’s Auge gefaßt, welcher die Indier betraf, und hatte seine Antwort bereit. Er fragte mich, ob nicht ein berühmter Reisender, welcher der indischen Sprache kundig gewesen sei, in dem Bericht eine Rolle gespielt habe. Ich bestätigte das. Gut! Ob ich den Namen und die Adresse des Herrn kenne? Ich bejahte diese Frage. Auch gut!« Ob ich die Güte haben wolle, dieselben auf die Rückseite von Mylady’s Botschaft zu schreiben? —— Ich that es. Sehr verbunden! Sergeant Cuff erklärte, er wolle den Herrn am nächsten Morgen, wenn er nach Frizinghall komme, aufsuchen.
»Versprechen Sie sich davon irgend etwas?« fragte ich. »Der Oberbeamte Seegreaf fand die Indier so unschuldig wie das Kind im Mutterleibe.«
»Alle Behauptungen des Oberbeamten Seegreaf haben sich bis jetzt als falsch erwiesen,« antwortete der Sergeant. »Es lohnt sich der Mühe, morgen zuzusehen, ob sich der Oberbeamte Seegreaf nicht auch in Betreff der Indier geirrt hat.«
Mit diesen Worten wandte er sich wieder zu dem Gärtner Begbie und nahm die Discussion mit demselben genau an derselben Stelle wieder auf, wo ich sie unterbrochen hatte.
»Die zwischen uns streitige Frage, Herr Gärtner, ist eine Frage des Bodens und der Jahreszeit, der Sorgfalt und der Geduld. Erlauben Sie mir, Ihnen die Frage noch aus einem andern Gesichtspunkte vorzuführen. Sie nehmen Ihre weiße Moosrose ——«
Das waren die letzten Worte, die ich hinausgehend beim Schließen der Thür hörte.
Auf meinem Wege fand ich Penelope unbeschäftigt herumstehen und fragte sie, worauf sie warte.
Sie wartete auf das Klingeln ihres jungen Fräuleins, das für sie ein Zeichen sein werde, daß sie mit dem Einpacken für die am nächsten Tage bevorstehende Reise fortfahren solle. Durch weitere Fragen brachte ich heraus, daß Fräulein Rachel als Grund ihres Wunsches, ihre Tante in Frizinghall zu besuchen, angegeben habe, daß ihr der Aufenthalt unter einem Dache mit dem widerwärtigen Polizeibeamten unerträglich sei. Als sie vor einer halben Stunde erfahren habe, daß ihre Abreise bis um 2 Uhr Nachmittags am nächsten Tage verschoben worden, sei sie ganz außer sich gerathen. Mylady, die gerade zugegen gewesen, habe ihre Tochter wegen ihres Benehmens scharf getadelt und habe dann —— augenscheinlich um derselben etwas allein zu sagen — Penelope hinausgeschickt. Mein Kind war äußerst niedergeschlagen über den veränderten Zustand der Dinge im Hause.
»Alles geht verkehrt, Vater; alles ist jetzt anders als früher. Mir ist zu Muth, als ob wir Alle von einem schrecklichen Unglück bedroht wären.«
Mir selbst war eben so zu Muth. Aber ich nahm mich vor meiner Tochter zusammen. Während wir so miteinander sprachen, ertönte Fräulein Rachel’s Glocke. Penelope eilte die Hintertreppe hinauf, um mit dem Einpacken fortzufahren. Ich ging in die Halle, um zu sehen, was der Barometer über die Veränderung des Wetters besage. In dem Augenblick, wo ich mich der von der Halle in die Domestikenräume führenden Flügelthür näherte, wurde dieselbe von der andern Seite her mit der größten Heftigkeit geöffnet, und Rosanna Spearman eilte mit dem Ausdruck großer Bestürzung und mit einer Hand auf dem Herzen, als ob dieses der Sitz ihres Kummers sei, an mir vorüber.
»Was ist Dir, mein Kind?« fragte ich, ihr in den Weg tretend; »bist Du krank?«
»Um Gottes willen, sprechen Sie nicht mit mir«, antwortete sie, und dabei entwand sie sich meinen Armen und lief auf die Domestikentreppe zu. Ich rief der Köchin, die in der Nähe war, zu, nach dem armen Mädchen zu sehen. Außer der Köchin waren noch zwei andere Personen so nah, daß sie uns hätten hören können. Sergeant Cuff schoß rasch und wie ein Pfeil aus meinem Zimmer und fragte, was vorgefallen sei. Ich antwortete: »Nichts«. Im nächsten Augenblick riß Herr Franklin die Flügelthür aus und winkte mir in die Halle zu kommen, wo er auch fragte, ob ich etwas von Rosanna Spearman gesehen habe.
»Sie ist eben in diesem Augenblick mit einem ganz verstörten Gesicht und in einer sehr ausfallenden Weise an mir vorüber gelaufen, Herr Franklin.«
»Ich fürchte, Betteredge, ich bin die unschuldige Ursache dieser Verstörung.«
»Sie, Herr!«
»Ich weiß es mir nicht zu erklären,« erwiderte Herr Franklin, »aber wenn das Mädchen etwas mit dem Verlust des Diamanten zu thun hat, so glaube ich wahrhaftig, sie war vor noch nicht zwei Minuten im Begriff, mir, und mir allein von allen Menschen in der Welt, alles einzugestehen.«
Als ich bei seinen letzten Worten nach der Flügelthür blickte, kam es mir vor, als werde sie von der inneren Seite ein klein wenig geöffnet.
Sollte Jemand horchen? Die Thür hatte sich schon wieder geschlossen, bevor ich zusehen konnte. Als ich einen Augenblick später durch die Thür sah, glaubte ich die Schöße von Sergeant Cuffs respectablem Frack eben um die Ecke verschwinden zu sehen. Er wußte so gut wie ich, daß er jetzt, wo ich über die Spuren, die er bei seinen Nachforschungen verfolgte, unterrichtet war, keine Hilfe mehr von mir zu erwarten habe. Unter diesen Umständen entsprach es seinem Charakter vollkommen, daß er sich selbst und zwar aus Schleichwegen zu helfen suchte.
Da ich aber meiner Sache nicht völlig gewiß war und nicht gern unnöthigerweise Unheil anstiften wollte, wo —— Gott weiß es! — schon Unheil genug im Schwange war, sagte ich zu Herrn Franklin, einer der Hunde scheine sich ins Haus geschlichen zu haben —— und bat ihn dann mir mitzutheilen, was zwischen ihm und Rosanna vorgefallen sei.
»Gingen Sie gerade durch die Halle?« fragte ich. »Trafen Sie sie zufällig, als Sie mit ihnen sprach?«
Herr Franklin deutete aus das Billard hin.
»Ich spielte eben mit den Bällen,« sagte er, »und suchte mir die unglückselige Diamantengeschichte aus dem Kopf zu schlagen, — da blickte ich auf und siehe! da stand Rosanna Spearman neben mir wie ein Geist. Diese Art, sich an mich heranzuschleichen, war so sonderbar, daß ich wirklich im ersten Augenblick nicht wußte, was ich thun solle. Da ich ihre ängstlichen Mienen sah, fragte ich sie, ob sie mich zu sprechen wünsche. Sie antwortete: »Ja, wenn ich darf« Da ich wußte, welcher Verdacht auf ihr ruhe, konnte ich mir diese Sprache nur auf eine Weise erklären. Ich gestehe, daß ich mich dabei sehr unbehaglich fühlte. Ich hatte durchaus kein Verlangen, der Beichtvater des Mädchens zu werden. Auf der andern Seite durfte ich mich, in Betracht der schwierigen Lage, in der wir uns hier jetzt befinden, doch nicht für berechtigt halten, ihr mein Ohr zu verschließen, wenn sie wirklich entschlossen war, mit mir zu reden. Ich befand mich in einer unbequemen Position, aus der ich mich, fürchte ich, ungeschickt genug herauszog. Ich sagte zu ihr: »Ich verstehe Dich nicht ganz. Wünschest Du, daß ich etwas für Dich thue? Denken Sie nicht, Betteredge, daß ich dabei unfreundlich war! Das arme Mädchen kann nichts dafür, daß sie häßlich ist. Dessen war ich mir wohl bewußt. Ich hatte noch einen Billardstock in der Hand und fuhr fort, mit den Bällen zu spielen, um mich von dem Gefühl der Unbehaglichkeit zu befreien. Bald aber zeigte es sich, daß ich damit die Sache nur schlimmer machte. Ich fürchte, ich habe sie unabsichtlich gekränkt. Plötzlich eilte sie wieder davon. »Er denkt an die Billardkugeln! an Alles eher als an mich!« hörte ich sie sagen. Bevor ich sie noch zurückhalten konnte, war sie schon aus der Halle.
Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache, Betteredge, Möchten Sie es wohl übernehmen, Rosanna zu sagen, daß ich nicht unfreundlich gegen sie habe sein wollen? Ich bin vielleicht in meinen Gedanken etwas hart gegen sie gewesen. Ich habe beinahe gehofft, daß der Verlust des Diamanten auf sie zurückgeführt werden könne. Nicht aus irgend einer Abneigung gegen das arme Mädchen, sondern ——«
Hier hielt er inne, trat wieder an das Billard und fing wieder an, mit den Kugeln zu spielen.«
Nach dem, was zwischen dem Sergeanten und mir vorgefallen war, wußte ich so gut wie Herr Franklin selbst, was er unausgesprochen gelassen hatte.
Nichts als die Entdeckung der Spuren des Mondsteins bei dem zweiten Hausmädchen konnte jetzt Fräulein Rachel von dem infamen Verdachte befreien, der nach Sergeant Cuff’s Ansicht auf ihr ruhte. Es handelte sich nicht mehr darum, die aufgeregten Nerven unseres jungen Fräuleins zu beschwichtigen, sondern darum, ihre Unschuld zu beweisen. Wenn Rosanna nichts gethan hätte sich zu compromittiren, so wäre die Hoffnung, welche Herr Franklin gehegt zu haben bekannte, in der That hart genug gewesen. Aber so lag die Sache nicht. Sie hatte sich krank gestellt und war heimlich nach Frizinghall gegangen. Sie war die ganze Nacht auf gewesen, um heimlich etwas herzustellen oder zu vernichten. Und sie war, gelinde gesagt, unter sehr verdächtigen Umständen an jenem Abend am Zitterstrand gewesen. Aus allen diesen Gründen konnte ich, so leid mir Rosanna that, Herrn Franklins Art, die Sache anzusehen, bei seiner Stellung weder unnatürlich noch unverständig finden. Ich sprach mich in diesem Sinne gegen ihn aus.
»Ja, ja,« erwiderte er. »Aber es ist doch eine, wenn auch sehr schwache Möglichkeit vorhanden, daß Rosanna’s Benehmen eine Erklärung zuläßt, die wir jetzt noch nicht begreifen. Es widerstrebt mir, hart gegen Frauen zu sein, Betteredge Sagen Sie dem armen Geschöpf, um was ich Sie gebeten habe, und wenn sie gern mit mir sprechen will —— einerlei, ob ich dadurch in Ungelegenheit gerathe oder nicht —— so schicken Sie sie mir in die Bibliothek.«
Mit diesen freundlichen Worten legte er den Billardstock hin und ging fort.
Aus meine Frage im Domestikenzimmer erfuhr ich, daß Rosanna sich auf ihr Zimmer zurückgezogen habe. Sie hatte allen Beistand entschieden abgelehnt und nur gebeten, sie in Ruhe zu lassen. Für diesen Abend war es also mit ihrem Geständniß (wenn sie wirklich ein solches hatte ablegen wollen) nichts. Ich berichtete dieses Resultat an Herrn Franklin, der darauf die Bibliothek verließ und zu Bett ging.
Ich war eben im Begriff, die Lampen zu löschen und die Fenster zu schließen, als Samuel mit Nachrichten von den beiden Gästen, die ich in meinem Zimmer gelassen hatte, zu mir trat. Die Discussion über die weiße Moosrose war offenbar zu Ende geführt worden. Der Gärtner war nach Hause gegangen und Sergeant Cuff in den unteren Regionen allein zurückgeblieben.
Ich sah in mein Zimmer. Samuels Bericht bestätigte sich. Nichts in dem Zimmer verrieth die Gäste, die es eben verlassen hatten, als ein Paar leere Gläser und ein starker Geruch von Grog. War der Sergeant allein auf das für ihn bereit stehende Schlafzimmer gegangen? Ich ging hinaus, um nachzusehen.
Auf dem zweiten Treppenabsatz angelangt, kam es mir vor, als höre ich an meiner linken Seite ein ruhiges und regelmäßiges Athmen. Auf meiner linken Seite lag der Corridor, welcher zu Fräulein Rachel’s Zimmer führte. Ich sah näher zu und siehe, da lag und schlief auf drei quer über den Weg stehenden Stühlen, ein rothes Tuch um seinen grauen Kopf gebunden, mit seinem zum Kissen zusammengerollten respectablen schwarzen Frack unter dem Kopfe, Sergeant Cuff.
Er erwachte, rasch und ruhig wie ein Hund, in dem Moment, wo ich mich ihm näherte.
»Gute Nacht, Herr Betteredge!« sagte er. »Und vergessen Sie’s nicht, wenn Sie jemals dazu kommen, sich mit der Rosenzucht zu beschäftigen: die weiße Moosrose gedeiht nur, wenn sie nicht aus die wilde Rose gepfropft wird, was auch der Gärtner für die entgegengesetzte Ansicht sagen mag.«
»Was machen Sie hier?« fragte ich. »Warum sind Sie nicht in Ihrem Bett?«
»Ich liege nicht in meinem Bett,« antwortete der Sergeant, »weil ich zu den vielen Leuten in dieser elenden Welt gehöre, welche ihren Unterhalt nicht leicht und ehrlich zugleich erwerben können. Offenbar bestand ein Zusammenhang zwischen dem Entschluß Fräulein Verinder’s, das Haus zu verlassen, und der Rückkehr Rosanna Spearman’s vom Strande. Was Rosanna auch immer versteckt haben mag, so viel ist für mich klar, daß ihr junges Fräulein nicht fortgehen konnte, bis sie wußte, daß jenes Etwas wirklich versteckt sei. Beide müssen diesen Abend schon einmal im Geheimen mit einander verkehrt haben. Für den Fall, daß sie es versuchen sollten, noch einmal zusammenzukommen, wenn es im Hause ruhig geworden ist, will ich ihnen im Wege sein und es verhindern. Sie dürfen den Eingriff in Ihre Schlafzimmer-Dispositionen nicht mir, sondern nur dem Diamanten zur Last legen, Herr Betteredge.«
»Ich wünschte zu Gott, der Diamant hätte nie seinen Weg in dieses Haus gefunden.« brach ich aus.«
Sergeant Cuff blickte mit einem kläglichen Gesicht auf die drei Stühle, auf welchen die Nacht zuzubringen er sich selbst verurtheilt hatte, und erwiderte feierlich: »Ich auch»

Sechzehntes Capitel.
Während der Nacht ereignete sich nichts, und, wie ich mich freue hinzufügen zu können, kein Versuch einer Begegnung zwischen Fräulein Rachel und Rosanna belohnte die Wachsamkeit des Sergeanten Cuff.
Ich hatte erwartet, daß der Sergeant am Morgen in aller Frühe nach Frizinghall ausbrechen werde. Er zögerte jedoch mit seiner Abreise, als ob er noch vorher etwas Anderes zu thun habe. Ich überließ ihn seinen Plänen, ging bald darauf in den Garten und begegnete Herrn Franklin auf seinem Lieblings-Spaziergang an der Seite des Gebüsches.
Ehe wir noch zwei Worte mit einander gesprochen hatten, trat der Sergeant unerwarteter Weise zu uns. Er ging auf Herrn Franklin zu, der ihn, die Wahrheit zu gestehen, sehr hochmüthig empfing. »Haben Sie mir irgend etwas zu sagen?« war seine ganze Antwort auf, den freundlichen »Guten Morgens« den ihm der Sergeant bot.
»Ich habe Ihnen etwas in Betreff der Untersuchung zu sagen, die ich hier leite,« antwortete der Sergeant. »Sie haben gestern die Wendung, welche diese Untersuchung in der That nimmt, richtig errathen. Sehr erklärlicher Weise sind Sie in Ihrer Stellung darüber betroffen und mißgestimmt. Sehr erklärlicher Weise suchen Sie ferner Ihren Verdruß über den Scandal in Ihrer Familie an mir auszulassen.«
»Was wollen Sie von mir?« unterbrach ihn Herr Franklin in scharfem Ton.
»Ich will Sie nur darauf aufmerksam machen, daß bis jetzt wenigstens die Unrichtigkeit meiner Auffassung nicht erbracht ist. Sie wollen das gefälligst nicht aus dem Auge verlieren und sich zugleich erinnern, daß ich hier als ein Organ des Gesetzes unter der Sanction der Frau vom Hause fungire. Ist es unter diesen Umständen, frage ich Sie, Ihre Pflicht, mir als ein guter Bürger mit irgend welcher Ihnen zu Gebote stehenden besonderen Wissenschaft an die Hand zu gehen oder nicht?«
»Ich befinde mich im Besitz keiner solchen besonderen Wissenschaft,« antwortete Herr Franklin.
Sergeant Cuff schien von dieser Antwort gar keine Notiz zu nehmen, sondern fuhr fort: »Sie könnten mir die Zeit einer an einem anderen Orte vorzunehmenden Untersuchung ersparen, wenn Sie mich verstehen und sich aussprechen wollten.«
»Ich verstehe Sie nicht,« antwortete Herr Franklin, »und habe Ihnen nichts zu sagen.«
»Eines der Dienstmädchen —— ich wünsche keinen Namen zu nennen —— hat gestern Abend im Geheimen mit Ihnen gesprochen.«
Abermals ließ ihn Herr Franklin abfallen; abermals antwortete er: »Ich habe Ihnen nichts zu sagen.«
Ich stand schweigend dabei und dachte an die Bewegung der Flügelthür am vorhergehenden Abend und an die Rockschöße, die ich hatte verschwinden sehen. Sergeant Cuff hatte unzweifelhaft, noch bevor ich ihn hatte stören können, gerade genug gehört, um ihm den Verdacht einzuflößen, daß Rosanna ihr Gewissen durch ein Herrn Franklin Blake gemachtes Geständniß erleichtert habe.
Kaum hatte ich das gedacht, als am Ende des Gebüschweges —— wer anderes erschien als Rosanna Spearman in eigener Person. Penelope folgte ihr auf dem Fuße und war offenbar bemüht, sie zur Umkehr in’s Haus zu bewegen. Als Rosanna sah, daß Herr Franklin nicht allein sei, stand sie plötzlich still und war ersichtlich in großer Verlegenheit, was sie nun thun solle. Penelope blieb hinter ihr stehen. -—- Herr Franklin war die Mädchen in demselben Augenblick wie ich gewahr geworden. Der Sergeant mit seiner teuflischen Verschlagenheit, gab sich das Ansehen die Mädchen gar nicht bemerkt zu haben. Alles dieses trug sich in einem kurzen Augenblick zu. Noch ehe Herr Franklin oder ich ein Wort sagen konnten, fiel Sergeant Cuff ruhig, als ob er die eben unterbrochene Unterhaltung wieder aufnehme, mit der Bemerkung ein:
»Sie brauchen nicht zu fürchten, Herr Franklin dem Mädchen irgendwie zu schaden,« und sagte diese Worte so laut, daß Rosanna ihn hören konnte. »Im Gegentheil kann ich Ihnen nur rathen, mich mit Ihrem Vertrauen zu beehren, wenn Sie irgend ein Interesse an Rosanna Spearman nehmen.«
Jetzt gab sich auch Herr Franklin seinerseits das Ansehen, die Mädchen nicht bemerkt zu haben und antwortete eben so laut:
»Ich nehme nicht das mindeste Interesse an Rosanna Spearman.«
Ich sah nach den Mädchem aber alles was ich in der Entfernung wahrnehmen konnte war, daß Rosanna sich in dem Augenblick, wo Herr Franklin die letzten Worte gesprochen hatte, plötzlich umwandte. Anstatt sich, wie sie es noch einen Augenblick vorher gethan hatte, Penelope’s Bemühungen zu widersetzen, ließ sie diese jetzt ruhig ihren Arm ergreifen und sich in’s Haus zurückführen.
In dem Augenblick, wo die beiden Mädchen verschwanden, ertönte die Frühstücksglocke und selbst Sergeant Cuff sah sich genöthigt, die Sache jetzt als ein vergebliches Stück Arbeit aufzugeben. Er sagte ruhig zu mir:
»Ich werde nach Frizinghall gehen, Herr Betteredge, und werde bis um 2 Uhr wieder hier sein.«
Ohne ein Wort weiter zu sagen ging er seines Weges und während einiger weniger Stunden hatten wir uns seiner Abwesenheit zu erfreuen.
»Sie müssen die Sache mit Rosanna in Ordnung bringen,« sagte Herr Franklin zu mir, als wir allein waren. »Ich scheine dazu bestimmt zu sein, jederzeit vor dem unglücklichen Mädchen etwas Ungeschicktes zu thun oder zu sagen. Sie werden selbst gemerkt haben, daß Sergeant Cuff uns Beiden eine Falle stellen wollte., Wenn es ihm gelang, mich außer Fassung zu bringen oder sie zu einem Ausspruch zu reizen, so hätte vielleicht Einer von uns, sie oder ich, etwas gesagt, was seinem Zwecke entsprochen haben würde. Im Moment sah ich keinen bessern Ausweg, als den ich ergriffen habe. Auf diese Weise habe ich doch das Mädchen verhindert, irgend etwas zu sagen und dem Sergeanten gezeigt, daß ich ihn durchschaut habe. Er hat offenbar gehorcht, Betteredge, als ich gestern Abend mit Ihnen sprach.«
Er hat etwas Schlimmeres gethan als horchen, dachte ich bei mir. Er hat sich meiner Mittheilung erinnert, daß das Mädchen in Herrn Franklin verliebt sei, und hat darauf hin so laut, daß Rosanna es hören konnte, an Herrn Franklins Interesse an ihrer Person appellirt.
»Was das Horchen betrifft, Herr Franklin,« bemerkte ich, indem ich meine Gedanken über den andern Punkt für mich behielt, »so werden wir uns Alle bald auf ähnlichen Dingen ertappen, wenn es hier noch länger so fortgeht. Spähen, lauern, horchen sind die Beschäftigungen, denen sich Leute in unserer Lage sehr begreiflicherweise hingeben müssen. Noch ein Paar Tage, Herr Franklin, und wir werden hier Alle stumm neben einander hergehen aus dem einfachen Grunde, weil wir Alle, um Einer des Andern Geheimnisse zu erforschen, diese Geheimnisse erhorchen werden. Verzeihen Sie mir diesen Ausspruch, Herr Franklin. Das furchtbare Geheimniß, welches auf uns in diesem Hause lastet, wirkt aus mich wie ein berauschendes Getränk und bringt mich außer mir. Ihren Auftrag aber werde ich nicht vergessen. Bei der ersten Gelegenheit werde ich die Sache mit Rosanna Spearman in Ordnung bringen.«
»Sie haben noch nicht mit ihr gesprochen, nicht wahr?« fragte Herr Franklin.
»Nein, Herr Franklin.«
»Dann sagen Sie ihr lieber nichts. Ich möchte doch lieber jetzt, wo ich weiß, daß der Sergeant nur darauf lauert, uns zu überraschen, das Mädchen nicht zu einem Geständniß ermuntern. Mein Benehmen ist nicht sehr konsequent nicht wahr, Betteredge? Ich sehe keinen Ausweg aus dieser Angelegenheit, der nicht schreckliche Folgen mit sich führen müßte, wenn nicht der Diebstahl auf Rosanna zurückgeführt werden kann. Und doch kann und will ich Sergeant Cuff nicht dabei behilflich sein, das Mädchen zu überführen.«
Das war ohne Zweifel unvernünftig genug. Aber ich fühlte ebenso und verstand ihn so gut. Wenn Du Dich, geneigter Leser, einmal in Deinem Leben erinnern willst, daß Du sterblich bist, so wirst Du ihn vielleicht auch verstehen.
Der Zustand der Dinge in und außerhalb des Hauses während der Zeit, wo Sergeant Cuff nach Frizinghall sich begeben hatte, war kurz folgender:
Fräulein Rachel erwartete die Zeit, wo der Wagen bereit sein würde, sie zu ihrer Tante zu bringen, eigensinnig aus ihrem noch immer verschlossenen Zimmer. Mylady und Herr Franklin frühstückten zusammen. Nach dem Frühstück faßte Herr Franklin einen seiner plötzlichen Entschlüsse und ging in größter Eile fort, um seine Aufregung durch einen langen Spaziergang zu beschwichtigen. Ich war die einzige Person, die ihn weggehen sah, und er sagte mir, er werde wieder da sein, bevor der Sergeant von Frizinghall zurückkehre. Der Wechsel der Witterung dessen Anzeichen wir schon am Abend zuvor beobachtet hatten, war eingetreten. Einem heftigen Regen war bald nach Sonnenaufgang ein scharfer Wind gefolgt. Der Wind hielt während des Tages an, aber obgleich die Wolken mehr als einmal drohten, schien es nicht wieder regnen zu wollen. Für einen jungen kräftigen Mann, dem die schweren von der See herkommenden Windstöße den Athem nicht versetzten, war das Wetter nicht zu schlecht zu einem Spaziergange.
Nach dem Frühstück wurde ich zu Mylady befohlen, um ihr bei der Ordnung der Hausstandsrechnungen behilflich zu sein«. Nur ein einziges Mal spielte sie auf die Mondsteinangelegenheit an und zwar indem sie sich jede Erwähnung derselben von meiner Seite verbat. »Warten Sie, bis der Mann zurückkommt,« sagte sie, und meinte damit den Sergeanten. »Dann müssen wir davon sprechen, jetzt haben wir es noch nicht nöthig.«
Als ich meine Herrin verließ, fand ich Penelope auf mich in meinem Zimmer warten.
»Ich möchte daß Du mit Rosanna sprächest,« sagte sie, »ich bin sehr unruhig über das Mädchen.«
Ich errieth aus der Stelle um was es sich handele. Aber es ist eine meiner Maximen, daß Männer, als überlegene Wesen, verpflichtet sind, wo es ihnen möglich ist an der Besserung der Frauen zu arbeiten. Wenn ein Frauenzimmer —— gleichviel ob meine Tochter oder wer sonst —— etwas von mir verlangt, bestehe ich immer darauf die Gründe zu erfahren. Je öfter man die Frauenzimmer dazu nöthigt selbst nach ihren Gründen zu forschen, desto traitabler wird man sie in allen Lebensbeziehungen finden. Es ist nicht die Schuld dieser armen Wesen, daß sie in der Regel erst nachdenken, wenn sie gehandelt haben; es ist vielmehr die Schuld der Narren, die ihnen willfahren.
Ich will den Leser mit den Gründen, die Penelope bei dieser Gelegenheit anzuführen hatte, in ihren eigenen Worten bekannt machen.
»Ich fürchte, Vaters« sagte sie, »Herr Franklin hat Rosanna, ohne es zu wollen, schwer gekränkt.«
»Warum kam Rosanna nach dem Gebüschweg? fragte ich.
»Es war eben ihre fixe Idee,« antwortete Penelope, »ich kann es nicht anders nennen. Sie war diesen Morgen entschlossen, mit Herrn Franklin zu sprechen, es möge daraus entstehen was da wolle. Ich that mein Möglichstes sie davon abzuhalten, wie Du selbst gesehen hast. Wenn ich sie nur hätte fortbringen können, bevor sie jene schrecklichen Worte hörte ——«
»Nun nun,« sagte ich, »verliere nur nicht den Kopf. Ich erinnere mich nicht, daß irgend etwas vorgefallen wäre, was Rosanna hätte beunruhigen können.«
»Nichts was sie hätte beunruhigen können, Vater. Aber Herr Franklin sagte, er nehme nicht das mindeste Interesse an ihr —— und, ach, er sagte das in einem so kalten Tom.«
»Er sagte es. um dem Sergeanten den Mund zu stopfen,« antwortete ich.«
»Das habe ich ihr auch gesagt, Vaters, erwiderte Penelope »Aber siehst Du, Vater, —- wenn auch Herr Franklin deshalb nicht zu tadeln ist —- so hat er sie doch seit Wochen gekränkt und entmuthigt; und nun macht dieses letzte Wort das Maaß voll! Natürlich hat sie kein Recht aus irgend ein Interesse an ihr von seiner Seite. Es ist ganz ungeheuerlich, daß sie sich und ihre Stellung soweit vergißt; aber sie scheint ihren Stolz und jedes Gefühl der Schicklichkeit ganz verloren zu haben. Ihr Ausdruck, als Herr Franklin jene Worte sprach, war wahrhaft erschreckend, Vater, sie scheinen sie förmlich versteinert zu haben. Es ist eine unheimliche Ruhe über sie gekommen und sie thut ihre Arbeit seitdem wie im Traum.«
Ich fing an mich unbehaglich zu fühlen. In der Art wie Penelope mir die Sachen vortrug, lag etwas, was meine höheren Bedenken zum Schweigen brachte. Jetzt, da meine Gedanken in diese Richtung gedrängt wurden, erinnerte ich mich was zwischen Herrn Franklin und Rosanna am vorigen Abend vorgefallen. Sie war gestern Abend ersichtlich bis ins Herz getroffen worden; und nun wollte es das Mißgeschick, daß dem armen Kinde abermals ein so arger Herzstoß versetzt wurde. Traurig! traurig! —— um so trauriger, als das Mädchen kein Recht zu diesen Empfindungen und keine Veranlassung zu einer Rechtfertigung hatte.
Ich hatte Herrn Franklin versprochen mit Rosanna zu sprechen und jetzt schien der geeignetste Augenblick, mein Versprechen zu erfüllen, gekommen.
Wir fanden das Mädchen damit beschäftigt, den Corridor vor den Schlafzimmern zu fegen, bleich und ruhig, und sauber wie immer in ihrem bescheidenen Kattunkleid. Ich bemerkte eine eigenthümliche stumpfe Mattigkeit in ihren Augen —— nicht als ob sie geweint, sondern als ob sie einen Gegenstand zu lange betrachtet habe. Vermuthlich war dieser Gegenstand ein eingebildeter, wenigstens gab es um sie her nichts, was sie nicht schon hunderte von Malen früher hätte betrachten können.
»Sei guten Muths, Rosanna,« sagte ich, »Du mußt Dich nicht über Deine eigenen Einbildungen grämen. Ich habe Dir etwas von Herrn Franklin zu sagen.«
Ich suchte ihr dann in den freundlichsten Trostesworten, die mir zu Gebote standen, die Sache im rechten Lichte zu zeigen. Meine Principien in Betreff des andern Geschlechts sind, wie der Leser bemerkt haben wird, sehr streng. Aber ich weiß nicht wie es kommt, wenn ich mich einem weiblichen Wesen von Angesicht zu Angesicht gegenüber befinde, so beobachte ich eine Praxis, die, wie ich bekennen muß, mit meinen Principien nicht ganz übereinstimmt.
»Herr Franklin ist sehr freundlich und rücksichtsvoll. Bitte, danken Sie ihm.« Das war ihre ganze Antwort.
Meine Tochter hatte schon bemerkt, daß Rosanna ihre Arbeit wie im Traum verrichte. Ich ergänzte jetzt die Bemerkung durch die andere, daß sie auch wie im Traume höre und spreche. Ich zweifelte, ob ihr Gemüth in der rechten Verfassung sei in sich aufzunehmen, was ich ihr gesagt hatte.
»Hast Du mich auch vollkommen verstanden, Rosanna?« fragte ich.
»Vollkommen.«
Sie sprach mir das Wort nach, nicht wie ein lebendes Wesen, sondern wie ein Automat. Während des Gesprächs unterbrach sie sich keinen Augenblick in ihrer Beschäftigung; sie fegte immer fort. Ich nahm ihr den Besen so sanft und so freundlich wie möglich aus der Hand.
»Komm, komm, mein Kind,« sagte ich, »Du bist ja gar nicht Du selber. Du hast etwas auf dem Herzen. Ich bin Dein Freund und will es bleiben, selbst wenn Du etwas Unrechtes begangen hast. Sprich Dich offen aus, Rosanna, ganz offen.«
Die Zeit war vorüber, wo solche Worte ihr Thränen entlockt haben würden. Jetzt blieben ihre Augen trocken.
»Ja,« sagte sie, »ich will mich offen aussprechen.«
»Gegen Mylady?« fragte ich.
»Nein.«
»Gegen Herrn Franklin?«
»Ja, gegen Herrn Franklin.«
Ich wußte kaum was ich dazu sagen sollte. Sie war nicht in der Verfassung mich zu verstehen, wenn ich sie vor einer vertraulichen Mittheilung gegen Herrn Franklin, wie er mich gebeten, gewarnt hätte. Indem ich, vorsichtig tappend, meinen Zweck aus einem andern Wege zu erreichen suchte, sagte ich ihr nur, Herr Franklin sei spazieren gegangen.
»Gleichviel,« antwortete sie, »ich will auch Herrn Franklin heute nicht stören.«
»Warum willst Du nicht mit Mylady sprechen?« sagte ich. »Es ist das beste Mittel Dich zu erleichtern, wenn Du mit Deiner barmherzigen und christlichen Herrin sprichst, die immer so gut gegen Dich gewesen ist.«
Sie sah mich einen Augenblick mit einem Blick vollernster Aufmerksamkeit an, als ob sie sich meine Worte fest einprägen wolle. Dann nahm sie mir den Besen wieder aus der Hand und ging mit demselben langsam eine Strecke den Corridor hinab.
»Nein,« sagte sie, indem sie wieder zu fegen anfing und mit sich selber sprach, »ich weiß ein besseres Mittel mich zu erleichtern, als das.«
»Und das wäre?«
»Bitte, lassen Sie mich ruhig meine Arbeit thun!«
Ppenelope folgte ihr und bot ihr an, ihr zu helfen.
Sie antwortete: »Nein, ich möchte meine Arbeit gern allein thun.« Dabei sah sie sich nach mir um. »Ich danke Ihnen, Herr Betteredge.«
Es war nichts bei ihr auszurichten, es nützte nichts noch weiter mit ihr zu reden. Ich gab Penelope ein Zeichen mit mir zu kommen, und wir verließen sie, wie wir sie gefunden hatten, den Corridor wie im Traume fegend.
»Hier muß der Doktor Rath schaffen,« sagte ich, »ich weiß keinen.«
Meine Tochter erinnerte mich daran, daß Herr Candy krank sei, da er sich, wie man sich erinnern wird, eine Erkältung an dem Abend des Geburtstag Diners zugezogen hatte. Sein Assistent, ein gewisser Herr Ezra Jennings, war aber sicher leicht zu erreichen. Aber Niemand in unserer Gegend wußte viel von ihm. Herr Candy hatte ihn unter eigenthümlichen Umständen engagirt; und, mit Recht oder Unrecht, konnte Niemand von uns ihn leiden und hatte Niemand Zutrauen zu ihm. Es gab andere Doctoren in Frizinghall, aber sie waren nie in unser Haus gerufen worden und Penelope zweifelte, ob Fremde Rosanna in ihrem gegenwärtigen Zustande nicht mehr schaden als nützen würden. Im ersten Augenblicke wollte ich mit Mylady davon reden. Als ich aber der schweren Sorgen gedachte, die schon auf ihr lasteten, zauderte ich, all den Verdrießlichkeiten, mit denen sie zu kämpfen hatte, noch diese neue hinzuzufügen. Und doch mußte nothwendig etwas geschehen. Der Zustand des Mädchens war nach meiner Ansicht höchst beunruhigend und es war nur recht, daß meine Herrin davon unterrichtet wurde. Sehr ungern ging ich daher in ihr Wohnzimmer. Niemand war dort. Mylady hatte sich mit Fräulein Rachel eingeschlossen. Es war unmöglich für mich sie zu sehen, bis sie wieder aus Fräulein Rachel’s Zimmer herauskommen würde.
Ich wartete vergebens, bis die große Uhr in der Halle Dreiviertel auf Zwei schlug. Fünf Minuten später hörte ich von dem Wege vor dem Hause her meinen Namen rufen. Ich erkannte die Stimme auf der Stelle. Sergeant Cuff war von Frizinghall zurückgekehrt.
Ich ging hinunter und begegnete dem Sergeanten auf der Treppe. Nach dem zwischen uns Vorgefallenen ging es mir eigentlich gegen den Strich, ihm irgend ein Interesse an seinem Vorgehen zu bezeigen. In der That aber war mein Interesse stärker als mein Wille und, meiner Würde uneingedenk, brach ich in die Worte aus: »Was bringen Sie Neues von Frizinghall?«
»Ich habe die Indier gesehen,« antwortete Sergeant Cuff, »und habe herausgefunden, was Rosanna vorigen Donnerstag in der Stadt gekauft hat. Die Indier werden am Mittwoch nächster Woche wieder freigelassen werden. Mir so wenig wie Herrn Murthwhaite ist es im Mindesten zweifelhaft, daß sie mit der Absicht hierhergekommen sind, den Mondstein zu stehlen. Ihre Pläne wurden aber natürlich durch das in der Mittwochsnacht im Hause Vorgefallene total vereitelt und sie haben mit dem Verlust des Diamanten, der uns gegenwärtig beschäftigt, nicht mehr zu thun als Sie. Aber das kann ich Ihnen sagen, Herr Betteredge, wenn wir den Mondstein nicht wieder finden, sie finden ihn gewiß. Sie haben noch nicht das letzte Wort von den« drei Jongleurs gehört«
Kaum hatte der Sergeant diese letzten beunruhigenden Worte gesagt, als Herr Franklin von seinem Spaziergange zurückkehrte. Er wußte seine Neugierde besser zu beherrschen, als ich die meinige, und ging ohne ein Wort zu sagen an uns vorüber in’s Haus.
Ich aber wollte, nachdem ich doch schon einmal meine Würde außer Augen gesetzt hatte, wenigstens den ganzen Vortheil dieses Opfers genießen. »Und was haben Sie mir über Rosanna mitzutheilen?« sagte ich.
Sergeant Cuff schüttelte den Kopf. »Da ist das Geheimnis; undurchdringlicher denn je,« sagte er. »Ich habe ihre Spur bis zu dem Laden eines Leinwaarenhändlers, Namens Maltby, in Frizinghall verfolgt. In den übrigen Leinwandhandlungen der Stadt hat sie so wenig wie in Läden der Putzmacherinnen oder Schneiderinnen irgend etwas gekauft und bei Maltbh nur ein Stück weißen Baumwollenstoff bei dem es ihr sehr genau auf eine Qualität ankam; die Größe war hinreichend für ein Nachthemd.«
»Wessen Nachthemd?« fragte ich.
»Ohne Zweifel ihr eigenes. Zwischen 12 und 3 Uhr am Donnerstag Morgen muß sie nach dem Zimmer ihres jungen Fräuleins hinuntergeschlüpft sein, um den Diamanten bei Seite zu bringen, während Ihr Uebrigen alle im Bett laget. Beim Wiederhinaufgehen nach ihrem Zimmer muß ihr Nachthemd die nasse Malerei an der Thür gestreift haben. Sie konnte den Fleck nicht auswaschen und konnte das Nachthemd nicht gefahrlos vernichten, ohne sich vorher mit einem ähnlichen neuen versehen und so ihre Wäsche wieder vervollständigt zu haben.«
»Und was haben Sie für Beweise dafür, daß es Rosanna’s Nachthemd war?« warf sie ein.«
»Eben die Sachen, die sie gekauft hat, um das befleckte Nachthemd zu ersetzen,« antwortete der Sergeant. »Wenn es Fräulein Verinder’s Nachthemd gewesen wäre, so hätte sie Spitzen, Garnirungen und Gott weiß was sonst noch dazu kaufen müssen und hätte es nicht in einer Nacht fertig machen können. Einfacher Baumwollenstoff bedeutet in diesem Fall soviel wie das ordinäre Nachthemd eines Dienstmädchens. Nein, nein, Herr Betteredge, in dieser Beziehung ist alles vollkommen klar; die Schwierigkeit liegt darin, die Frage zu beantworten, warum sie, nachdem sie sich das neue Kleidungsstück verschafft hat, das befleckte Nachthemd, anstatt es zu vernichten, versteckte. Wenn das Mädchen nicht mit der Sprache heraus will, so giebt es nur ein Mittel die Schwierigkeit zu beseitigen. Der Ort des Verstecks am Zitterstrand muß durchsucht werden, und da wird sich der wahre Sachverhalt schon ergeben.«
»Und wie wollen Sie den Ort des Verstecks ausfindig machen?« fragte ich.
»Ich bedauere, Ihnen in dieser Beziehung nicht dienen zu können;« erwiderte der Sergeant,» aber das ist mein Gehemniß, das ich zu bewahren denke.«
Um die Neugierde des Lesers nicht allzu sehr zu reizen, wie er die meinige reizte, will ich schon hier einschalten, daß er sich in Frizinghall mit einem Haussuchungsbefehl versehen hatte.
Seine Erfahrung in solchen Dingen belehrte ihn, daß Rosanna aller Wahrscheinlichkeit nach eine Notiz über den Ort des Verstecks bei sich führen werde, die ihr als Wegweiser für den Fall dienen solle, daß sie vielleicht nach Verlauf einer längeren Zeit und unter veränderten Umständen denselben wieder auszusuchen habe. Diese Notiz würde dem Sergeanten alles gewährt haben, dessen er bedurfte.
»Nun, Herr Betteredge,« fuhr er fort, »lassen wir müßige Betrachtungen auf sich beruhen und reden wir von Geschäften. Ich habe Joyce angewiesen, ein Auge aus Rosanna zu haben. Wo ist Joyce?«
Joyce war der Polizei-Officiant aus Frizinghall, den der Oberbeamte Seegreaf Sergeant Cuff zur Verfügung gestellt hatte.
Die Uhr schlug eben zwei, als er diese Frage an mich richtete und in demselben Augenblick fuhr auch schon mit tadelloser Pünktlichkeit der Wagen vor, der Fräulein Rachel zu ihrer Tante bringen sollte.
»Eines nach dem anderen,« sagte der Sergeant, indem er mich zurückhielt, als ich eben den Officianten Joyce aufsuchen lassen wollte. »Ich muß erst Fräulein Verinder meine Aufwartung machen.«
Da der Regen noch immer drohte, so war für die Fahrt Fräulein Rachel’s nach Frizinghall der geschlossene Wagen bestimmt worden. Sergeant Cuff winkte Samuel vom Dienersitz zu sich herunter und sagte zu ihm:
»Sie werden einen Freund von mir diesseits der Pförtnerwohnung unter den Bäumen stehend finden. Dieser Freund wird sich, ohne den Wagen aufzuhalten, neben Sie auf den Dienersitz setzen. Sie haben nichts zu thun, als Ihren Mund zu halten und Ihre Augen zuzumachen, sonst setzen Sie sich Unannehmlichkeiten aus.«
Mit diesem Rath ließ er den Diener wieder auf seinen Sitz hinaufsteigen. Was Samuel dabei dachte, weiß ich nicht. Für mich war es klar, daß Fräulein Rachel von dem Moment an, wo sie unser Haus verließ —— wenn sie es überhaupt verließ, im Geheimen überwacht werden sollte. Mein junges Fräulein überwacht! Ein Spion hinter ihr auf dem Dienersitz des Wagens ihrer Mutter! Ich hätte mir die Zunge abschneiden mögen, die sich so weit vergessen hatte, mit dem Sergeanten Cuff zu sprechen.
Die erste Person, die aus dem Hause trat, war Mylady. Sie stellte sich oben auf der ersten Stufe der Treppe an die Seite, um zu sehen, was geschehen werde.
Sie sprach kein Wort, weder mit dem Sergeanten, noch mit mir. Mit geschlossenen Lippen und verschränkten Armen, einen leichten Gartenmantel über die Schulter geworfen, stand sie bewegungslos wie eine Bildsäule da, ihre Tochter erwartend.
Eine Minute später kam Fräulein Rachel herunter in einem sehr hübschen enganliegenden gelben Kleide, von dem sich ihr dunkler Teint sehr gut abhob. Auf dem Kopf trug sie einen niedlichen kleinen Strohhut mit einem um denselben geschlungenen weißen Schleier; an den Händen trug sie Handschuhe von der Farbe ihres Kleides. Ihr schönes schwarzes, seidenweiches Haar quoll unter ihrem Hut hervor. Ihre kleinen Ohren nahmen sich aus wie rosige Muscheln, in deren jeder eine Perle hing. Raschen Schritts trat sie vor die Thür, schlank wie eine Lilie auf ihrem Stengel, geschmeidig und lebendig in jeder Bewegung, wie ein junges Kätzchen. So weit ich sehen konnte, war in ihrem hübschen Gesichte nichts verändert, als ihre Augen und ihre Lippen. Ihre Augen hatten einen schärferen und verwegneren Ausdruck, als mir gefallen wollt«e, und ihre Lippen hatten ihre Farbe und ihr Lächeln so völlig verloren, daß ich sie kaum wieder erkannte. Sie küßte ihre Mutter hastig aus die Wange, sagte: »Vergieb mir, Mutter. wenn Du kannst.« und zog dann ihren Schleier so heftig vor das Gesicht, daß sie ihn zerriß. Im nächsten Augenblick eilte sie die Treppe hinunter und warf sich in den Wagen, als wolle sie sich verstecken.
Sergeant Cuff war nicht minder rasch bei der Hand. In dem Augenblick, wo Fräulein Rachel sich in den Wagen setzte, schob er Samuel bei Seite und stand, den offenen Wagenschlag in der Hand, vor ihr.
»Was wünschen Sie?« fragte Fräulein Rachel unter ihrem Schleier hervor.
»Ich wünsche Ihnen, bevor Sie abfuhren, ein Wort zu sagen, gnädiges Fräulein,« antwortete ihr der Sergeant. »Ich maße mir nicht an, Sie von dem Besuch bei Ihrer Tante zurückzuhalten, Ich nehme mir nur die Freiheit, Ihnen zu bemerken, daß Ihre Abreise im gegenwärtigen Augenblick meinen Bemühungen, dem Verbleiben Ihres Diamanten auf die Spur zu kommen, Hindernisse in den Weg legt. Ich ersuche Sie, sich das wohl zu merken und dann selbst zu entscheiden, ob Sie abreisen oder hier bleiben wollen.«
Fräulein Rachel würdigte ihn keiner Antwort. »Fahr’ zu, James!« rief sie dem Kutscher zu.
Ohne ein Wort weiter zu sagen, schlug der Sergeant die Wagenthür zu. In diesem Augenblick kam Herr Franklin die Treppe heruntergelaufen. »Leben Sie wohl, Rachel,« rief er, indem er ihr die Hand zum Abschied entgegenstreckte.
»Fahr’ zu!« rief Fräulein Rachel noch lauter als vorher und nahm von Herrn Franklin nicht mehr Notiz, als sie von Sergeant Cuff genommen hatte.
Wie vom Blitze gerührt, ging Herr Franklin wieder die Treppe hinauf. Der Kutscher der nicht wußte, was er thun solle, blickte nach Mylady, die noch immer unbeweglich aus der obersten Stufe stand.
Mylady, in deren Zügen sich Zorn, Sorge und Scham walten, gab ihm das Zeichen zur Abfahrt und kehrte dann eilig in’s Haus zurück. Herr Franklin, der erst jetzt wieder Worte zu finden schien, rief ihr in dem Augenblick, wo der Wagen abfuhr, nach: »Tante, Du hattest vollkommen Recht. Laß mich Dir für alle Deine Güte danken und mich von hier verabschieden.«
Mylady wandte sich nach ihm um, als wolle sie mit ihm reden; dann aber, als ob sie sich selbst mißtraue, winkte sie ihm freundlich mit der Hand, sagte nur mit gebrochener Stimme: »Komm’ noch zu mir, ehe Du von hier fortgehst« —— und ging dann auf ihr Zimmer.
»Thun Sie mir einen letzten Gefallen, Betteredge,« sagte Herr Franklin zu mir mit Thränen in den Augen. »Verhelfen Sie mir dazu, den nächsten Zug zu erreichen.«
Damit ging auch er in’s Haus zurück, für den Augenblick hatte Fräulein Rachel ihn völlig zum Weibe gemacht. Danach urtheile man, wie sehr er sie geliebt haben muß.
Sergeant Cuff und ich blieben am Fuß der Treppe einander gegenüber stehen. Der Sergeant hatte das Auge fest aus eine Lücke im Laube gerichtet, welche einen Ausblick aus eine der Windungen des Fahrwegs gestattete, der vom Hause nach der Landstraße führte. Er hielt die Hände in den Taschen und pfiff »Die letzte Rose« leise für sich hin.
»Alles zu seiner Zeit« sagte ich ungehalten »Jetzt ist wahrhaftig keine Zeit zum Pfeifen.«
In diesem Augenblick wurde der Wagen aus seinem Wege nach dem Pförtnerhause in einiger Entfernung durch die Baumlücke sichtbar. Deutlich erkennbar saß ein zweiter Mann neben Samuel auf dem Dienersitz.
»Alles in Ordnung« sagte der Sergeant zu sich und wandte sich wieder nach mir um. »Jetzt ist keine Zeit zum Pfeifen, wie Sie richtig bemerken, Herr Betteredge. Es ist Zeit, diese Angelegenheit jetzt ohne Schonung für irgend Jemanden zu betreiben. Wir wollen mit Rosanna Spearman den Anfang machen. Wo ist Joyce?«
Wir riefen Beide nach diesem und erhielten keine Antwort. Ich schickte einen der Stalljungen nach ihm aus.
»Sie haben gehört, was ich zu Fräulein Verinder gesagt habe?«,« bemerkte der Sergeant, während wir warteten, »und Sie haben gesehen, wie sie meine Worte aufnahm. Ich sagte ihr mit klaren Worten, daß ihre Abreise im gegenwärtigen Augenblick meinen Bemühungen, dem Verbleiben ihres Diamanten auf die, Spur zu kommen, hindernd in den Weg trete —— und sie reist Angesichts dieser Erklärung ab. Ihr junges Fräulein hat in dem Wagen ihrer Mutter einen Reisegefährten bei sich, Herr Betteredge, und dieser Reisegefährte ist kein anderer als der Mondstein.«
Ich antwortete nichts und beharrte nur in meinem unerschütterlichen Vertrauen auf Fräulein Rachel.
Dem Stalljungen, der in diesem Augenblick zurück kam, folgte sehr unwillig, wie es mir schien, Joyce auf dem Fuß.
»Wo ist Rosanna Spearman,« fragte Sergeant Cuff.
»Es ist nicht meine Schuld, Herr Cuff,« fing Joyce an, »und es thut mir sehr leid. Aber ich weiß nicht wie es gekommen ist. ——«
»Ehe ich nach Frizinghall ging« fiel ihm der Sergeant in’s Wort, «habe ich Sie angewiesen, ein wachsames Auge auf Rosanna Spearman zu haben, ohne sie merken zu lassen, daß sie überwacht werde. Wollen Sie mir sagen, daß Sie sie haben entwischen lassen?«
»Ich fürchte« erwiderte Joyce, der zu zittern anfing, »daß ich vielleicht zu sehr darauf bedacht war, sie meinen Auftrag nicht merken zu lassen. ——«
»Seit wann vermissen Sie sie?«
»Grade seit einer Stunde, Herr.«
»Sie können zu ihrer regelmäßigen Berufsthätigkeit nach Frizinghall zurückkehren,« sagte der Sergeant in seinem gewöhnlichen ruhigen und trübseligen Ton.
»Ich glaube nicht, Herr Joyce, daß Ihre natürliche Begabung Sie für den Beruf eines Polizeibeamten bestimmt hat. Die Ihnen zugewiesenen Pflichten übersteigen Ihre Kräfte ein wenig. Ich empfehle mich Ihnen.«
Der arme Mann schlich sich davon. Was mich betrifft, so wird es mir sehr schwer meine Empfindungen bei der Nachricht, daß Rosanna Spearman vermißt werde, zu schildern. Die verschiedenartigsten Gefühle bestürmten mich. In dieser Gemüthsverfassung stand ich sprachlos da und starrte Sergeant Cuff an.
»Mein Herr Betteredge,« sagte der Sergeant, als ob er sofort erkannt habe, was mich zumeist beschäftigte und mir vor allem darüber eine Auskunft geben wolle, »Ihre junge Freundin Rosanna soll mir nicht so leicht durch die Finger schlüpfen wie Sie denken. So lange ich Fräulein Verinder’s Aufenthalt weiß, habe ich Mittel auch ihre Mitschuldige zu erreichen. Ich habe sie verhindert vorige Nacht mit einander zu conferiren. Nun gut. Da sie sich hier nicht mehr haben sprechen können, werden sie sich in Frizinghall treffen. Die gegenwärtige Untersuchung muß etwas früher, als ich es geglaubt hatte, einfach von diesem Hause nach dem Hause, wo Fräulein Verinder jetzt zum Besuch ist, verlegt werden. Inzwischen muß ich Sie, fürchte ich, mit einer abermaligen Zusammenberufung der Domestiken bemühen.
Ich ging mit ihm in das Domestikenzimmer. Es macht mir wenig Ehre, aber es ist doch wahr, daß ich bei seinen letzten Worten abermals einen Anfall von Entdeckungsfieber hatte. Ich vergaß meinen Haß gegen Sergeant Cuff, ergriff vertraulich seinen Arm und sagte: »Um Gottes willen, sagen Sie mir, was Sie mit den Domestiken beginnen wollen?«
Der große Cuff stand plötzlich still und wandte sich in einer Art von melancholischer Entzückung an die leere Luft.
»Wenn dieser Mann,« sagte er, indem er offenbar mich damit meinte, »nur etwas von der Rosenzucht verstünde, so wäre er der vollkommenste Mensch auf Erden.«
Nach diesem starken Gefühlsausbruch seufzte er und legte seinen Arm in den meinigen.
»Die Sachen stehen so,« sagte er, sich wieder den Geschäften zuwendend »Rosanna hat von zwei Dingen eines gethan. Entweder sie ist direct nach Frizinghall gegangen und trifft dort ein, bevor ich dahin gelangen kann, oder sie hat zuerst den Ort ihres Verstecks am Zitterstrand aufgesucht Das Erste, was ich herausfinden muß, ist, welcher von den Dienstboten sie, bevor sie das Haus verlassen, zuletzt gesehen hat.«
Diese Untersuchung ergab, daß das Küchenmädchen Nancy die letzte Person gewesen war, welche Rosanna gesehen hatte.
Nancy hatte gesehen, wie sie mit einem Briefe in der Hand sich davon machte und den Schlachtergesellen, der eben Fleisch im Hinterhause abgegeben hatte, aufhielt. Nancy hatte gehört, wie sie den Mann bat, den Brief auf die Post zu legen, wenn er nach Frizinghall zurückkäme. Der Mann hatte die Adresse betrachtet und dabei bemerkt, es sei ein Umweg, einen nach Cobb’s Hole adressirten Brief in Frizinghall auf die Post zu geben, und das noch dazu an einem Sonnabend, wo der Brief nun erst am Montag-Morgen an feinen Bestimmungsort gelangen werde. Rosanna hatte darauf geantwortet, daß ihr an dem Aufschub der Bestellung des Briefes nichts gelegen sei. Das einzige, worauf es ihr ankomme, sei, daß er genau thue, was sie ihm sage. Der Mann hatte das versprochen und war dann weggefahren. Darauf hatte Nancy wieder an ihre Arbeit in der Küche gehen müssen. Und kein Mensch hatte mehr etwas von Rosanna Spearman gesehen.
»Nun?« fragte ich, als wir wieder allein waren.
»Nun,« sagte der Sergeant, »ich muß nach Frizinghall.«
»Wegen des Briefes?«
»Ja wohl! Die Notiz über den Ort des Verstecks liegt in diesem Briefe. Ich muß mir auf dem Postamt die Adresse ansehen. Wenn es die Adresse ist, die ich vermuthe, so werde ich unserer Freundin Frau Yolland nächsten Montag wieder einen Besuch abstatten.«
Ich ging mit dem Sergeanten, den Ponywagen zu beordern. Auf dem Platz vor dem Stalle ging uns ein neues Licht über das Verbleiben des vermißten Mädchens auf.

Siebzehntes Capitel.
Die Nachricht von dem Verschwinden Rosanna’s hatte sich, wie es schien, auch schon unter den Gutsleuten außerhalb des Hauses verbreitet. Sie hatten gleichfalls ihre Nachforschungen angestellt und hatten sich eben eines behenden, kleinen Buben mit Namen Duffy bemächtigt, der gelegentlich dazu verwandt wurde, das Unkraut im Garten auszujäten, und der Rosanna Spearman noch vor einer halben Stunde gesehen hatte. Duffy versicherte, daß das Mädchen in der Tannen-Anpflanzung in der Richtung des Strandes an ihm vorüber gelaufen sei.
»Kennt der Junge den Strand hier?« fragte Sergeant Cuff.
»Er ist hier am Strande geboren und erzogen.« antwortete ich.
»Duffy!« sagte der Sergeant, »willst Du einen Shilling verdienen? Wenn Du das willst, so komme mit mir. Halten Sie den Ponywagen für die Zeit meiner Rückkehr bereit, Herr Betteredge.«
Und nun machte er sich nach dem Strande mit einer Raschheit auf den Weg, mit welcher meine, wiewohl für mein Alter recht wohl conservirten Beine nicht Schritt halten konnten.
Der kleine Duffy heulte vor Vergnügen, wie es die kleinen Wilden in unserer Gegend zu thun pflegen und trabte hinter dem Sergeanten her.
Hier befinde ich mich abermals außer Stande, deutliche Rechenschaft von dem Zustande zu geben, in welchem sich mein Gemüth befand, nachdem uns Sergeant Cuff verlassen hatte. Eine sonderbare und betäubende Ruhelosigkeit bemächtigte sich meiner. Ich fing ein Dutzend verschiedene unnütze Dinge in und außerhalb des Hauses zu thun an, von denen ich mich keines einzigen mehr entsinne. Ich weiß sogar nicht mehr, wie lange es her war, daß der Sergeant sich nach dem Strande aufgemacht hatte, als Duffy mit einer Botschaft für mich zurückgelaufen kam. Sergeant Cuff hatte dem Jungen ein aus seiner Brieftasche gerissenes Blatt übergeben, aus welchem mit Bleistift die Worte geschrieben waren: »Schicken Sie mir möglichst rasch einen von Rosanna Spearmans Stiefeln.«
Ich ließ von dem ersten Mädchen, das mir begegnete, einen Stiefel aus Rosanna’s Zimmer holen und schickte den Jungen mit der Meldung zurück, daß ich sofort mit dem Stiefel folgen würde.
Das war freilich nicht die schnellste Art der erhaltenen Weisung nachzukommen, des war ich mir wohl bewußt, aber ich beschloß; bevor ich dem Serganten Rosanna’s Stiefel auslieferte, mich mit eigenen Augen zu überzeugen, um was für eine neue Mystification es sich handle. Meine alte Grille, das Mädchen so viel wie möglich zu schützen, schien in der elften Stunde noch einmal über mich gekommen zu sein. Dieses Gefühl spornte mich, sobald ich den Stiefel in der Hand hatte, ganz abgesehen von dem Endeckungsfieber, meine Beine so in Bewegung zu sehen, wie es einem über 70 Jahre alten Manne irgend möglich ist. Als ich mich dem Strande näherte, ballten sich pechschwarze Wolken am Himmel zusammen und der Regen fing in schweren, vom Winde gepeitschten Tropfen zu fallen an. Ich vernahm das Brausen der Wellen auf der Sandbank an der Mündung der Bucht. Etwas weiter hin traf ich den Jungen, der an der Windseite der Dünen Schutz gegen den Regen suchte, und erblickte die wüthende See, den Wogendrang auf der Sandbank, den vom Sturm wie ein fliegendes Gewand über das Wasser hingefegten Regen und die gelbe Wildniß des Strandes, aus der sich nur eine einzige schwarze Gestalt, die Gestalt Sergeant Cuff’s, erhob.
Sobald er meiner ansichtig wurde, machte er mit der Hand eine Bewegung nach Norden hin.
»Halten Sie sich an der Seite,« rief er mir zu, »und kommen Sie zu mir herunter.«
Ich schleppte mich, völlig außer Athem und mit entsetzlichem Herzklopfen zu ihm hin. Ich war sprachlos. Hundert Fragen hätte ich ihm thun mögen, aber keine einzige vermochte ich über die Lippen zu bringen. Der Ausdruck seines Gesichts machte mich betroffen. Sein Blick hatte etwas Furchtbares. Er riß mir den Stiefel aus der Hand und paßte ihn in einen Fußstapfen, der in südlicher Richtung von uns gerade auf die felsigen Klippen der sogenannten Südspitze hinwies. Die Fußspur war noch nicht vom Regen verwischt und der Stiefel des Mädchens paßte auf ein Haar hinein.
Der Sergeant deutete ohne ein Wort zu sagen auf den Stiefel in der Fußspur.
Ich ergriff seinen Arm und versuchte zu reden, aber eben so erfolglos wie vorher.
Er fuhr fort den Fußstapfen Schritt für Schritt bis an die Stelle zu verfolgen, wo sich die Felsklippen mit dem Strande vereinigten.
Die Südspitze war eben von der hereinbrechenden Fluth überströmt; die Wellen ergossen sich über die nicht mehr sichtbare Fläche des Zitterstrandes. Unter einem beharrlichen Schweigen, das bleischwer auf mir lastete, mit einer eigensinnigen Geduld, die etwas Entsetzliches hatte, paßte Sergeant Cuff den Stiefel an den verschiedensten Stellen in die Fußstapfen und fand, daß sie überall dieselbe Richtung gerade auf die Felsklippe zu zeigten. Aber wie er auch suchen mochte, nirgends konnte er die Spur eines von der Felsklippe herführenden Fußstapfens finden.
Er mußte es am Ende aufgeben. Er sah mich wieder an und blickte dann auf die Wassermasse vor uns, die den Zitterstrand höher und höher mit ihren Fluthen überdeckte. Ich folgte seinen Blicken und las seine Gedanken in denselben. Plötzlich überfiel mich in meiner Sprachlosigkeit ein furchtbares Zittern. Ich sank am Strande auf meine Knie.
»Sie ist wieder an dem Ort des Verstecks gewesen,« hörte ich den Sergeanten vor sich hin sagen. »Auf dem Felsen da muß ihr ein Unglück zugestoßen sein.«
Das veränderte Aussehen und Wesen des Mädchens —— die Art von starrer Betäubung in der sie mich angehört und mit mir gesprochen, als ich sie noch vor wenigen Stunden mit dem Ausfegen des Corridors beschäftigt gefunden hatte, stiegen während der letzten Worte des Sergeanten vor mir auf und mahnten mich, daß er mit seiner Vermuthung ganz fehl gehe. Ich machte einen Versuch, ihm die Angst, die mich überkommen hatte, zu schildern; ich versuchte es zu sagen: »Sie hat den Tod, den sie gestorben ist, selbst gesucht!« Aber nein! die Worte wollten nicht heraus. Sprachlos zitterte ich fort und fort; unempfindlich für den strömenden Regen, blind für die steigende Fluth, während das arme verlorne Geschöpf mit in einem Traumgesicht heimsuchte Ich sah sie wieder, wie ich sie in vergangenen Tagen gesehen hatte an jenem Morgen, wo ich hingegangen war, sie wieder nach Hause zu holen. Ich hörte sie wieder, wie sie mir sagte, daß es ihr sei, als ob der Zitterstrand sie gegen ihren Willen an sich ziehe, und daß sie wohl wissen möchte, ob sie dort ihr Grab finden werde.
Mich ergriff ein Grausen in dem Gedanken an mein eigenes Kind. Meine Tochter war gerade von ihrem Alter. Auch meine Tochter hätte, wenn ihr die Versuchung so nahe getreten wäre wie Rosanna, vielleicht ein ebenso elendes Leben gelebt und wäre vielleicht eines ebenso schrecklichen Todes gestorben wie diese.
Der Sergeant hob mich freundlich aus und führte mich von der Stelle, wo sie ihren Tod gesunden hatte, hinweg.
Das erleichterte mich so, daß ich anfing wieder zu Athem zukommen und die Dinge um mich her wieder zu sehen wie sie wirklich waren. Als ich jetzt nach den Dünen blickte, sah ich, wie die männlichen Gutsleute und der Fischer Yolland alle zusammen rasch auf uns zugelaufen kamen und hörte sie ängstlich rufen, ob das Mädchen gefunden sei. So kurz wie möglich erklärte ihnen der Sergeant, daß ihr ein Unglück begegnet sein müsse. Dann rief er den Fischer herbei und that ihm eine auf die See bezügliche Frage:
»Sagen Sie mir, ist es möglich, daß ein Boot sie von jener Felsklippe, an der sich ihre Fußstapfen verlieren, abgeholt hat?«
Der Fischer deutete auf die über die Sandbank hinstürzenden Wogen und die gewaltigen Wellen, die sich in aufsprühenden Schaumwolken an den Felsspitzen zu unsern beiden Seiten brachen.
»Kein Boot der Welt,« antwortete er, »hätte da hindurch zu ihr gelangen können.«
Sergeant Cuff warf einen letzten Blick auf die Fußstapfen im Sande, welche der Regen jetzt rasch hinwegwusch.
»Hier,« sagte er, »haben wir den Beweis, daß sie diesen Ort zu Lande nicht wieder verlassen haben kann. Und hier,« fuhr er, mit einem Blick auf den Fischer fort, »haben wir den Beweis, daß sie nicht zur See fortgekommen sein kann.« Bei diesen Worten hielt er inne und dachte einen Augenblick nach. »Eine halbe Stunde, ehe ich vom Hause hierher kam, hat man sie hier hinunterlaufend gesehen,« sagte er zu Yolland »Seitdem ist etwas« Zeit verflossen; Alles in Allem vielleicht eine Stunde. Wie hoch kann das Wasser vor einer Stunde an dieser Seite der Felsen gestanden haben?« Er deutete nach der Südseite hin, mit andern Worten der Seite, die nicht vom Flugsand bedeckt war.
»Wie die Fluth heute herankommt,« antwortete der Fischer, »ist an der Seite der Felsspitze wohl nicht so viel Wasser gewesen, um eine junge Katze darin zu ertränken.«
Sergeant wandte sich nun nach der Nordseite in der Richtung des Flugsandes um.
»Und an dieser Seite?« fragte er.
»Noch weniger,« antwortete Yolland, »das Wasser kann eben über den Zittersand hinweggeflossen sein, mehr nicht.«
Der Sergeant wandte sich zu mir und bemerkte, der Unfall müsse sich an der Seite des Flugsandes ereignet haben. Mit diesem Worte hatte er mir die Zunge gelöst: »Kein Unfall!« sagte ich zu ihm, »sie ist ihres Lebens müde hergekommen, um demselben hier ein Ende zu machen.«
Er fuhr zurück und fragte: »Woher wissen Sie das?« Die Andern drängten sich heran. Der Sergeant faßte sich auf der Stelle wieder, schob die Andern zurück und sagte zu ihnen, ich sei ein alter Mann, die Entdeckung habe mich erschüttert, sie sollten mich einen Augenblick in Ruhe lassen. Darauf wandte er sich wieder zu Yolland und fragte ihn: »Ist irgend eine Chance sie wiederzufinden, wenn die Fluth wieder abläuft?« und Yolland antwortete: »Keine! Was der Sand einmal erfaßt hat behält er für immer.« Nach diesen Worten trat der Fischer wieder einen Schritt auf mich zu und sagte: »Herr Betteredge, ich habe Ihnen ein Wort über den Tod des jungen Mädchens zu sagen. Vier Fuß landeinwärts liegt an der Seite der Südspitze, ungefähr einen halben Faden tief unter dem Sande eine Felsbank. Nun frage ich, warum ist sie nicht darauf gestoßen? Wenn sie zufällig von der Südspitze ausgeglitten wäre, so hätte sie auf die Stelle fallen müssen, wo man in einer Tiefe, die sie kaum bis an die Taille bedeckt haben würde, Grund findet. Sie muß darüber hinaus gewatet oder gesprungen sein, sonst würden wir sie jetzt nicht vermissen. Kein Unfall, Herr! Sie liegt in der Tiefe des Flugsandes und hat sich selbst da hineingestürzt.«
Nach diesem Zeugniß eines Mannes, auf dessen Aussage man sich verlassen konnte, schwieg der Sergeant. Wir Andern hielten uns gleichfalls still. Wie auf ein gegebenes Zeichen schritten wir alle wieder den Strand hinauf.
Auf den Dünen begegneten wir dem Stalljungen, der uns vom Hause her entgegengelaufen war. Es ist das ein braver Bursche, der den gehörigen Respect vor mir hat. Er überreichte mir mit betrübtem Gesicht ein kleines Billet. »Das hat mir Penelope für Sie gegeben, Herr Betteredge sie fand es in Rosanna’s Zimmer.«
Es war ihr letztes Lebewohl an den alten Mann, der sein Bestes —— Gott sei Dank immer sein Bestes —— gethan hatte, ihr beizustehen.
»Sie haben mir in früheren Tagen oft vergeben, Herr Betteredge. Das nächste Mal, wo Sie den Zitterstrand betreten, verzeihen Sie mir wieder, wenn Sie können. Ich habe mein Grab gefunden, wo es meiner wartete. Ich bin Ihnen bis in den Tod für Ihre Güte dankbar gewesen.«
Das war Alles. Die wenigen Worte erschütterten mich auf’s Tiefste. Wir weinen leicht, wenn wir jung sind und wenn wir im Begriff stehen, die Welt zu verlassen. Ich brach in Thränen aus.
Sergeant Cuff trat mir, unfehlbar in freundlicher Absicht, einen Schritt näher, aber ich fuhr vor ihm zurück. »Rühren Sie mich nicht an!« sagte ich. »Die Furcht vor Ihnen hat sie das Leben gekostet«
»Sie irren sich, Herr Betteredge,« sagte er ruhig, »aber wir werden Zeit genug haben, darüber zu reden, wenn wir wieder zu Hause sind.«
Ich folgte den Uebrigen, auf den Arm des Stalljungen gestützt. In strömendem Regen kehrten wir nach Hause zurück, wo Verwirrung und Schrecken unserer harrten.

Achtzehntes Capitel.
Als wir im Hause eintrafen, war die Schreckensbotschaft von einigen uns vorausgeeilten Gutsleuten bereits überbracht worden. Wir fanden die Dienerschaft in einem Zustande der höchsten Aufregung. Als wir an Mylady’s Zimmer vorüberkamen, wurde die Thür von innen heftig aufgestoßen und meine Herrin trat, gefolgt von Herrn Franklin heraus. Sie rang vergebens nach Fassung, die Todesnachricht hatte sie ganz außer sich gebracht. »Das haben Sie zu verantworten« rief sie laut mit einer furchtbar drohenden Handbewegung gegen den Sergeanten. »Gabriel, geben Sie dem Elenden sein Geld und befreien Sie mich von seinem Anblick.«
Der Sergeant war der einzige unter uns, der im Stande war, es mit ihr aufzunehmen, denn er allein hatte die Fassung nicht verloren.
Mylady,« sagte er, »ich habe diesen betrübenden Unglücksfall so wenig zu verantworten, wie Sie. Wenn Sie nach Verlauf einer halben Stunde noch darauf bestehen, daß ich dieses Haus verlasse, so werde ich Ihre Entlassung, gnädige Frau, aber nicht Ihr Geld annehmen.« Er sprach diese Worte in einem höchst respectvollen, aber sehr festen Tone und sie verfehlten ihre Wirkung sowenig auf meine Herrin, wie auf mich. Sie ließ sich von Herrn Franklin in ihr Zimmer zurückführen. Als sich die Thür hinter ihnen geschlossen hatte, bemerkte der Sergeant, der sich unter den weiblichen Dienstboten in seiner beobachtenden Weise umsah, daß, während alle Uebrigen nur erschrocken schienen, Penelope weinte. —— »Kommen Sie doch,« sagte er zu ihr, »wenn Ihr Vater seine nassen Kleider gewechselt haben wird, in sein Zimmer, um mit uns zu reden.«
Noch ehe eine halbe Stunde vergangen war, hatte ich trockene Kleider angezogen und Sergeant Cuff aus meiner Garderobe gleichfalls mit dem Nöthigen versehen. Penelope trat herein, um zu hören, was der Sergeant von ihr wolle. Ich glaube, ich hatte noch nie so lebhaft empfunden, was für eine gute pflichttreue Tochter ich habe, wie in jenem Augenblick. Ich nahm sie auf den Schooß und betete für sie. Sie verbarg ihr Gesicht an meinem Busen, schlang ihre Arme um meinen Hals und wir schwiegen eine kleine Weile. Der Sergeant trat an’s Fenster und blickte hinaus. Es schien mir nur schicklich, ihm für dieses rücksichtsvolle Benehmen zu danken und das that ich.
Vornehme Leute, die sich des höchsten Luxus in allen Dingen erfreuen, können sich auch den Luxus, ihren Gefühlen nachzugeben, erlauben. Geringe Leute dürfen sich das nicht gestatten. Die Noth, welche die Vornehmen verschont, hat mit uns kein Mitleid. Wir müssen es lernen, unsere Gefühle zurückzudrängen und unser Joch, geduldig weiter zu tragen. Dies soll keine Klage sein, sondern nur eine Bemerkung. Penelope und ich standen dem Sergeanten zu Diensten, sobald er sich wieder an uns wandte. Auf die Frage, was ihre Kameradin wohl zum Selbstmord veranlaßt haben möge, antwortete meine Tochter, wie es der Leser nicht anders erwarten wird, daß es die Liebe zu Herrn Franklin Blake gewesen sei. Auf die fernere Frage, ob sie diese ihre Auffassung bereits irgend Jemandem mitgetheilt habe, antwortete Penelope, sie habe Rosanna’s wegen der Sache gegen Niemanden Erwähnung gethan. Hier schien es mir nothwendig, ein Wort hinzuzufügen und ich sagte:
»Und auch Herrn Franklin’s wegen, liebes Kind. Wenn Rosanna aus Liebe zu ihm gestorben ist, so ist es ohne sein Wissen und ohne seine Schuld geschehen. Laß ihn, wenn es dazu kommt, heute ohne den unnöthigen Kummer der Kenntniß des wahren Sachverhalts abreisen.«
Sergeant Cuff bemerkte nur: »Ganz richtig!« und beobachtete dann wieder ein Schweigen, während dessen er, wie mir schien, Penelopes Auffassung mit seiner eigenen, von dieser abweichenden, die er aber für sich behielt, verglich.
Nach Verlauf einer halben Stunde schellte Mylady.
Auf dem Wege zu ihr begegnete ich Herrn Franklin, der eben aus ihrem Wohnzimmer kam. Er bemerkte, daß Mylady bereit sei, Sergeant Cuff, wie schon mehrfach, in meiner Gegenwart zu sprechen und fügte hinzu, daß er selbst noch vorher dem Sergeanten zwei Worte zu sagen wünsche.
Als wir zusammen wieder nach meinem Zimmer zurückgingen, stand er in der Halle still, um die dort hängende Tabelle der Abgangszeiten der Eisenbahnen anzusehen.
»Wollen Sie uns wirklich verlassen, Herr Franklin?« fragte ich. »Fräulein Rachel wird sicherlich wieder zur Vernunft kommen, wenn Sie ihr nur Zeit lassen.«
»Sie wird wieder zur Vernunft kommen,« antwortete Herr Franklin, »wenn sie hört, daß ich abgereist bin und daß sie mich nicht wiedersehen wird.«
Es schien mir, als ob er unter dem Eindruck der Behandlung sprach, die ihm von meinem jungen Fräulein widerfahren war. Aber dem war nicht so. Mylady hatte von dem Augenblick an, wo zuerst Polizeibeamte in unser Haus gekommen waren, bemerkt, daß die bloße Erwähnung von Franklins Namen Fräulein Rachel völlig außer sich bringe. Er hatte seine Cousine zu sehr geliebt, um sich jenen Sachverhalt fest einzugestehen, bis sich ihm die Wahrheit in dem Augenblick gewaltsam aufdrängte, wo sie zum Besuch ihrer Tante abfuhr.
Nachdem ihm die Augen endlich so grausam geöffnet waren, hatte Herr Franklin seinen Entschluß gefaßt —— den einzigen Entschluß, den ein Mann von Herz fassen konnte —— das Haus zu verlassen.
Was er dem Sergeanten zu sagen hatte, sprach er in meiner Gegenwart. Er erklärte, daß Mylady bereit sei, anzuerkennen, daß ihre Aeußerung von vorhin übereilt gewesen sei, und fragte, ob Sergeant Cuff sich nun bereit finden lassen wolle, sein Honorar anzunehmen und die Angelegenheit des Diamanten auf sich beruhen zu lassen. Der Sergeant antwortete: »Nein, mein Herr, ich empfange mein Honorar dafür, daß ich meine Pflicht thue, und werde es daher in diesem Fall nicht annehmen, bis meine Pflicht gethan ist.«
»Ich verstehe Sie nicht!« erwiderte Herr Franklin.
»So will ich mich näher erklären« entgegnete der Sergeant. »Als ich hierher kam, übernahm ich es, das nöthige Licht über die Angelegenheit des verlornen Diamanten zu verbreiten. Ich bin bereit und warte nur auf die Möglichkeit mein Wort zu lösen. Nachdem ich Lady Verinder den Fall dargelegt haben werde, wie er jetzt liegt, «und nachdem ich mich gegen sie klar darüber ausgesprochen haben werde, welche Wege jetzt zur Wiedererlangung des Mondsteins einzuschlagen sein würden, werde ich mich meiner Verantwortlichkeit ledig fühlen. Dann mag Verinder selbst entscheiden, ob ich mein Verfahren fortsetzen soll oder nicht. Erst dann werde ich gethan haben, was ich zu thun übernommen habe, und bereit sein, mein Honorar anzunehmen.«
Durch diese Worte führte Sergeant Cuff uns zu Gemüth, daß es selbst in der Sphäre der geheimen Polizei einen guten Ruf zu verlieren giebt.
Seine Art, die Sache anzusehen, war so entschieden die richtige, daß sich nichts weiter darüber sagen ließ. Als ich aufstand, um ihn nach Mylady’s Zimmer zu geleiten, fragte er, ob Herr Franklin dabei zu sein wünsche, wenn er mit Mylady redete. Herr Franklin antwortete: »Nur falls Lady Verinder es wünschen sollte!« und flüsterte mir in dem Augenblick, wo ich mit dem Sergeanten hinausging, noch die Worte zu: »Ich weiß, was der Mann über Rachel sagen wird; und ich liebe sie zu sehr, um das ruhig mit anhören zu können. Lassen Sie mich davon!«
Und so blieb er zurück, trübselig ans Fenster gelehnt, den Kopf auf die Hand gestützt, während Penelope durchs Schlüsselloch sah und ihm gern tröstend zugeredet hätte. An Herrn Franklin’s Stelle hätte ich sie hineingerufen.
Wenn wir von einem Mädchen schlecht behandelt sind, so gewährt es uns einen großen Trost, einem andern davon zu erzählen, denn meistentheils nimmt die Andere Partei für uns. Vielleicht hat er sie auch, nachdem ich den Rücken gekehrt, noch hineingerufen und in diesem Fall würde meine Tochter gewiß Alles aufgeboten haben, um Herrn Franklin zu trösten.
Inzwischen gingen Sergeant Cuff und ich zu Mylady auf ihr Zimmer.
Bei der letzten Conferenz, die wir mit ihr gehabt, hatten wir sie nicht allzu geneigt gefunden, ihre Augen von dem vor ihr liegenden Buche zu erheben. Dieses Mal trat sie uns besser gerüstet entgegen. Sie sah dem Sergeanten mit einem Blick, der ganz so fest war wie der seinige, in’s Auge.
Der Genius der Familie leuchtete aus jedem ihrer Züge hervor, und ich war jetzt überzeugt, daß Sergeant Cuff einen ebenbürtigen Gegner an meiner Herrin finden werde, die sich aufgerafft hatte und entschlossen war, das Schlimmste zu hören, was er ihr sagen könne.
Mylady ergriff, nachdem wir Platz genommen hatten, zuerst das Wort.
»Sergeant Cuff,« sagte sie, »die rücksichtslose Art, mit der ich mich vor einer halben Stunde gegen Sie ausgedrückt habe, wäre vielleicht zu entschuldigen. Indessen will ich gar nicht versuchen mich zu entschuldigen, sondern aufrichtig bekennen, daß es mir leid thut, wenn ich Ihnen zu nahe getreten bin.«
Die Anmuth in Ausdruck und Geberde, mit welcher sie diese Worte sprach, verfehlte ihre Wirkung auf den Sergeanten nicht. Er bat um die Erlaubniß, sich rechtfertigen zu dürfen, indem er diese Rechtfertigung als eine Pflicht der Hochachtung für meine Herrin bezeichnete.
Er könne unmöglich, sagte er, in irgend einer Weise für den Unglücksfall, welcher uns Alle so tief erschüttert habe, verantwortlich gemacht werden und zwar aus dem einfachen Grunde, daß es für den erfolgreichen Verlauf seiner Untersuchung gerade von der entscheidendsten Wichtigkeit gewesen wäre, weder etwas zu sagen noch zu thun, was Rosanna hätte beunruhigen können.
Er forderte mich auf ihm ’zu bezeugen, daß er sie keinen Moment aus den Augen gelassen habe. Ich konnte ihm dieses Zeugnis, nicht versagen, und damit hätte, wie mir schien, die Sache rechtlich auf sich beruhen bleiben können.
Sergeant Cuff ging indessen noch einen Schritt weiter, offenbar —— wie der Leser sich gleich selbst überzeugen wird, —— zu dem Zweck, um es gewaltsam zu der denkbar peinlichsten Erklärung zwischen Mylady und ihm zu bringen.
»Ich habe,« fing der Sergeant an, »ein Motiv für den Selbstmord des Mädchens anführen gehört, das möglicherweise wirklich zu der That Veranlassung gegeben hat.« Dieses Motiv hat mit der Angelegenheit, derentwegen ich mich hier befinde, durchaus nichts zu thun. Ich halte es jedoch für meine Pflicht hinzuzufügen, daß ich anderer Ansicht bin. Nach meiner Meinung hat eine unerträgliche Seelenangst in Verbindung mit dem Verlust des Diamanten das arme Geschöpf zu seiner unseligen That getrieben. Ich maße mir nicht an, den Grund jener unerträglichen Seelenangst zu kennen. Ich glaube aber —— mit Ihrer Erlaubniß, Mylady —— eine Person bezeichnen zu können, welche im Stande ist zu entscheiden, ob ich Recht oder Unrecht habe.«
»Ist diese Person augenblicklich hier im Hause?« fragte meine Herrin nach einer kleinen Pause.
»Diese Person hat das Haus verlassen, Mylady.«
Diese Antwort bezeichnete auf die unzweideutigste Art Fräulein Rachel als die fragliche Person. Es entstand eine Pause. die mir ewig dauern zu müssen schien. Gott im Himmel! wie der Wind heulte und wie der Regen gegen das Fenster peitschte, während ich da saß und wartete, ob einer von Beiden wieder das Wort ergreifen möchte.
»Haben Sie die Güte,« sagte Mylady endlich, »sich deutlich zu erklären. Meinen Sie meine Tochter?«
»Ja!« antwortete Sergeant Cuff kurz.
Meine Herrin hatte ihre Geldbörse bei sich liegen als wir ins Zimmer traten, ohne Zweifel um dem Sergeanten ein Honorar zu bezahlen. Jetzt legte sie dieselbe in eine Schublade. Es versetzte mir einen Stich ins Herz, zu sehen, wie ihre arme Hand dabei zitterte —— diese Hand, die ihren alten Diener mit Wohlthaten überschüttet hatte; diese Hand, in die ich Gott bitte, die meinige legen zu können, wenn einmal mein Stündlein schlagen wird und ich meine Stelle für immer verlassen muß.
»Ich hatte gehofft,« sagte Mylady sehr langsam und ruhig, »daß ich Ihre Dienste belohnen und Sie entlassen können würde, ohne daß der Name Fräulein Verinder’s offen zwischen uns ausgesprochen wäre, wie es jetzt eben geschehen ist. Mein Neffe wird Ihnen vermuthlich, bevor Sie hierher kommen, eine Mittheilung gemacht haben.«
»Herr Blake hat mir Ihre Bestellung ausgerichtet und ich habe ihm gesagt, warum ——«
»Ich verlange Ihre Gründe nicht zu kennen. Nachdem, was Sie vorhin ausgesprochen haben, wissen Sie so gut wie ich, daß Sie zu weit gegangen sind, um jetzt zurückzutreten. Ich bin es mir selbst und meinem Kinde schuldig, darauf zu bestehen, daß Sie jetzt noch länger hier verweilen und daß Sie sich jetzt unumwunden aussprechen.«
Der Sergeant sah auf seine Uhr.
»Wenn die Zeit hingereicht hätte, Mylady,« antwortete er, »so würde ich es vorgezogen haben, meinen Bericht schriftlich zu erstatten. Wenn aber die Untersuchung ihren Fortgang nehmen soll, so ist die Zeit zu kostbar, um mit Schreiben vergeudet zu werden. Ich bin bereit, sofort zu reden. Es ist das ein für mich nicht weniger, als für Sie, Mylady, peinliches Geschäft ——«
Hier unterbrach ihn meine Herrin zum zweiten Mal.
»Vielleicht bin ich im Stande,« sagte sie »es weniger peinlich für Sie und für meinen Diener und guten Freund hier zu machen, wenn ich mit dem guten Beispiel einer rückhaltslosen Aeußerung vorangehe. Sie haben Fräulein Verinder in Verdacht, uns Alle zu hintergehen und den Diamanten zu einem besondern Zweck bei Seite gebracht zu haben. Ist dem so?«
»Vollkommen, Mylady!«
»Gut. Als Fräulein Verinder’s Mutter muß ich Ihnen, ehe Sie mit Ihrem Bericht beginnen, erklären, daß sie absolut unfähig ist, eine Handlung wie die, deren Sie sie zeihen, zu begehen. Ihre Kenntniß ihres Charakters ist wenige Tage alt; meine Kenntniß ihres Charakters aber so alt, wie sie selbst. Sprechen Sie Ihren Verdacht so entschieden aus, wie Sie wollen —— Sie können mich auf keine Weise dadurch verletzen ich bin im Voraus fest überzeugt, daß Sie trotz aller Ihrer Erfahrung von den Umständen in verhängnißvoller Weise irregeleitet worden sind. Vergessen Sie nicht, daß mir keinerlei besondere Kunde in dieser Angelegenheit zu Gebote steht. Meine Tochter hat mich ganz so wenig in ihr Vertrauen gezogen, wie Sie. Den einzigen Grund, der mich berechtigt, so entschieden zu sprechen, haben Sie bereits gehört: Ich kenne mein Kind!«
Dabei wandte sie sich zu mir und reichte mir ihre Hand. Ich küßte sie schweigend. »Fahren Sie fort!« sagte sie dann, indem sie den Sergeanten wieder mit festem Blicke ansah.
Sergeant Cuff verneigte sich. Das Benehmen meiner Herrin hatte nur einen Eindruck auf ihn hervorgebracht. Der Ausdruck des Brütens auf seinem Gesicht machte einen Augenblick einem milderen Zuge Platz, als ob sie ihm leid thue. In seiner Ueberzeugung aber war er, wie leicht zu sehen war, durch ihre Worte nicht einen Augenblick wankend gemacht. Er setzte sich in Positur und begann seinen nichtswürdigen Angriff aus Fräulein Rachel’s Charakter mit folgenden Worten: »Ich muß Sie ersuchen, Mylady, dieser Angelegenheit so gut von meinem Standpunkte aus, wie von dem Ihrigen gerade in’s Angesicht zu sehen. Wollen Sie die Güte haben, sich an meine Stelle zu versetzen und sich zu denken, daß Sie hier mit meinen Erfahrungen eingetroffen wären? und wollen Sie mir gestatten, diese meine Erfahrungen ganz kurz zu resümiren?«
Meine Herrin gab ihm ein bejahendes Zeichen und der Sergeant fuhr fort: »Während der letzten zwanzig Jahre bin ich bei Familienangelegenheiten häufig in der Eigenschaft eines Vertrauensmannes hinzugezogen worden. Das einzige Resultat dieser meiner Familienpraxis welches in irgend einer Beziehung zu der vorliegenden Angelegenheit steht, kann ich in zwei Worte zusammenfassen. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, daß junge Damen von vornehmer Familie Privatschulden haben, welche sie ihren nächsten Verwandten und Freunden nicht zu bekennen wagen. Oft haben sie diese Schulden bei Putzmacherinnen und Juwelieren, zuweilen bedürfen. sie des Geldes auch zu Zwecken, deren Vorhandensein ich in dem vorliegenden Fall nicht annehme und durch deren Erwähnung ich Sie nicht verletzen möchte. Merken Sie sich das Gesagte gefälligst wohl, Mylady, und nun lassen Sie uns sehen, wie die Ereignisse in diesem Hause mir meine alte Erfahrung ohne Rücksicht auf meine persönlichen Gefühle aufs Neue aufgedrängt haben.«
Er ging einen Augenblick mit sich zu Rath und fuhr dann mit einer furchtbaren Klarheit, die kein Mißverständniß zuließ, und einer grauenerregenden Gerechtigkeit, die keinen Menschen schonte, fort.
»Meine erste Information in Betreff des Verlustes des Mondsteins,« sagte der Sergeant, » erhielt ich von dem Oberbeamten Seegreaf. Er erwies sich als vollkommen unfähig, den Fall zu leiten. Das Einzige in seinen Mittheilungen, was mich als beachtenswerth frappirte, war, daß Fräulein Verinder sich geweigert habe sich von ihm befragen zu lassen und sich gegen ihn in einer unbegreiflich harten und geringschätzigen Art geäußert habe. Ich fand das auffallend, schrieb es aber hauptsächlich einer gewissen Plumpheit in dem Benehmen des Oberbeamten zu, durch die er die junge Dame verletzt haben konnte. Darauf ließ ich den Umstand einstweilen auf sich beruhen und übernahm für mich allein die Leitung der Untersuchung. Dieselbe führte, wie Sie wissen, zu der Entdeckung des Farbenflecks an der Thür und zu Herrn Franklin Blake’s Aussage, die mich überzeugte, daß dieser Farbenfleck und der Verlust des Diamanten zwei Bestandtheile eines und desselben Räthselspiels bildeten. Bis dahin war mein Verdacht, wenn ich überall einen solchen hegte, darauf gerichtet gewesen, daß der Mondstein gestohlen sei und daß einer der Dienstboten vielleicht des Diebstahls werde überführt werden können. Was geschieht aber in diesem Stadium der Angelegenheit? Fräulein Verinder tritt plötzlich aus ihrem Zimmer und redet mich an. Ich beobachte drei verschiedene Umstände bei der jungen Dame. Sie ist noch in der leidenschaftlichen Aufregung, obgleich mehr als vierundzwanzig Stunden seit dem Verlust des Diamanten verflossen sind; sie behandelt mich, wie sie bereits den Oberbeamten Seegreaf behandelt hat und äußert sich über Herrn Franklin Blake in einer Weise, die deutlich zeigt, daß sie sich von ihm tödtlich beleidigt glaubt. Hier, sage ich mir, ist eine junge Dame, welche einen kostbaren Juwel verloren hat —— eine junge Dame, die, wie mich meine eignen Augen und Ohren überzeugen, von ungestümem Temperament ist. Und was thut sie unter diesen Umständen und mit diesem Character? Sie verräth einen unerklärlichen Unwillen gegen Herrn Blake, gegen den Herrn Oberbeamten und mich, mit andern Worten gegen eben die drei Personen, die alle auf verschiedene Weise mit Versuchen beschäftigt sind, ihr bei der Wiedererlangung ihres verlorenen Juwels behilflich zu sein. An diesem Punkt der Untersuchung angelangt, Mylady, fange ich an, bei meiner eigenen Erfahrung nach einem Aufschluß über dieses unerklärliche Benehmen zu suchen. Diese Erfahrung läßt mich Fräulein Verinder in die Reihe der andern mir bekannten jungen Damen stellen: sie lehrt mich, daß das Fräulein Schulden hat, zu denen sie sich nicht bekennen darf und die bezahlt werden müssen; und läßt mich mir die Frage verlegen, ob der Verlust des Diamanten nicht etwa damit zu erklären sein möchte, daß der Diamant im Geheimen zur Bezahlung jener Schulden verpfändet sei. Das ist der Schluß, den meine Erfahrung aus den vorliegenden Thatsachen zieht. Und was hat, wenn ich fragen darf, Ihre Erfahrung, Mylady, dagegen vorzubringen?«
»Was ich Ihnen bereits gesagt habe,« antwortete meine Herrin. »Die Umstände haben Sie irre geleitet.«
Ich meinerseits schwieg. Mir schwebte —— Gott weiß, wieso —— Robinson Crusoe vor. Ich wünschte in jenem Augenblick lebhaft, Sergeant Cuff wäre auf eine wüste —— Insel versetzt, wo er keinen Freitag zu seiner Gesellschaft und kein Schiff zu seiner Rettung fände. (NB. Ich bin ein ganz guter Christ, so lange mein Christenthum auf keine zu harte Probe gestellt wird. Und es ist tröstlich für mich zu denken, daß es den meisten meiner Leser ebenso gehen wird.)
Sergeant Cuff fuhr fort: »Nachdem ich so mit Recht oder mit Unrecht meinen Schluß gezogen hatte, war das Nächste, was ich zu thun hatte, mir die Beweise für die Richtigkeit meiner Annahme zu verschaffen. Ich schlug Ihnen, Myladh, die Durchsuchung aller Kleidungsstücke im Hause vor. Das war ein Mittel das Kleidungsstück aufzufinden, welches aller Wahrscheinlichkeit nach die übergewischte Stelle an der gemalten Thür verursacht hatte und war demnach ein Mittel, mir einen Beweis für die Richtigkeit meines Schlusses zu verschaffen. Wie ging es aber damit? Sie, Mylady, Herr Blake und Herr Ablewhite erklärten sich bereit, nur Fräulein Verinder vereitelte die ganze Durchsuchung durch eine entschiedene Weigerung, ihre Garderobe derselben unterziehen zu lassen. Dieses Resultat überzeugte mich, daß meine Ansicht die richtige sei. Wenn Sie, Mylady, und Herr Betteredge dabei beharren, mir nicht beizustimmen, so müssen Sie vor dem Geschehenen absichtlich die Augen verschließen. In Ihrer Gegenwart sagte ich der jungen Dame, daß ihre Abreise bei der dermaligen Sachlage meinen Bemühungen zur Wiedererlangung ihres Juwels hindernd in den Weg treten würde. Sie haben selbst gesehen, daß sie trotz dieser Erklärung davonfuhr. Sie haben ferner Beide selbst gesehen, daß sie, weit entfernt Herrn Blake, der mehr als alle Uebrigen im Hause dazu gethan hatte, mir den rechten Schlüssel zu dem Geheimniß in die Hand zu geben, diese seine thätige Hilfe zu verzeihen, ihn vielmehr auf den Stufen ihres mütterlichen Hauses vor Aller Augen insultirte. Wie soll man sich dies erklären, wenn Fräulein Verinder nicht um den Verbleib des Diamanten weiß?«
Dieses Mal sah er mich an. Es war geradezu schrecklich, mit ansehen zu müssen, wie er einen Beweis nach dem andern gegen Fräulein Rachel aufthürmte, und sich sagen zu müssen, während man sie um Alles gern vertheidigt hätte, daß die Wahrheit seiner Behauptungen unbestreitbar sei. Ich bin, Gott sei Dank! so angelegt, daß mir Vernunftgründe nichts anhaben können. Diese Disposition setzte mich in den Stand, fest bei Mylady’s Ansicht, die auch meine eigene war, zu beharren. Das gab mir Muth und ließ mich Sergeant Cuff fest in’s Auge blicken. Nimm Dir ein Beispiel an mir, lieber Leser; es wird Dir viele Verdrießlichkeiten im Leben ersparen. Versieh Dich mit einer dicken Haut gegen Vernunftgründe und Du sollst sehen, wie sich all’ die klugen Leute, die Euch gern zu Eurem eigenen Besten kratzen möchten, die Nägel an Eurer Haut stumpf kratzen werden.
Als Sergeant Cuff sah, daß weder ich noch Mylady eine Bemerkung machten, fuhr er fort. Herr Gott! wie es mich wüthend machte, zu sehen, daß unser Schweigen ihn nicht im Mindesten außer Fassung brachte!
»So liegt die Sache, Mvlady,« sagte er, »so weit Fräulein Verinder allein dabei in Betracht kommt. Demnächst müssen wir sehen, wie die Sache in Betreff Fräulein Verinder’s in Verbindung mit der verstorbenen Rosanna Spearman liegt. Wollen Sie mir erlauben, einen Augenblick auf die Weigerung Ihrer Tochter zurückzukommen, ihre Garderobe durchsuchen zu lassen. Nachdem ich diesen Umstand gehörig erwogen, hatte ich zunächst zwei Fragen in Betracht zu ziehen: In Beziehung erstens auf die richtige Leitung meiner Untersuchung und zweitens darauf, ob Fräulein Verinder unter dem weiblichen Personal des Hauses eine Mitschuldige habe. Nachdem ich die Sache sorgfältig überdacht hatte, beschloß ich die Untersuchung in einer Weise zu leiten, die wir in unserer technischen Sprache als die »unregelmäßige« bezeichnen. Und zwar aus folgendem Grunde: Ich hatte mit einer Familienangelegenheit zu thun, die ich mich für verpflichtet halten mußte, den Kreis der Familie nicht überschreiten zu lassen. Je weniger die Sache von sich reden macht und je weniger Fremde ich zur Mitwirkung heranzuziehen brauchte, desto besser. An das gewöhnliche Verfahren, verdächtige Personen zu verhaften, vor Gericht zu stellen und so weiter, war in einem Fall nicht zu, denken, bei welchem Ihre Tochter, Mylady, wie ich glaubte, die Hauptschuldige war. In einem solchen Fall schien es mir sicherer, mir einen Mann von Herrn Betteredge’s Charakter und Stellung im Hause, der die Dienstboten so genau kennt und dem die Ehre der Familie am Herzen liegt, als Gehilfen zuzugesellen, Herr Blake würde mir dieselben Dienste haben leisten können, wenn nicht ein Hindernis; im Wege gewesen wäre. Er hatte schon sehr bald den Plan meines Verfahrens durchschaut und bei dem Interesse, welches er an Fräulein Verinder nahm, war daher ein Zusammengehen mit ihm für mich unmöglich. Ich behellige Sie, Mylady, mit diesen Einzelheiten, um Ihnen zu zeigen, daß ich das Familiengeheimniß auf den Kreis der Familie beschränkt habe. Ich bin der einzige nicht zur Familie gehörige, der dasselbe weiß, und meine Existenz ist mir nur um den Preis der Discretion gesichert.«
Bei diesen Worten fühlte ich, daß meine Existenz mir um den Preis der Indiscretion gesichert sei. In meinem Alter vor meiner Herrin als eine Art von delegirten Polizeibeamten dazustehen, war wieder mehr als mein Christenthum zu ertragen vermochte.
»Ich erlaube mir zu erklären, Mylady,« sagte ich, »daß ich meines Wissens niemals in irgend einer Weise bei dieser abscheulichen Untersuchung behilflich gewesen bin: und ich fordere Sergeant Cuff auf, mir darin zu widersprechen, wenn er kann.«
Nachdem ich mir durch diese Worte Luft gemacht hatte, fühlte ich mich sehr erleichtert. Mylady erwies mir die Ehre, mich freundlich aus die Schulter zu klopfen.
Ich blickte mit gerechter Entrüstung auf den Sergeanten, um zu sehen, was er zu solcher Ehrenerklärung für ein Gesicht mache! Der Sergeant sah mich mit einem milden Blicke wieder an und schien mir gewogener als je.
Mylady forderte ihn auf, in seinem Bericht fortzufahren. »Ich erkenne,« sagte sie, »daß Sie redlich bemüht gewesen sind, in meinem vermeintlichen Interesse Ihr Bestes zu thun. Ich bin bereit zu hören, was Sie mir weiter zu sagen haben.«
»Was ich zunächst zu berichten habe,« antwortete Sergeant Cuff, »bezieht sich auf Rosanna Spearman. Ich erkannte das Mädchen, wie Sie sich erinnern werden, Mylady, wieder, als sie das Wäschebuch hier in dieses Zimmer brachte. Bis zu jenem Augenblick war ich zu zweifeln geneigt, daß Fräulein Verinder ihr Geheimniß irgend Jemandem anvertraut habe. Sobald ich Rosanna’s ansichtig wurde, änderte ich meine Meinung. Ich faßte auf der Stelle den Verdacht gegen sie, daß sie um das Beiseitebringen des Diamanten wisse. Das arme Geschöpf hat einen schrecklichen Tod gefunden und ich möchte nicht, daß Sie jetzt, wo sie todt ist, glaubten, daß ich unnöthiger Weise hart gegen sie gewesen sei. Wenn hier der Fall eines gemeinen Diebstahls vorgelegen hätte, so würde ich Rosanna die Wohlthat des Zweifels ebenso bereitwillig wie allen übrigen Dienstboten im Hause haben angedeihen lassen. Unsere Erfahrungen in Betreff der aus Verbesserungs-Anstalten hervorgegangenen Mädchen lehren uns, daß sie sich, wenn sie in Dienst genommen und freundlich und verständig behandelt werden, in den meisten Fällen als wirklich reuig und der aus sie verwandten Mühe würdig erweisen. Aber bei dem hier vorliegenden Fall handelt es sich nicht um einen gemeinen Diebstahl. Hier lag vielmehr nach meiner Ueberzeugung der Fall eines tief angelegten Betruges vor, hinter welchem die Eigenthümerin des Diamanten steckte. Von diesem Gesichtspunkte aus war die erste Erwägung, die sich mir im Hinblick auf Rosanna naturgemäß darbot, diese: Sollte sich Fräulein Verinder mit Ihrer Erlaubniß, Mylady —— damit begnügen, uns. Alle zu dem Glauben zu verleiten, daß der Mondstein einfach verloren sei? Oder sollte sie nicht einen Schritt weiter gehen, und uns die täuschende Vorstellung beizubringen suchen, daß der Mondstein gestohlen sei? In dem letztern Fall kann ihr Rosanna Spearman, als eine notorische Diebin und als die von allen geeignetste Person, um Sie, Mylady, und mich auf eine falsche Fährte zu lenken, gelegen.«
Ist es möglich, fragte ich mich, den Fall in einem für Fräulein Rachel und Rosanna ungünstigeren Licht darzustellen, als er es gethan hat? Ja es war möglich, wie sich die Leser sogleich überzeugen sollen.
»Ich hatte noch einen zweiten Grund,««fuhr er fort, »gegen das verstorbene Mädchen Verdacht zu fassen, und zwar einen Grund, der mir noch triftiger zu sein schien, als der erste. Wer konnte wohl die Person sein, welche Fräulein Rachel dabei behilflich sein würde, sich für den Diamanten im Geheimen Geld zu verschaffen? Niemand anders als Rosanna Spearman. Keine junge Dame in Fräulein Verinder’s Stellung konnte ein so gewagtes Geschäft persönlich betreiben. Sie bedurfte eines Vermittlers, und wer, frage ich wieder, war geeigneter, diesen abzugeben als Rosanna Spearman? Ihr verstorbenes Hausmädchen, Mylady, war ihrer Zeit eine sehr gewandte Diebin. Sie hatte, wie ich ganz bestimmt weiß, Beziehungen zu einem der wenigen Geldverleiher in London, die sich möglicher Weise dazu bereit finden lassen würden, eine große Summe auf einen so berühmten Edelstein, wie es der Mondstein ist, vorzuschießen, ohne unbequeme Fragen zu thun oder auf unbequemen Bedingungen zu bestehen. Merken Sie sich das gefälligst wohl, Myladty, und nun lassen Sie mich Ihnen zeigen, welche Bestätigung mein Verdacht in Rosanna’s eigenen Handlungen und den Schlüssen gefunden hat, welche sich von selbst aus diesen Handlungen ergeben.«
Darauf ließ er alle Schritte Rosanna’s die Revue passiren. Der Leser kennt diese Schritte bereits so gut wie ich und wird sich leicht vorstellen können, in wie unverantwortlicher Weise dieser Theil seines Berichts das Andenken des armen todten Mädchens mit der Schuld der Betheiligung an dem Verschwinden des Mondsteins befleckte. Seine nun folgende Mittheilung wirkte selbst auf meine Herrin entmuthigend. Sie äußerte nichts, als er zu Ende war. Das schien aber dem Sergeanten völlig gleichgültig Unerschüttert fuhr er —— hol’ ihn der Teufel! —— fort:
»Nachdem ich Ihnen, Mylady, so den ganzen Fall dargestellt habe, wie er nach meiner Ansicht liegt, bleibt mir nur noch übrig, Ihnen meine Vorschläge in Betreff Dessen zu machen, was demnächst zu thun sein wird. Es giebt, wie ich glaube, zwei Wege, diese Untersuchung mit Erfolg zu Ende zu führen. Den einen dieser Wege betrachte ich als vollkommen sicher. Der andere ist, wie ich zugeben muß, nichts als ein kühnes Experiment. Urtheilen Sie selbst, Mylady. Soll ich mit dem sichern Wege beginnen?«
Mylady gab ihm ein Zeichen, nach ganz eigenem Ermessen zu verfahren.
»Ich danke Ihnen, Mylady,« sagte der Sergeant, »da Sie mir gütigst anheim stellen, wollen wir mit dem sichern Wege beginnen. Ich proponire, gleichviel, ob Fräulein Verinder in Frizinghall bleibt oder hierher zurückkehrt, alle ihre Schritte, die Leute, mit denen sie verkehrt, die Spazierritte oder Gänge, die sie macht, und die Briefe, die sie schreibt oder empfängt, sorgfältig zu beobachten.«
»Und was weiter?« fragte Mylady.
»Demnächst,« antwortete der Sergeant, »werde ich mir die Erlaubniß von Ihnen erbitten, Mylady, ein Frauenzimmer als Hausmädchen an Rosanna’s Stelle im Hause einzuführen, welches mit Privat-Untersuchungen dieser Art vertraut ist und für dessen Discretion ich einstehe.«
»Und was weiter?« wiederholte Mylady.
»Demnächst und schließlich,« fuhr der Sergeant fort, »proponire ich, einen meiner Collegen zu dem Zweck eines etwaigen Arrangements zu jenem Geldverleiher in London zu schicken, den ich vorhin als früher mit Rosanna Spearman im Verbindung stehend bezeichnet habe und dessen Name und Adresse Rosanna Spearman sicherlich Fräulein Verinder mitgetheilt hat. Ich leugne nicht daß das von mir proponirte Verfahren kostspielig und zeitraubend sein wird, aber das Resultat ist sicher. Wir werfen ein Netz über den Mondstein und ziehen dieses Netz enger und enger zusammen, bis wir ihn in Fräulein Verinder’s Besitz finden, vorausgesetzt, daß sie ihn bei sich zu behalten beschließt. Wenn ihre Schulden drängen und sie sich entschließt, sich von dem Mondstein zu trennen, so wissen wir wieder, an wen wir uns zu halten haben und treffen den Mondstein bei seiner Ankunft in London.«
Ein solcher Vorschlag in Betreff ihrer eigenen Tochter gab den Worten meiner Herrin zum ersten Mal einen zornigen Ton.
»Betrachten Sie Ihren Vorschlag als von Anfang bis zu Ende abgelehnt!« sagte sie, »und gehen Sie zu Ihrem zweiten Vorschlag, die Untersuchung zu Ende zu führen, über.«
»Mein anderes Mittel,« sagte der Sergeant, indem er sich in seinem Gleichmuth durchaus nicht stören ließ, »besteht in dem Versuch jenes kühnen Experiments, das ich bereits angedeutet habe. Ich glaube mir ein ziemlich richtiges Urtheil über Fräulein Verinder’s Temperament gebildet zu haben. Sie ist nach meiner Ansicht vollkommen fähig, einen kühnen Betrug zu begehen. Aber sie ist von zu leidenschaftlichem und ungestümem Temperament und des Betrügens zu wenig gewöhnt, um sich auch in kleinen Dingen zu verstellen und allen Provocationen gegenüber die Herrschaft über sich selbst zu behaupten. Ihre Gefühle sind in dem vorliegenden Fall zu wiederholten Malen gerade in Augenblicken zum Ausbruch gekommen, in welchen ihr Interesse ihr dringend gebieten mußte, diese Gefühle zu verbergen. Aus diese Besonderheit ihres Charakters gründe ich meinen Vorschlag. Es kommt darauf an, sie in erschütternder Weise zu überraschen Mit anderen Worten: Ich proponire, Fräulein Verinder ganz unvorbereitet die Nachricht von Rosanna’s Tod in der Erwartung mitzutheilen, daß ihre besseren Gefühle bei dieser Gelegenheit zum Durchbruch kommen werden. Genehmigen Sie diesen Vorschlag, Mylady?«
Meine Herrin versetzte mich durch ihre Antwort in ein unaussprechliches Erstaunen. Sie erwiderte ihm auf der Stelle: »Ja, ich gehe auf Ihren Vorschlag ein.«
»Der Ponywagen steht für mich bereit,« sagte der Sergeant, »ich habe die Ehre, mich Ihnen zu empfehlen.«
Mylady machte eine Handbewegung, um ihn noch an der Thür zurück zu halten.
»Ich genehmige den von Ihnen proponirten Appell an die besseren Gefühle meiner Tochter,« sagte sie; »aber ich nehme als ihre Mutter das Recht in Anspruch, sie selbst auf die Probe zu stellen. Sie werden gefälligst hier bleiben und ich werde mich selbst nach Frizinghall begeben.«
Vielleicht zum ersten Male in seinem Leben stand der große Cuff bestürzt und sprachlos da wie ein gewöhnlicher Sterblicher.
Mylady klingelte und beorderte ihren Regenmantel. Es regnete noch immer heftig und der geschlossene Wagen hatte, wie der Leser weiß, Fräulein Rachel nach Frizinghall gebracht. Ich versuchte es, Mylady zu bewegen, sich nicht dem Ungestüm der Witterung auszusetzen Vergebens! Ich bat um die Erlaubniß, sie begleiten und den Regenschirm für sie halten zu dürfen. Sie wollte nichts davon hören. Der Groom fuhr mit dem Ponywagen vor. »Verlassen Sie sich auf zwei Dinge,« sagte sie noch in der Halle zum Sergeanten Cuff. »Ich werde das Experiment an Fäulein Verinder ganz so kühn anstellen, wie Sie selbst es nur immer hätten thun können. Und ich werde Sie persönlich oder brieflich von dem Resultat in Kenntniß setzen, bevor der letzte Zug nach London diesen Abend abgeht.«
Damit stieg sie in den Wagen, ergriff selbst die Zügel und fuhr nach Frizinghall.

Neunzehntes Capitel.
Nachdem meine Herrin uns verlassen, hatte ich Muße, mich wieder um Sergeant Cuff zu bekümmern. Ich fand ihn in einem behaglichen Winkel der Halle sitzend, in seinem Notizbuch blätternd und nach seiner Gewohnheit mit den Mundwinkeln zuckend.
»Machen Sie Notizen über unsern Fall?« fragte ich.
»Nein,« antwortete der Sergeant, »ich sehe nach, wo ich zunächst engagirt bin.«
»O!« rief ich. »Sie halten also die Sache hier für beendigt?«
»Ich halte dafür,« antwortete Sergeant Cuff, »daß Lady Verinder eine der gescheitesten Frauen in England ist. Ich halte ferner dafür, daß es sich viel mehr der Mühe lohnt, eine Rose anzusehen, als einen Diamanten. Wo ist der Gärtner, Herr Betteredge?«
Ueber die Mondstein-Angelegenheit war kein Wort weiter aus ihm herauszubringen. Er hatte alles Interesse an seiner eigenen Untersuchung verloren und beharrte in seinem Verlangen nach dem Gärtner. Eine Stunde später hörte ich sie im Treibhause abermals über die wilde Rose laut disputiren.
Inzwischen lag es mir ob, mich zu vergewissern, ob Herr Franklin aus seinem Entschluß beharre, uns mit dem Nachmittagszuge zu verlassen. Sobald er von dem Verlaufe und dem Ergebniß der Conferenz in Mylady’s Wohnzimmer hörte, war er auf der Stelle entschlossen, die Nachrichten aus Frizinghall abzuwarten. Diese sehr natürliche Modification seiner Pläne, welche bei gewöhnlichen Menschen keine besonderen Folgen haben würde, führte, wie sich bald zeigen sollte, in Herrn Franklin’s Fall eine bedenkliche Wirkung herbei. Sie gab ihm eine Anzahl müßiger Stunden, während deren alle ausländischen Seiten seines Charakters Zeit hatten, nach Belieben hervorzutreten.
Bald als italienischer, bald als deutscher und bald als französischer Engländer schlenderte er von einem Wohnzimmer in das andere, wußte von nichts zu reden, als von der ihm von Fräulein Rachel widerfahrenen Behandlung, und hatte Niemanden, gegen den er sich darüber aussprechen konnte, als mich. So fand ich ihn z. B. in der Bibliothek vor der Karte von Italien sitzen und unfähig, mit seinem Verdruß etwas Anderes anzufangen, als über denselben zu sprechen.
»Ich bin mir verschiedener würdiger Bestrebungen bewußt, Betteredge, aber was soll ich jetzt mit ihnen beginnen? Ich bin voll von schlummernden guten Eigenschaften, wenn Rachel mir nur zu ihrer Erweckung die Hand hätte bieten wollen!«
Er entwarf eine so beredte Schilderung seiner eigenen vernachlässigten Vorzüge und äußerte sich selbst so kläglich über diese Schilderung, als er damit zu Ende war, daß ich durchaus nicht wußte, wie ich ihn trösten sollte, als mir plötzlich einfiel, daß hier der Fall der heilsamen Anwendung einer Stelle aus Robinson Crusoe vorliege. ich humpelte nach meinem Zimmer hin und humpelte mit dem unsterblichen Buche in der Hand wieder zurück. Aber Niemand war mehr in der Bibliothek!. Die Karte von Italien starrte mich an und ich starrte sie wieder an. Ich ging in’s Wohnzimmer. Da lag sein Schnupftuch auf dem Boden zum Beweise, daß er hineingeschlendert war, aber das Zimmer war leer und das war ein Beweis, daß er wieder hinausgeschlendert war. Ich ging in’s Eßzimmer und fand dort Samuel mit einem Bisquit und einem Glas Sherry damit beschäftigt, schweigend und forschend in die leere Luft zu blicken. Vor einer Minute hatte Herr Franklin heftig geklingelt und eine kleine, leichte Erfrischung verlangt. Als Samuel dieselbe in höchster Eile und noch bevor die oben angezogene Glocke unten ausgeklungen hatte, herbeibrachte, war Herr Franklin verschwunden. Ich ging in’s Morgenzimmer und da fand ich ihn endlich. Er stand am Fenster und malte mit dem Finger Hieroglyphen auf die beschlagenen Scheiben.
»Ihr Sherry steht für Sie bereit, Herr Franklin,« sagte ich zu ihm. Aber eben so gut hätte ich eine der vier Wände des Zimmers anreden können; er war so tief in den grundlosen Abgrund seiner eigenen Grübeleien versenkt, daß ihn nichts herauszureißen vermochte. »Wie erklären Sie Rachel’s Benehmen, Betteredge?« war die einzige Antwort, die ich auf meine Anrede erhielt. Da ich nicht sofort eine passende Erwiederung zur Hand hatte, so holte ich meinen Robinson Crusoe in der festen Ueberzeugung hervor, daß wir die gewünschte Erklärung in demselben würden gefunden haben, wenn wir nur lange genug danach gesucht hätten. Herr Franklin schlug den Robinson Crusoe zu und gab sofort einen Erguß von deutsch-englischem Kauderwelsch zum Besten.
»Warum soll man das Buch nicht ansehen?« sagte er, als ob ich etwas dagegen eingewendet hätte. »Warum in aller Welt wollen Sie die Geduld verlieren, Betteredge, wenn Geduld Alles ist, dessen man zur Erforschung der Wahrheit bedarf? unterbrechen Sie mich nicht. Rachel’s Benehmen ist vollkommen verständlich, wenn Sie ihr nur die einfache Gerechtigkeit widerfahren lassen wollen, sich zuerst auf den objectiven, demnächst auf den subjektiven und endlich zum Schluß auf den objectiv-subjectiven Standpunkt zu stellen. Was wissen wir? Wir wissen, daß der Verlust des Mondsteins am vorigen Donnerstag-Morgen sie in einen Zustand nervöser Aufregung versetzt hat, von dem sie sich noch nicht wieder erholt hat. Können Sie gegen diese Anwendung des objectiven Standpunkts etwas einwenden? Gut, —— also unterbrechen Sie mich nicht. Da sie sich demnach in einem Zustand nervöser Aufregung befindet, wie können wir erwarten, daß sie sich gegen irgend Jemand in ihrer Umgebung so benehmen sollte, wie sie es unter anderen Umständen gethan haben würde? Indem wir so von innen nach außen argumentiren, wohin gelangen wir? Wir gelangen zu dem subjectiven Standpunkt. Bestreiten Sie die Berechtigung dieses Standpunktes, wenn Sie können. Gut —— was ergiebt sich daraus? Guter Gott’ natürlich ergiebt sich daraus die objektiv-subjective Erklärung! Genau genommen ist Rachel nicht sie selbst, sondern eine andere Person. Soll ich mir etwas daraus machen, von einer anderen Person grausam behandelt zu sein? Sie sind zwar recht unvernünftig Betteredge, aber das können Sie doch nicht von mir erwarten. Was ist also das schließliche Ergebniß? Das schließliche Ergebniß ist, Eurer verfluchten englischen Bornirtheit und Befangenheit zum Trotz, daß ich vollkommen glücklich und zufrieden bin. Wo ist der Sherry?«
Mein Kopf war nachgerade in einem Zustand, der mich ungewiß darüber ließ, ob er mir oder Herrn Franklin gehöre. In diesem beklagenswerthen Zustand that ich drei, wie ich glaube, objektive Dinge. Ich holte Herrn Franklin seinen Sherry, ich zog mich auf mein Zimmer zurück und tröstete mich mit der beruhigendsten Pfeife Taback, die ich in meinem ganzen Leben geraucht zu haben mich erinnere.
Daß der Leser aber nur nicht glaube, ich wäre so leichten Kaufs mit Herrn Franklin fertig geworden. Als er wieder aus dem Morgenzimmer in die Halle hineinschlenderte, nahm er seinen Weg durch die Domestikenräume, roch meine Pfeife und erinnerte sich auf der Stelle, daß er einfältig genug gewesen sei, um Fräulein Rachel’s willen das Rauchen auszugeben. Im Nu kam er mit seiner Cigarrendose zu mir hereingestürzt und war sofort wieder bei seinem unerschöpflichen Gegenstand, aber dieses Mal in seiner scharfsinnigen, witzigen, ungläubigen französischen Weise.
»Geben Sie mir Feuer, Betteredge Ist es zu begreifen, daß ein Mensch so lange wie icb geraucht haben kann, ohne dahinter zu kommen, daß die Cigarrendose ein vollständiges System für die Behandlung der Frauen in sich birgt? Merken Sie genau auf und ich will es Ihnen in zwei Worten beweisen. Sie nehmen sich eine Cigarre, Sie versuchen sie und finden sie nicht nach ihrem Geschmack. Was thun Sie? Sie werfen Sie weg und nehmen eine andere. Nun achten Sie auf die Nutzanwendung. Sie wählen sich ein Mädchen, Sie versuchen es mit ihr und sie bricht Ihnen das Herz. Narr! Zieh Dir eine Lehre aus Deiner Cigarrendose. Wirf das Mädchen weg, und versuche es mit einer anderen.«
Ich schüttelte den Kopf dazu. Gewiß außerordentlich scharfsinnig aber meine eigene Erfahrung sprach dagegen. »Als meine Selige noch lebte,« sagte ich, »fühlte ich mich oft versucht, Herr Franklin, es mit Ihrer Philosophie zu versuchen. Aber das Gesetz zwingt uns, unsere Cigarre aufzurauchen, wenn wir sie uns einmal angezündet haben.« Ich begleitete diese Bemerkung mit einer entsprechenden Handbewegung. Herr Franklin brach in Lachen aus und wir waren lustig wie ein paar Schuljungen, bis die Reihe wieder an eine neue Seite seines Charakters kam. —— So verliefen die Dinge zwischen meine jungen Herrn und mir, während der Sergeant und er Gärtner sich über die Rosen stritten bis zu dem Augenblick, wo die Nachrichten von Frizinghall kamen.
Der Ponywagen war schon eine gute halbe Stunde, bevor ich ihn zu erwarten gewagt hatte, wieder da. Mylady hatte beschlossen, für jetzt noch in dem Hause ihrer Schwester zu bleiben. Der Groom überbrachte zwei Briefe von seiner Herrin, den einen an Herrn Franklin und den andern an mich.
Herrn Franklin schickte ich seinen Brief in die Bibliothek, welchen Zufluchtsort er wieder schlendernd aufgesucht hatte. Meinen eignen Brief las ich in meinem Zimmer. Eine Anweisung, welche beim Oeffnen herausfiel, überzeugte mich, noch ehe ich von dem Inhalt des Briefes Kenntniß genommen hatte, daß die Entlassung des Sergeanten Cuff von seiner Verpflichtung, die Nachforschung in Betreff des Mondsteins zu leiten, eine abgemachte Sache sei.
Ich schickte in’s Treibhaus und ließ dem Sergeanten sagen, daß ich ihn auf der Stelle zu sprechen wünsche.
Er kam alsbald, ganz voll von seiner Unterhaltung mit dem Gärtner über die wilde Rose, und erklärte, daß ihn nie ein so eigensinniger Mensch wie Herr Begbie vorgekommen sei. Ich bat ihn, solche Kleinigkeiten jetzt auf sich beruhen zu lassen und seine volle Aufmerksamkeit einer wahrhaft ernsten Angelegenheit zuzuwenden. Erst jetzt wurde er den Brief in meiner Hand gewahr. »Ah,« sagte er in einem matten Tone, »Sie haben Nachrichten von Mylady. Betreffen dieselben mich in irgend einer Weise, Herr Betteredge?«
»Urtheilen Sie selbst, Sergeant.« Darauf trug ich ihm den Brief, so gut es mir möglich war, vor; derselbe lautete wie folgt:
»Mein lieber Gabriel! Ich ersuche Sie, Sergeant Cuff zu benachrichtigen, daß ich mein ihm gegebenes Versprechen erfüllt habe. Das Ergebniß in Betreff Rosanna’s ist Folgendes: Fräulein Verinder erklärt feierlich daß sie von dem Augenblick an, wo Rosanna zuerst mein Haus betrat, niemals ein Wort im Geheimen mit dem unglücklichen Mädchen gesprochen habe. In der Nacht, wo der Diamant verloren ging, ist sie keinen Augenblick, auch nicht zufällig mit ihr zusammen gewesen, und am Donnerstag Morgen, wo das Haus zuerst durch die Nachricht von dem Verlust des Edelsteins alarmiert wurde, bis zu dem heutigen Sonnabend Nachmittag, wo Fräulein Verinder uns verlassen hat, hat kein Verkehr irgend welcher Art zwischen ihnen stattgefunden. Das Vorstehende war das Ergebnis; meiner plötzlichen und kurzen Mittheilung von Rosanna’s Selbstmord an meine Tochter.«
Bei diesem Punkte angelangt, blickte ich auf und fragte Sergeant Cuff, was er bis jetzt von dem Briefe denke?
»Es würde Sie nur verletzen,« antwortete Sergeant Cuff, »wenn ich Ihnen meine Meinung sagen wollte. Fahren Sie fort, Herr Betteredge,« sagte er mit einem Gleichmuth, der Einen hätte zur Verzweiflung bringen können, »fahren Sie fort!«
Es fiel mir ein, daß dieser Mensch noch eben vorher die Frechheit gehabt hatte, sich über den Eigensinn unseres Gärtners zu beklagen, und ich verspürte nicht übel Lust, in andern Ausdrücken als denen meiner Herrin fortzufahren. Dieses Mal jedoch behielt mein Christenthum die Oberhand. Ich fuhr ohne Weiteres in dem Vortrage von Myladys Brief fort:
»Nachdem ich also in der Weise, wie der Polizeibeamte es für wünschenswerth bezeichnet, an das Gewissen meiner Tochter appellirt hatte, sprach ich demnächst mit ihr, wie meine Ueberzeugung es mir eingab, Eindruck auf sie zu machen. Noch bevor meine Tochter mein Haus verlassen, hatte ich sie bei zwei verschiedenen Gelegenheiten im Vertrauen darauf aufmerksam gemacht, daß sie sich dem unleidlichsten und erniedrigendsten Verdacht aussetze Ich habe ihr jetzt in den bestimmtesten Ausdrücken erklärt, daß meine Befürchtungen eingetroffen sind.
Ihre mit der feierlichsten Versicherung der Wahrheit hierauf gegebene Antwort ist so klar wie möglich. Erstens ist sie keinem Menschen in der Welt im Geheimen Geld schuldig, zweitens ist der Diamant augenblicklich nicht in ihrem Besitz und ist es, seit sie ihn am Mittwoch Abend in ihr Schränkchen legte, keinen Augenblick gewesen.
Weiter gehen die vertraulichen Mittheilungen meiner Tochter nicht. Meiner Frage, ob sie das Verschwinden des Diamanten zu erklären im Stande sei, setzt sie ein hartnäckiges Schweigen entgegen. Die Gewährung meiner dringenden Bitte, sich um meinetwillen auszusprechen, lehnt sie unter Thränen ab. »»Der Tag wird kommen, wo Du erfahren wirst, warum ich den Verdacht unbekümmert auf mir lasten lasse und warum ich selbst Dir gegenüber schweige. Ich habe vieles gethan, wofür ich das Mitleid meiner Mutter verdiene, nichts, dessentwegen sie für mich zu erröthen brauchte.« Das sind die Worte meiner Tochter.
Nach dem, was zwischen dem Polizeibeamten und mir vorgegangen ist, wünsche ich, daß er, obgleich ein Fremder, so gut wie Sie von den Erklärungen Fräulein Verinder’s in Kenntnis; gesetzt werde. Lesen Sie ihm diesen Brief vor und händigen ihm dann die einliegende Anweisung ein. Indem ich auf jeden ferneren Anspruch auf seine Dienste verzichte, habe ich nur noch hinzuzufügen, daß ich von seiner Redlichkeit und seiner Einsicht überzeugt, aber mehr als je davon durchdrungen bin, daß die Umstände ihn in dem vorliegenden Falle in Verhängnißvoller Weise irre geleitet haben.«
Damit schloß der Brief. Bevor ich Sergeant Cuff die Anweisung überreichte, fragte ich ihn. ob er noch irgend etwas zu bemerken habe.
»Es gehört nicht zu meinen Berufspflichten, Herr Betteredge,« antwortete er, »Bemerkungen über einen Fall zu machen, mit dem ich nichts mehr zu thun habe.«
Ich warf ihm die Anweisung über den Tisch zu. »Glauben Sie denn an diesen Theil von Mylady’s Brief?« rief ich empört aus.
Der Sergeant sah die Anweisung an und zog seine bösen Augenbrauen zum Zeichen der Anerkennung von Mylady’s Liberalität in die Höhe.
»Diese Anweisung,« sagte er, »bekundet eine so generöse Schätzung des Werths meiner Zeit, daß ich mich zur Dankbarkeit verpflichtet fühle. Ich werde mich im rechten Augenblicke des Betrages dieser Anweisung zu erinnern wissen, »Herr Betteredge.«
»Was wollen Sie damit sagen?« fragte ich.
Mylady hat die Sache für den Augenblick sehr geschickt beigelegt,« erwiderte der Sergeant. »Aber diese Familiengeschichte gehört zu denen, die plötzlich wieder ausbrechen, wenn man es am wenigsten erwartet. Es wird noch viel Arbeit für die geheime Polizei in dieser Mondstein-Angelegenheit geben, mein lieber Herr Betteredge, bevor viele Monate in’s Land gegangen sind.«
Wenn diese Worte und die Art, wie er sie sprach, irgend eine Bedeutung hatten, so konnte es nur diese sein: Der Brief meiner Herrin hatte bei ihm die Ueberzeugung hervorgerufen, daß Fräulein Rachel verhärtet genug sei, den stärksten Berufungen an ihr Gewissen und an ihr Herz zu widerstehen und daß sie ihre eigene Mutter —— guter Gott! unter welchen Umständen! —— mit einer Reihe von abscheulichen Lügen hintergangen habe. Ich weiß nicht, was andere Leute an meiner Stelle dem Sergeanten erwiedert haben würden. Ich antwortete ihm mit folgenden einfachen Worten:
»Sergeant Cuff, ich betrachte Ihre letzte Bemerkung als eine Insulte gegen Mylady und ihre Tochter.«
»Betrachten Sie sie lieber als eine Warnung für sich selbst, Herr Betteredge, und Sie werden der Wahrheit näher kommen.«
Aufgeregt und zornig, wie ich war, schloß mir die höllische Vertraulichkeit, mit welcher er diese Worte sprach, den Mund.
Ich trat an’s Fenster, um etwas Fassung zu gewinnen. Der Regen hatte nachgelassen und im Hofe stand —« Niemand anders, als der Gärtner Herr Begbie, der draußen auf die Fortsetzung des Disputs über die wilde Rose mit Herrn Cuff wartete.
»Meine Empfehlungen an den »Sergeanten,« sagte Herr Begbie zu mir, sobald er meiner ansichtig wurde; wenn er etwa zu Fuß nach der Station geht, so bin ich gern bereit, ihn zu begleiten.«
»Was!« rief der Sergeant hinter mir, »sind Sie noch nicht überzeugt?«
»Den Teufel auch, überzeugt!» antwortete Herr Begbie.
»Nun, so will ich zu Fuß nach der Station gehen!« erwiderte der Sergeant.
»Wir wollen uns beim Pförtnerhause treffen,« entgegnete Herr Begbie.
Der Leser weiß, wie zornig ich noch eben gewesen war —— aber da bleibe mal Einer zornig, wenn er so unterbrochen wird. Sergeant Cuff bemerkte alsbald die Veränderung in meiner Stimmung und verbesserte sie noch durch ein Wort zu rechter Zeit. »Kommen Sie! kommen Sie!« sagte er, »warum wollen Sie meine Ansicht über den Fall anders behandeln. als Mylady es thut? Warum wollen Sie nicht mit ihr annehmen, daß die Umstände mich in verhängnißvoller Weise irre geleitet haben?«
Alles eben so behandeln zu dürfen, wie Mylady, war ein Privilegium, das mir selbst um den Preis einer Nachgiebigkeit gegen Sergeant Cuff nicht zu theuer erkauft schien. Ich kühlte mich langsam bis zu meiner gewöhnlichen Temperatur ab. Ich betrachtete jede andere als Mylady’s oder meine eigene Ansicht über Fräulein Rachel mit gründlicher Verachtung Das einzige, was ich nicht über mich vermochte, war, den Gegenstand des Mondsteins ganz fallen zu lassen! Mein eigener gesunder Menschenverstand hätte mich mahnen sollen, die Sache auf sich beruhen zu lassen; das weiß ich recht gut —— aber die Tugenden der heutigen Generation waren zu meiner Zeit noch nicht erfunden. Sergeant Cuff hatte einen wunden Punkt bei mir berührt, und so tief ich ihn auch verachtete, der wunde Punkt schmerzte doch. Das Ende vom Liede war, daß ich auf Umwegen das Gespräch wieder auf Mylady’s Brief zu bringen wußte. »Ich für meine Person finde mich durch Mylady’s Brief vollkommen befriedigt,« sagte ich; »aber gleichviel! Fahren Sie fort, als ob es noch möglich wäre, mich von der Richtigkeit Ihrer Ansicht zu überzeugen. Sie sind der Meinung, daß man Fräulein Rachel nicht aufs Wort glauben dürfe und behaupten, wir würden noch von dem Mondstein zu hören bekommen. Begründen Sie Ihre Ansicht, Sergeant!« warf ich zum Schluß leicht hin, »begründen Sie Ihre Ansicht!«
Statt sich gekränkt zu fühlen, ergriff Sergeant Cuff meine Hand und schüttelte sie, daß mir die Finger weh thaten.
»Ich betheuere vor Gott,« sagte dieser sonderbare Beamte feierlich, »ich würde morgenden Tages eine Stelle als Diener in einem Hause annehmen, wenn ich hoffen könnte, an Ihrer Seite zu leben, Herr Betteredge Wenn man sagen wollte, daß Sie so harmlos sind, wie ein Kind, so würde man damit den Kindern ein Compliment machen, welches die wenigsten von ihnen verdienen. Nein, nein! Wir wollen unseren Streit nicht wieder aufnehmen. Sie sollen es leichter von mir erfahren, als Sie denken. ich möchte kein Wort mehr über Mylady oder Fräulein Verinder sagen, aber um Ihretwillen kann ich ja wohl schon einmal eine Prophezeihung wagen. Ich habe Ihnen schon gesagt, daß Sie mit dem Mondstein noch nicht fertig sind. Jetzt will ich Ihnen zum Abschied noch drei Dinge nennen, welche sich künftig ereignen werden und die sich, wie ich glaube, Sie mögen es wollen oder nicht, Ihrer Aufmerksamkeit aufdrängen werden.»
»Fahren Sie fort!« sagte ich, nicht im mindesten erschrocken und so leichten Muthes wie je.
»Erstens,« sagte der Sergeant, »werden Sie etwas von den Yollands hören, wenn der Postbote Rosanna’s Brief nächsten Montag in Cobb’s Hole abgegeben haben wird.«
Bei diesen Worten ward mir zu Muthe, als ob er mich mit einem Eimer kalten Wassers übergösse Fräulein Rachel’s Versicherung ihrer Unschuld hatte ja Rosanna’s Benehmen, ihre Anfertigung eines neuen, das Verstecken des alten befleckten Nachthemdes und alles übrige, was sie gethan hatte, noch völlig unerklärt gelassen.
»Zweitens,« fuhr der Sergeant fort, »werden Sie wieder von den drei Indiern hören, und zwar von ihrem Erscheinen in der Nachbarschaft, wenn Fräulein Rachel hier in der Gegend bleibt; oder von ihrem Auftreten in London, wenn Fräulein Rachel dorthin geht.«
Da ich alles Interesse an den drei Jongleurs verloren hatte und mich von der Unschuld meines jungen Fräuleins fest überzeugt hielt, so nahm ich diese zweite Prophezeihung sehr leicht. »Das wären also zwei von den drei Dingen, die passiren sollen,« sagte ich. »Und nun das dritte?«
»Drittens und letztens,« sagte Sergeant Cuff, »werden Sie früher oder später etwas von jenem Geldverleiher in London hören, den ich mir bereits zweimal zu erwähnen erlaubt habe. Geben Sie mir Ihre Brieftasche und ich will Ihnen seinen Namen und seine Adresse notiren, so daß kein Mißverständniß entstehen kann, wenn meine Prophezeihung eintrifft.«
Er schrieb demgemäß auf ein weißes Blatt meiner Brieftasche »Herr Septimus Luker, Middleser-Place, Lambeth, London.«
»Das,« sagte er, indem er auf die Adresse deutete, »sind die letzten Worte in Betreff des Mondsteins, mit denen ich Sie für jetzt behelligen werde. Die Zeit wird lehren, ob ich Recht oder Unrecht habe. Inzwischen nehme ich für Sie, mein lieber Herr Betteredge, eine aufrichtige persönliche Neigung mit hinweg, welche, glaube ich, uns beide gleich sehr ehrt. Sollten wir uns nicht wieder sehen, bevor ich mich von den Geschäften zurückziehe, so rechne ich auf Ihren Besuch in einem kleinen Hause in der Nähe von London, auf das ich mein Auge gerichtet habe. Da sollen Sie Graswege in meinem Garten finden, Herr Betteredge, das verspreche ich Ihnen. Und was die weiße Moosrose betrifft ——«
»Den Kukuk auch, Sie sollen es wohl bleiben lassen, weiße Moosrosen zu ziehen, wenn Sie sie nicht auf die wilde Rose pfropfen!« rief eine Stimme zum Fenster hinein.
Wir drehten uns Beide um. Da stand der unverwüstliche Herr Begbie, der es vor ungeduldigem Verlangen nach der Fortsetzung des Disputs nicht länger an der Eingangspforte hatte aushalten können. Der Sergeant drückte mir die Hand und schoß noch ungeduldiger als der Gärtner pfeilschnell zum Zimmer hinaus.
»Fragen Sie ihn nach der Moosrose, wenn er zurückkommt und sehen Sie zu, ob ich ihn nicht aus seinen jetzigen Verschanzungen herausgetrieben habe!« rief der große Cuff mir jetzt zum Abschied in’s Fenster hinein.
»Meine Herren« sagte ich, indem ich ihren Eifer zu mäßigen suchte, wie ich es schon einmal gethan hatte, »Über die Moosrosenfrage läßt sich für beide Ansichten Vieles sagen.« Ich hätte eben so gut mit einem Stein reden können. Im hitzigsten Gefecht über die Rosen, in dem auf beiden Seiten kein Pardon erbeten und keiner gegeben wurde, gingen sie davon. Das Letzte, was ich von ihnen sah, war, daß Herr Begbie seinen eigensinnigen Kopf schüttelte und daß Sergeant Cuff ihn am Arm gefaßt hielt, als ob er sein Gefangener wäre. Ja, ja! ich muß gestehen, ich konnte mich, trotz meines Hasses gegen den Sergeanten, doch einer Neigung zu ihm nicht erwehren.
Mag sich der Leser diesen Widerspruch erklären wie er kann. Er wird mich mit samt seinen Widersprüchen bald los werden. Wenn ich nun noch über Herrn Franklin’s Abreise erzählt habe, würde ich mit meinem Bericht über die Ereignisse des Sonnabend zu Ende sein. Und wenn ich demnächst verschiedene merkwürdige Dinge erzählt haben werde, welche sich im Laufe der kommenden Woche zutragen, so wird der von mir übernommene Theil der Geschichte erledigt sein und ich werde meine Feder derjenigen Person überreichen, die nach mir an die Reihe kommt. Wenn meine Leser des Lesens dieser Geschichte so überdrüssig sind, wie ich des Schreibens derselben, du lieber Gott! wie froh werden wir bald beide sein!

Zwanzigstes Capitel.
Ich hatte den Ponywagen für den Fall angespannt gelassen, daß Herr Franklin darauf bestehen sollte, uns noch diesen Abend mit dem Nachtzug zu verlassen. Das Erscheinen des Gepäcks, dem Herr Franklin selbst auf dem Fuße folgte, machte es unzweifelhaft für mich, daß er sich vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben an seinem einmal gefaßten Beschluß festgehalten habe.
So sind Sie wirklich entschlossen, Herr Franklin?« sagte ich, als wir uns in der Halle trafen. »Warum warten Sie nicht noch ein Paar Tage und geben Fräulein Rachel noch eine Chance?«
Der ausländische Firniß schien, wo jetzt der Moment des Abschieds gekommen war, ganz von Herrn Franklin gewichen zu sein. Er überreichte mir, statt auf meine Frage zu antworten, schweigend den Brief, den er von Mylady erhalten hatte. Der größte Theil desselben wiederholte nur das, was auch in meinem Briefe stand. Am Schluß aber fand sich eine Stelle in Betreff Fräulein Rachel’s, welche, wenn nichts anders, doch Herrn Franklins festes Beharren auf seinem Entschluß genügend erklären wird.
»Es wird Dich ohne Zweifel befremden (hieß es in dem Brief Mylady’s), daß ich es mir von meiner eigenen Tochter gefallen lasse, vollständig im Dunkel gehalten zu werden. Ein 20,000 Pfund St. werther Diamant ist verloren gegangen und ich bin zu der Annahme berechtigt, daß das Geheimniß seines Verschwindens kein Geheimniß für Rachel ist und daß ihr eine unerklärliche Verpflichtung gegen eine Person oder gewisse Personen, die mir völlig unbekannt ist oder sind, zu einem Zweck, über den ich nicht einmal eine Vermuthung zu hegen im Stande bin, Schweigen auferlegt. Scheint es nicht unbegreiflich, daß ich es mir gefallen lasse, in einer so geringschätzigen Weise behandelt zu werden? Es ist, aber in der That, wenn man Rachel’s gegenwärtigen Gemüthszustand berücksichtigt, vollkommen begreiflich. Sie ist in einem wahrhaft jammervollen Zustand nervöser Aufregung. Ich darf den Gegenstand des Mondsteins auch nicht von fern wieder berühren, bis die Zeit das Ihrige gethan haben wird, sie zu beruhigen. Um dazu beizutragen, habe ich keinen Anstand genommen, den Polizeibeamten zu entlassen. Das Geheimniß, welches uns in Verwirrung setzt, ist ihm nicht weniger räthselhaft. Hier liegt kein Fall vor, in welchem irgend ein Fremder uns helfen könnte. Seine Anwesenheit vermehrt nur meine Bedrängnisse und die bloße Nennung seines Namens macht Rachel rasen.
»Meine Pläne für die Zukunft sind so bestimmt wie es möglich ist. Zunächst beabsichtige ich mit Rachel nach London zu gehen, theils um sie durch einen vollständigen Wechsel ihrer Umgebung zu zerstreuen, theils um zu sehen, was der beste ärztliche Rath vermag. Kann ich Dich unter diesen Umständen auffordern, uns in London zu besuchen? Mein lieber Franklin, Du mußt Dir ein Beispiel an meiner Geduld nehmen und —— wie ich —— bessere Zeiten abwarten. Den schätzbaren Beistand, den Du bei der Untersuchung nach dem Verlust des Diamanten geleistet hast, betrachtet Rachel in ihrem gegenwärtigen traurigen Gemüthszustand als eine Beleidigung, die sie nicht verzeihen kann. Dadurch, daß Du Dich blindlings in diese Sache gemischt und sie durch Deine Bemühungen unabsichtlich mit der Entdeckung ihres Geheimnisses bedroht hast, hast Du nach ihrer Auffassung die aus ihr lastende Angst nur noch vermehrt. Ich bin weit entfernt, die Begriffsverwirrung entschuldigen zu wollen, welche Dich für Folgen verantwortlich machen will, die weder Du noch wir uns vorstellen oder vorhersehen konnten. Aber es läßt sich nicht mit ihr raisonniren, man kann sie nur bemitleiden. Mit schwerem Herzen spreche ich es aus, aber für jetzt bleiben Du und Rachel besser getrennt. Der einzige Rath, den ich Dir geben kann, ist, ihr Zeit zu lassen.«
Ich gab Herrn Franklin den Brief mit aufrichtigem Bedauern zurück, denn ich wußte, wie sehr er mein junges Fräulein liebte, und ich sah, daß der Bericht ihrer Mutter über sie ihn in’s Herz getroffen hatte.
»Sie kennen das Sprichwort, Herr Franklin,« da war Alles, was ich ihm sagte, »wenn die Noth am höchsten, so ist die Hilfe am nächsten. Viel höher als jetzt, Herr Franklin, kann die Noth nicht steigen.«
Herr Franklin faltete den Brief seiner Tante wieder zusammen, anscheinend ohne aus meinem Zuspruch viel Trost zu schöpfen.
»Als ich mit dem unseligen Diamanten hierher kam,« sagte er, »gab es, glaube ich, in ganz England kein glücklicheres Haus als dieses. Und wie sieht es jetzt in diesem Hause aus! Alles zerstreut, uneinig, Alles bis auf die Luft, die hier weht, mit dem Giftstoff des Geheimnisses und des Verdachtes getränkt! Erinnern Sie sich jenes Morgens am Zitterstrand, als wir uns über meinen Onkel Herncastle und sein Geburtstagsgeschenk unterhielten? Der Mondstein hat die Rachepläne des Obersten auf Wegen gefördert, Betteredge von denen der Oberst selbst nie geträumt hatte.«
Mit diesen Worten schüttelte er mir die Hand und ging hinaus an den Ponywagen.
Ich folgte ihm die Treppe hinunter. Es. war ein trauriger Anblick, ihn das alte Haus, in welchem er die glücklichsten Jahre seines Lebens zugebracht hatte, so verlassen zu sehen. Penelope, die durch alles Vorgefallene ganz unglücklich war, kam weinend herbei, um ihm Lebewohl zu sagen. Herr Franklin küßte sie. Ich winkte ihm mit der Hand ein herzliches Lebewohl zu. Auch einige von den andern weiblichen Dienstboten kamen zum Vorschein und blickten um die Ecke, um ihm nachzusehen. Er war einer von den Männern, denen die Frauen alle gut sind. Noch im letzten Augenblick hielt ich den Wagen zurück und bat ihn, uns von sich hören zu lassen. Er schien von meinen Worten keine Notiz zu nehmen, blickte umher und betrachtete alle Gegenstände, als ob er von dem alten Hause und Park für immer Abschied nehmen wolle.
»Bitte, sagen Sie uns, wohin Sie gehen,« sagte ich, noch immer am Wagen stehend, und versuchte es, auf diese Weise hinter seine künftigen Pläne zu kommen. Herr Franklin zog plötzlich den Hut über die Augen. »Wohin ich gehe?« sagte er, mir das Wort nachsprechend. »Ich gehe zum Teufel!« Bei diesen Worten lief das Pony davon, als ob ihm dieselben einen christlichen Schauder eingeflößt hätten. »Gott segne Sie, Herr Franklin, wohin Sie auch gehen mögen!« war Alles, was´ich noch Zeit hatte zu sagen, bevor er uns aus dem Gesicht gekommen war. Ein lieber und freundlicher Herr! Mit allen seinen Fehlern und Thorheiten ein lieber und freundlicher Herr! Er ließ eine große Lücke in Mylady’s Haus zurück. Es war still und traurig bei uns geworden, als der lange Sommerabend an jenem Sonnabend seinem Ende entgegenging.
Um meine sinkenden Lebensgeister aufzufrischen, nahm ich meine Zuflucht zu meiner Pfeife und zu meinem Robinson Crusoe. Die Frauenzimmer, mit Ausnahme Penelope’s, vertrieben sich die Zeit damit, über Rosanna’s Selbstmord zu reden. Sie beharrten Alle beider Ansicht, daß das arme Mädchen den Diamanten gestohlen und sich selbst, aus Furcht entdeckt zu werden, den Tod gegeben habe. Meine Tochter hielt natürlich in ihrem Sinn an Dem fest, was sie immer behauptet hatte. Ihre Auffassung von dem wirklichen Motiv des Selbstmords ließ, sonderbar genug, dieselbe Lücke unausgefüllt, über welche auch die Unschuldsbetheuerung meines jungen Fräuleins keinen Aufschluß gab. Beide ließen Rosanna’s geheime Reise nach Frizinghall und Rosanna’s Vornehmen in Betreff des Nachthemds völlig unaufgeklärt Aber es half nichts, Penelope darauf hinzuweisen; der Einwand machte ungefähr so viel Eindruck auf sie, wie ein Regenschauer auf einen wasserdichten Rock. Meine Tochter hat nämlich meine Unempfänglichkeit für Vernunftgründe geerbt und hat es in dieser Beziehung noch viel weiter gebracht, als ihr Vater.
Am nächsten Tage (Sonntag) kehrte der geschlossene Wagen, der bis jetzt bei Herrn Ablewhite in Frizinghall geblieben war, leer zu uns zurück. Der Kutscher überbrachte eine Bestellung für mich und geschriebene Instructionen für Mylady’s Kammermädchen und für Penelope.
Die Bestellung an mich lautete dahin, daß meine Herrin beschlossen habe, am nächsten Montag mit Fräulein Rachel nach London zu gehen und dort ihr Haus zu beziehen. Die geschriebenen Instructionen wiesen die Mädchen an, sich in Begleitung der näher angegebenen Garderobe ihrer Herrinnen zu einer bestimmten Stunde in London einzufinden. Von den übrigen Dienstboten sollten die meisten folgen. Mylady hatte Fräulein Rachel nach dem, was auf dem Landsitz vorgefallen war, so abgeneigt gefunden, dahin zurückzukehren, daß sie beschlossen habe, direct von Frizinghall nach London zu gehen; ich sollte bis auf weitere Ordre aus dem Gute bleiben, um Alles in und außer dem Hause zu überwachen. Die mit mir zurückbleibenden Dienstboten sollten Kostgeld erhalten.
Alles das erinnerte mich an die Worte des Herrn Franklin, daß hier jetzt Alles zerstreut und uneinig sei und führte meine Gedanken aus sehr natürlichem Wege zu Herrn Franklin selbst zurück. Je mehr ich an ihn dachte, desto unbehaglicher fühlte ich mich bei dem Gedanken an seine Zukunft. Das Ergebniß meiner Betrachtungen war, daß ich mit der Sonntagspost an den Kammerdiener seines Vaters, Herrn Jeffco, den ich in früheren Jahren in London gekannt hatte, schrieb und ihn bat, mich wissen zu lassen, was Herr Franklin bei seiner Ankunft in London zu thun beschlossen habe.
Der Sonntag-Abend war womöglich noch trübseliger, als es der Sonnabend-Abend gewesen war. Wir beschlossen den Ruhetag, wie Hunderttausende auf den britischen Inseln ihn regelmäßig beschließen, d. h. wir gingen vorzeitig zur Ruhe, indem wir Alle auf unsern Stühlen einschliefen. Was die Andern im Hause am nächsten Montag empfanden, weiß ich nicht, für mich brachte dieser Tag eine große Erschütterung. Die erste von Sergeant Cuffs Prophezeihungen der künftigen Dinge, nämlich daß ich von den Yollands hören werde, traf an diesem Tage an.
Ich hatte Penelope und Mylady’s Kammermädchen, mit dem Gepäck für London auf die Eisenbahn gebracht und schlenderte eben im Garten umher, als ich meinen Namen rufen hörte. Als ich mich umdrehte, stand ich der Tochter des Fischer, der hinkenden Lucy, gegenüber. Wenn man von ihrem lahmen Fuß und ihrer Magerkeit —— dieser bei Frauen nach meiner Ansicht sehr großen Schattenseite —— absah, so hatte das Mädchen einige für Männer angenehme Eigenschaften. Ein dunkles, ausdrucksvolles, intelligentes Gesicht, eine hübsche klare Stimme und schönes braunes Haar zählten zu ihren Vorzügen. Zu ihren Mängeln zählte noch eine Krücke, ihre unangenehmste Seite aber war ihr Temperament.
»Nun, mein Kind,« fragte ich, »was willst Du von mir?«
»Wo ist der Mann, den Ihr Franklin Blake nennt?« fragte das Mädchen, indem sie einen wilden Blick auf mich heftete und sich dabei auf ihre Krücke lehnte.
»Spricht man so von einem Herrn?« fragte ich. »Wenn Du Dich nach Mylady’s Neffen erkundigen willst, so sei so gut, ihn Herr Franklin Blake zu nennen.«
Sie hinkte mir einen Schritt näher und sah mich an, als ob sie mich mit Haut und Haaren auffressen wollte. »Herr Franklin Blake,« sprach sie mir nach, »Mörder Franklin Blake würde ein passenderer Name für ihn sein.«
Meine bei meiner Seligen geübte Praxis kam mir hier zu statten. Wenn ein Frauenzimmer es versucht uns außer Fassung zu bringen, so muß man den Spieß umkehren und sie außer Fassung bringen. Die Frauenzimmer sind gewöhnlich auf alle Mittel der Abwehr gegen ihre Angriffe vorbereitet, nur nicht auf dieses. Bringt man aber dieses Mittel im rechten Augenblick zur Anwendung, so richtet man mit einem Wort so viel aus wie sonst mit hunderten, und so war es in diesem Fall mit der hinkenden Lucy. Ich sah sie freundlich an und sagte: »Pah!«
Auf der Stelle stand das Mädchen in Feuer und Flammen. Sie stellte sich fest auf ihren gesunden Fuß und stieß mit ihrer Krücke wüthend drei Mal auf den Boden. »Er ist ein Mörder! ein Mörder! ein Mörder!
Er ist Schuld an dem Tode Rosanna Spearman’s!« Sie schrie diese Worte im höchsten Diskant. Einige von den Leuten, die nahe bei uns im Garten arbeiteten, blickten auf; sahen, daß es die hinkende Lucy war; wußten, wessen man sich von der zu versehen habe und fuhren ruhig in ihrer Arbeit fort.
»Er ist Schuld an dem Tode Rosanna Spearman’s?« wiederholte ich; »wie kommst Du darauf, das zu behaupten, Lucy?«
»Was fragen Sie darnach? Wer fragt überhaupt etwas darnach? O, wenn sie nur über die Männer gedacht hätte, wie ich, so lebte sie vielleicht noch heute.«
»Sie war immer dankbar gegen mich, das arme Kind!« sagte ich, »und ich habe mir immer die redlichste Mühe gegeben, sie freundlich zu behandeln.«
Ich sagte diese Worte in einem möglichst tröstenden Ton. In Wahrheit hatte ich nicht den Muth das Mädchen durch fernere scharfe Antworten noch mehr zu reizen. Anfänglich war mir nur ihr heftiges Temperament aufgefallen; jetzt machte sich ihre Armseligkeit bemerklich, und Armseligkeit ist beim Menschen niederen Standes nicht selten mit Insolenz verbunden. Meine Antwort brachte eine mildernde Wirkung auf die hinkende Lucy hervor. Sie senkte den Kopf und stützte denselben auf ihre Krücke.
»Ich habe sie geliebt,« sagte das Mädchen sanft; »sie hat ein elendes Leben gelebt, Herr Betteredge; schlechte Menschen hatten sie mißhandelt und auf schlechte Wege geführt, aber ihr gutes Gemüth hatten sie nicht verderben können. Sie war ein Engel. Sie hätte glücklich mit mir sein können. Ich hatte einen Plan gemacht, wie wir zusammen wie Schwestern nach London gehen und dort von unserer Hände Arbeit leben wollten; aber da kam der Mann daher und verdarb Alles. Er hat es ihr angethan. Sagen Sie mir nicht, daß es nicht seine Absicht war und daß er es nicht wußte; er hätte es wissen, er hätte Mitleid mit ihr haben müssen. »Ich kann nicht ohne ihn leben —— und, o Lucy, er sieht mich nie auch nur an!« Das waren ihre Worte. Schändlich! Schändlich! Ich sagte ihr: »Kein Mann ist Werth, daß man sich um ihn härmt.« Und sie antwortete: »Es giebt Männer, die werth sind, daß man sein Leben für sie hingiebt —— und er ist einer von diesen Männern.« Ich hatte mir ein bischen Geld erspart. Ich hatte mit Vater und Mutter Alles in Ordnung gebracht. Ich wollte sie den Kränkungen, die sie hier zu erdulden hatte, entziehen. Wir hätten uns eine kleine Wohnung in London genommen und wie Schwestern zusammen gelebt. Sie hatte, wie Sie wissen, Herr, eine gute Erziehung erhalten und schrieb eine gute Hand. Sie war geschickt mit der Nadel. Ich habe auch eine gute Erziehung genossen und schreibe auch eine Hand. Ich bin zwar nicht so geschickt mit der Nadel wie sie es war, aber es hätte doch hingereicht. Wir hätten uns unseren Lebensunterhalt ganz gut verdienen können. Und nun, was geschieht diesen Morgen? O, was geschieht diesen Morgen? Ihr Brief kommt und sagt mir, daß sie die Last ihres Lebens von sich geworfen hat. Ihr Brief kommt und sagt mir Lebewohl für immer. Wo ist er?« rief das Mädchen, ihren Kopf von der Krücke erhebend und abermals mit thränenden Augen aufflamment. »Wo ist dieser Herr, von dem ich nun so respectvoll reden soll? Ha! Herr Betteredge, der Tag ist nicht fern, wo die Armen gegen die Reichen aufstehen werden. Wollte Gott, sie machten mit ihm den Anfang!«
Das war wieder so eine von den gewöhnlichen guten Christinnen, und das war wieder so ein Fall, wo das gute Christenthum nicht vorhält, wenn es auf eine zu harte Probe gestellt wird. Der Pfarrer selbst —— und das will viel sagen —— hätte mit dem Mädchen in ihrem gegenwärtigen Zustand nicht viel anfangen können. Alles was ich zu thun wagte, war, daß ich versuchte, sie bei der Stange zu halten, in der Hoffnung, daß dabei vielleicht etwas herauskommen würde, was für mich zu hören der Mühe werth wäre.
»Was willst Du von Herrn Franklin Blake?« fragte ich.
»Ich will ihn sehen.«
»Aus einem besonderen Grunde?«
»Ich habe ihm einen Brief abzugeben.«
»Von Rosanna Spearman?«
»Ja!«
»Der, in dem an Dich gerichteten Brief einlag?«
»Ja!«
Sollte sich hier eine Möglichkeit zeigen, das Dunkel aufzuhellen? Sollten sich mir alle die Entdeckungen, die ich zu machen verzweifelte, hier auf einmal von selbst darbieten? Ich mußte mich einen Augenblick fassen.
Ich spürte wieder die ansteckende Nachwirkung von Sergeant Cuff’s Gesellschaft. Gewisse Symptome die ich an mir selbst beobachtete, mahnten mich, daß das Entdeckungsfieber mich wieder zu ergreifen anfing.
»Du kannst Herrn Franklin nicht sehen,« sagte ich.
»Ich muß und will ihn sehen.«
»Er ist gestern Abend nach London gereist.«
Die hinkende Lucy blickte mir scharf in’s Gesicht und sah, daß ich die Wahrheit sagte. Ohne ein Wort weiter zu sagen, drehte sie sich um und ging ihres Weges in der Richtung nach Cobb’s Hole zu.
»Halt!« sagte ich, »ich erwarte Morgen Nachrichten von Herrn Franklin Blake. Gieb mir Deinen Brief und ich will ihn ihm durch die Post zugehen lassen.«
Die hinkende Lucy stützte sich wieder auf ihre Krücke und blickte sich über die Schulter nach mir um.
»Ich muß ihn selbst in seine Hände geben,« sagte sie, »und darf ihn ihm auf keine andere Weise zukommen lassen.«
»Soll ich ihm schreiben, was Du gesagt hast?«
»Schreiben Sie ihm, daß ich ihn hasse, dann haben Sie ihm die Wahrheit geschrieben.«
»Ja, ja! aber ich meine wegen des Briefes.«
»Wenn er den Brief haben will, muß er wieder hierherkommen und sich ihn von mir geben lassen.«
Mit diesen Worten hinkte sie ihres Weges nach Cobb’s Hole weiter. Das Entdeckungsfieber hatte auf der Stelle bei mir alles Gefühl meiner persönlichen Würde aufgezehrt. Ich ging ihr nach und versuchte sie wieder zum Sprechen zu bringen. Alles vergebens. Es war mein Unglück, daß ich ein Mann war, und daß die hinkende Lucy sich daher freute, mir etwas zuwider thun zu können. Im Laufe des Tages versuchte ich noch mein Glück bei ihrer Mutter. Aber die gute Frau Yolland konnte nichts weiter als weinen und mir einen Schluck Trost aus der Geneverflasche empfehlen. Ich fand den Fischer selbst am Strande, Er flickte sein Netz und rief mir zu: »Das ist eine schlimme Geschichte.« Weder Vater noch Mutter wußten mehr von der Sache als ich. Die einzige Chance, die mir noch zu versuchen übrig blieb, war die Möglichkeit, an Herrn Franklin Blake zu schreiben.
Ich überlasse es dem Leser, sich die Ungeduld auszumalen, mit der ich am Dienstagmorgen den Postboten erwartete. Er brachte mir zwei Briefe. Der eine von Penelope, den ich mir zu lesen kaum Zeit ließ, meldete, daß Mylady und Fräulein Rachel gesund in London angekommen seien und sich dort in ihrem Hause eingerichtet hätten. Der andere von Herrn Jeffco benachrichtigte mich, daß der Sohn seines Herrn England bereits verlassen habe.
Nach seinem Eintreffen hatte sich Herr Franklin, wie es schien, direct nach dem Hause seines Vaters begeben. Er kam zu keiner günstigen Zeit. Herr Blake sen. war bis über die Ohren mit den Angelegenheiten des Hauses der Gemeinen beschäftigt und spielte gerade an jenem Abend zu Hause mit dem parlamentarischen Lieblingsspielzeug, das man eine »private-bill« nennt. Herr Jeffco selbst führte Herrn Franklin in das Arbeitszimmer seines Vaters.
»Aber lieber Franklin! warum überraschest Du mich auf diese Weise? Ist Dir etwas passirt?«
»Jawohl ist mir etwas passirt; mit Fräulein Rachel, was mich aufs Tiefste bekümmert.«
»Thut mir sehr leid. Aber ich habe jetzt keine Zeit, Dich anzuhören?«
»Wann kannst Du mich denn anhören?«
»Mein lieber Junge! Ich möchte Dich nicht unnütz hinhalten. Ich kann Dich anhören, wenn die Session vorüber ist, nicht einen Augenblick früher. Gute Nacht!«
»Danke Vater. Gute Nacht!«
»Das war die Unterhaltung im Studirzimmer, wie sie mir Herr Jeffco berichtete. Die Unterhaltung außerhalb des Studirzimmers war noch kürzer.
»Jeffco, bitte, sehen Sie nach, um welche Zeit der Schnellzug nach Dover morgen früh abgeht.«
»6 Uhr 40 Minuten, Herr Franklin.«
»Lassen Sie mich um 5 Uhr wecken.«
»Wollen Sie in’s Ausland verreisen, Herr Franklin?«
»Ja, Jeffco, wohin mich die Eisenbahn bringen will!«
»Soll ich es Ihrem Herrn Vater mittheilen?«
»Jawohl. Theilen Sie es ihm am Ende der Session mit.«
Am nächsten Morgen war Herr Franklin nach dem Continent; das Ziel seiner Reise vermochte Niemand, auch er selbst nicht, anzugeben. Wir mußten darauf gefaßt sein, demnächt von ihm aus Europa, Asien, Afrika und Amerika zu hören. Die Chancen für diese vier Welttheile waren nach Herrn Jeffco’s Ansicht völlig gleich. Diese Nachrichten, die jede Aussicht, die hinkende Lucy und Herrn Franklin zusammenzubringen, für mich verschlossen, thaten zugleich für mich jedem ferneren Fortschritt aus dem Wege der Entdeckung meinerseits Einhalt. Penelope’s Annahme, daß ihre Kameradin sich aus uns erwiderter Liebe für Herrn Franklin den Tod gegeben habe, wurde bestätigt und das war Alles Ob der Brief, welchen Rosanna mit der Weisung hinterlassen hatte, ihm denselben nach ihrem Tode zu übergeben, das Bekenntniß enthielt, welches sie, wie Herr Franklin glaubte, bei ihren Lebzeiten ihm zu machen versucht hatte, war unmöglich zu entscheiden. Vielleicht enthielt der Brief nur ein letztes Lebewohl und das Geständniß ihrer Leidenschaft für einen Mann von Stande. Oder vielleicht enielt er einen Aufschluß über ihre sonderbaren von Sergeant Cuff entdeckten Vornahmen von dem Moment an, wo der Mondstein verloren ging, bis zu dem, wo sie ihrem Tode auf dem Zitterstrande entgegengeeilt war. Versiegelt war der Brief der hinkenden Lucy übergeben worden und versiegelt blieb sein Inhalt für mich und Jedermann, Lucy’s eigne Eltern nicht ausgenommen. Wir Alle hatten sie in Verdacht, die Vertraute der Verstorbenen gewesen zu sein; wir Alle versuchten es, sie zum Reden zu bringen und blieben sämmtlich erfolglos. Einer oder der Andere von den Dienstboten, die noch immer an dem Glauben festhielten, daß Rosanna den Diamanten gestohlen und ihn versteckt habe, guckte und stöberte gelegentlich an dem Felsen herum, bis zu welchem ihre Spur verfolgt worden war und guckte und stöberte vergebens. Die Fluth kam und ging, der Sommer ging vorüber und der Herbst kam und der Zittersand, der ihren Leichnam barg, barg auch ihr Geheimniß.
Die Nachricht von Herrn Franklin’s am Sonntag Morgen erfolgter Abreise von England und die Nachricht von Mylady’s und Fräulein Rachels am Montag Nachmittag erfolgter Ankunft in London, hatte ich, wie der Leser weiß, durch die Dienstags-Post erhalten. Der Mittwoch kam und brachte nichts Neues. Der Donnerstag brachte eine zweite Portion Neuigkeiten von Penelope.
Der Brief meiner Tochter meldete mir, daß ein großer Londoner Arzt wegen des Zustandes ihres jungen Fräuleins consultirt worden sei und eine Guinea mit der Bemerkung verdient habe, daß ihr Zerstreuungen gut thun würden.
Blumen-Ausstellungen, Opern, Bälle und andere Amüsements in Menge standen bevor; und Fräulein Rachel schien zu ihrer Mutter Erstaunen Geschmack an Allem zu finden. Herr Godfrey hatte seinen Versuch gemacht und war augenscheinlich, ungeachtet der Aufnahme, die sein Antrag an jenem Geburtstag gefunden hatte, so beflissen gegen seine Cousine gewesen wie je. Zu Penelope’s Bedauern war er höchst freundlich empfangen worden und hatte Fräulein Rachel’s Namen auf der Stelle an die Spitze eines seiner mildthätigen Unternehmen stellen dürfen. Meine Herrin war nach Penelope’s Bericht sehr trübe gestimmt und hatte zwei lange Conferenzen mit ihrem Advocaten gehabt. Es folgten Betrachtungen über eine arme Verwandte der Familie —— eine gewisse Miß Clack, von der ich in meinem Bericht über das Geburtstags-Diner erzählt habe, daß sie neben Herrn Godfrey saß und sehr gern Champagner trank. Penelope war erstaunt, daß Miß Clack noch keinen Besuch gemacht habe. Es werde gewiß nicht lange dauern, bis sie sich wie gewöhnlich an Mylady drängen werde —— und so weiter, und so weiter in der Weise, wie Frauenzimmer mit der Feder und mit dem Munde über einander zu medisiren pflegen. Des letztgedachten Umstandes thue ich nur aus einem Grunde Erwähnung. Wie ich höre, wird der Leser nach seiner Trennung von mir Miß Clack in die Hände fallen. Wenn dem so ist, so habe ich den Leser nur um die eine Gefälligkeit zu bitten, nicht ein Wort von dem zu glauben, was sie von mir sagt.
Am Freitag ereignete sich wieder nichts, es wäre denn, daß einer der Hunde Spuren eines Ausschlages hinter den Ohren zeigte. Ich gab ihm eine Dosis Kreuzdornsaft und setzte ihn bis auf Weiteres auf eine Diät von Graswasser und Kräutern. Der geneigte Leser wolle entschuldigen, daß ich von so etwas rede. Es ist mir so aus der Feder geflossen. Ich bitte es zu übergehen. ich nähere mich mit raschen Schritten dem Ende meiner Verstöße gegen den seinen, modernen Geschmack. Aber der Hund war ein gutes Thier und verdient eine gute Behandlung.
Der Sonnabend, der letzte Tag der Woche, ist auch der letzte Tag in meiner Erzählung. Die Morgenpost brachte mir eine Ueberraschung in Gestalt einer Londoner Zeitung. Die Handschrift auf der Adresse intriguirte mich. Ich verglich sie mit Namen und Adresse des Geldverleihers, wie sie in meiner Brieftasche standen und erkannte sofort in der Adresse Sergeant Cuff’s Handschrift.
Als ich nach dieser Entdeckung die Zeitung eifrig durchsuchte, fand ich einen Polizeibericht mit Tinte angestrichen. Derselbe lautete, wie folgt. Man lese ihn, wie ich ihn gelesen habe und man wird die höfliche Aufmerksamkeit des Sergeanten, mir die Neuigkeiten des Tages zu schickem zu schätzen wissen.
»Lambeth. —— Kurz vor dem Schluß der Gerichts-Sitzung erbat sich Herr Septimus Luker, der Inhaber einer wohlbekannten Handlung von Gemmem Cameen, Intaglios 2C. 2c., den Rath des Richters Herr Luker gab an, daß er Tage lang zu wiederholten Malen von einigen jener herumtreibenden Indier, welche die Straßen unsicher machen, behelligt worden sei. Die Leute, über die er sich zu beschweren habe, seien drei an der Zahl gewesen. Trotzdem er sie durch die Polizei habe aus dem Hause schaffen lassen, wären sie doch immer wieder gekommen und hätten es versucht, in das Haus zu dringen, angeblich um ein Almosen zu erbitten Von der vorderen Hausthür fortgewiesen, seien sie wieder an der Hinterthür erschienen. Abgesehen von dieser Behelligung, über welche Herr Luker Beschwerde führte, äußerte er die Befugniß, daß es dabei auf einen Raub abgesehen sei. Seine Sammlung enthalte viele seltene und höchst kostbare Gemmen, sowohl aus dem classischen Alterthum wie aus dem Orient. Erst Tags zuvor sei er genöthigt gewesen, einen geschickten Elfenbein-Arbeiter —— einen geborenen Indier, wenn wir recht gehört haben —— auf den Verdacht eines versuchten Diebstahls hin, aus seinem Dienst zu entlassen, und er sei keineswegs sicher, daß dieser Arbeiter und die Straßen-Jongleurs, über die er sich beschwere, nicht unter einer Decke steckten. Er besorge, daß sie vielleicht darauf ausgingen, einen Auflauf in der Straße zu veranlassen und sich während der dadurch verursachten Verwirrung Eingang in das Haus zu verschaffen. Auf die Frage des Richters mußte Herr Luker zugeben, daß er keinen Beweis dafür beibringen könne, daß es wirklich auf einen Raub abgesehen sei. Bestimmt behaupten könne er nur die durch die Indier verursachte Belästigung und Unterbrechung in seiner Arbeit, aber weiter nichts. Der Richter entgegnete, daß, wenn sich die Belästigung wiederholen sollte, Herr Luker die Indier vor dieses Gericht fordern könne, wo nach dem Gesetze mit ihnen werde verfahren werden. Was die Kostbarkeiten in Herrn Luker’s Besitz anlange, so sei es Herrn Luker’s Sache, selbst die zweckmäßigsten Maßregeln zu ihrer Sicherung zu treffen. Er werde vielleicht gut thun, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen und besondere Vorsichtsmaßregeln zu ergreifen, wie sie ihm die Erfahrungen der Polizei an die Hand geben würden. Herr Luker dankte dem Richter und entfernte sich.
Einer der Weisen des Alterthums soll, ich weiß nicht mehr bei welcher Gelegenheit, seinen Mitmenschen empfohlen haben, »das Ende zu bedenken.« Wenn ich das Ende dieser meiner Blätter bedenke und mich erinnere, wie ich noch vor wenigen Tagen nicht wußte, wie ich damit zu Stande kommen solle, so finde ich, daß meine einfache Mittheilung von Thatsachen von selbst zu einem höchst passenden Schluß gelangt. Wir sind in dieser Mondsteingeschichte von einer wunderbaren Ueberraschung zu der andern geführt und schließen nun hier mit der wunderbarsten aller Ueberraschungen, nämlich dem Eintreffen von Sergeant Cuffs drei Prophezeihungen in weniger als einer Woche, nachdem er dieselben ausgesprochen hatte.
Nachdem ich am Montag von den Yollands gehört hatte, war mir nun durch eine Londoner Zeitung auch etwas über die Indier und den Geldverleiher zu Ohren gekommen. Man vergesse nicht, daß Fräulein Rachel selbst sich zu derselben Zeit in London befand. Man sieht, ich gebe die Dinge in ihrer nackten Wahrheit, selbst wenn sie meiner Auffassung gerade in’s Gesicht zu schlagen scheinen. Wenn der Leser auf die vorliegenden Beweise hin sich auf die Seite des Sergeanten stellt und mich im Stich läßt, und wenn er es demgemäß für die einzig rationelle Erklärung der Sache hält, daß Fräulein Rachel und Herr Luker mit einander in Verbindung getreten seien und daß der Mondstein sich jetzt als Pfand im Hause des Geldverleihers befinden müsse: so kann ich in diesem Dunkel, durch das ich den Leser bis jetzt geführt und in welchem ich ihn mit meinen besten Empfehlungen zu lassen genöthigt bin, gegen diese Annahme nichts einwenden.
Wie so genöthigt? wird man vielleicht fragen. Warum führe ich die, welche mir so lange gefolgt sind, nicht in die Regionen höherer Erleuchtung, in welchen ich jetzt selbst weile?
Darauf habe ich nur zu erwidern, daß ich nach bestimmten Instructionen handle und daß mir diese Instructionen im Interesse der Wahrheit ertheilt worden sind.
Ich darf in dieser Erzählung nicht mehr mittheilen, als ich selbst zur Zeit der Begebenheit wußte; oder, um es noch deutlicher zu sagen, ich muß mich streng innerhalb der Grenzen meiner eigenen Erlebnisse halten und darf meinen Lesern nichts von dem berichten, was mir Andere mitgetheilt haben, aus dem sehr einfachen Grunde, daß meine Leser diese Berichte von jenen andern Leuten selbst aus erster Hand erhalten sollen. In dieser Mondsteinangelegenheit sollen nicht bloß Berichte gegeben, sondern wirkliche Zeugen vorgeführt werden. Ich male mir selbst aus, wie ein Mitglied der Familie diese Blätter nach fünfzig Jahren lesen wird. Herr Gott! wie wird es sich geschmeichelt fühlen, daß man ihm nichts auf ein bloßes Hörensagen zu glauben zumuthet, sondern ihn in jeder Beziehung wie einen Richter behandelt.
Hier müssen wir also, nachdem wir eine lange Reise mit einander gemacht haben, beiderseits, hoffe ich, mit freundschaftlichen Gefühlen, für jetzt wenigstens von einander Abschied nehmen. Der Hexentanz des indischen Diamanten ist nach, London verlegt; und nach London hin müssen meine Leser ihm folgen und mich auf dem Lande allein lassen. Sie werden die Fehler dieses Berichts, meine vielen Selbstbetrachtungen und mein, fürchte ich, zu familiäres Wesen gütigst entschuldigen. Ich habe es nicht böse gemeint und trinke, da ich gerade mit meinem Mittagessen fertig bin, mit aller Ehrerbietung einen Krug von Mylady’s Ale auf die Gesundheit und das Gedeihen meiner Leser. Mögen sie in diesen von mir geschriebenen Blättern finden, was Robinsons Crusoe in seinen Erfahrungen auf der wüsten Insel fand, nämlich: »etwas Trost und einen Beitrag zu ihrer Unterscheidung von Gut und Böse, die sie mir bei ihrem Urtheil zu Gute schreiben werden.« Und somit rufe ich ihnen ein herzliches Lebewohl zu.
Ende der ersten Periode.

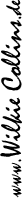
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung
Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung