
Der Mondstein
Zweite Erzählung.
Von Advokat Mathew Bruff.
Erstes Capitel.
Nachdem meine edle Freundin, Miß Clack, die Feder niedergelegt hat, bestimmen mich zwei Gründe, dieselbe nun meinerseits aufzunehmen.
Erstens befinde ich mich in der Lage, über gewisse Punkte von Interesse, welche bis jetzt dunkel geblieben sind, das nöthige Licht zu verbreiten. Fräulein Verinder hatte ihre besonderen Gründe, ihre Verlobung wieder aufzuheben, und diese Gründe waren mir bekannt. Herr Godfrey Ablewhite seinerseits hatte seine besondern Gründe, sich aller Ansprüche auf die Hand seiner reizenden Cousine zu begeben, und ich entdeckte diese Gründe.
Zweitens war ich, ich weiß nicht, ob ich sagen soll so glücklich oder so unglücklich, mich in der Periode, über die ich jetzt berichte, in das Geheimniß des indischen Diamanten verwickelt zu finden. Ich hatte auf meinem Bureau die Ehre einer Conferenz mit einem orientalischen Fremden von distinguirtem Benehmen, der unzweifelhaft kein Anderer war, als der Anführer der drei Indier.
Nehme man dazu, daß ich den Tag nach dieser Conferenz mit dem berühmten Reisenden Mr. Murthwaite zusammentraf und eine Unterhaltung mit ihm über die Mondstein-Angelegenheit hatte, welche sehr wichtig für das Verständniß späterer Ereignisse ist, so hat man eine vollständige Zusammenfassung meiner Ansprüche auf die Stellung, die ich in den folgenden Blättern einnehme.
Der wahre Hergang bei der Auflösung der Verlobung nimmt der Zeit nach den ersten Platz ein und hat daher auch Anspruch auf die erste Stelle in dieser Erzählung.
Indem ich die Kette der Ereignisse von einem Ende zum andern rückwärts verfolge, finde ich es, so sonderbar es dem Leser scheinen mag, nothwendig, die Scene an dem Bett meines vortrefflichen Freundes und Clienten, des verstorbenen Sir John Verinder, zu eröffnen.
Sir John hatte sein nicht geringes Theil von den harmloseren und liebenswürdigeren Schwächen des menschlichen Geschlechts. Unter diesen muß ich, als für die vorliegende Angelegenheit von Bedeutung, seinen unüberwindlichen Widerwillen, die Verantwortlichkeit einer Feststellung seines letzten Willens über sich zu nehmen, so lange er sich noch bei guter Gesundheit befand, hervorheben.
Lady Verinder bemühte sich, ihren Einfluß auf ihn zur Erweckung eines Pflichtgefühls in dieser Beziehung geltend zu machen, und ich bemühte mich in gleicher Weise. Er gestand die Richtigkeit unserer Auffassung zu —— aber er kam nicht weiter, bis ihn die Krankheit befiel, der er schließlich erlag. Da endlich wurde ich geholt, um die Instructionen meines Clienten in Betreff seines letzten Willens entgegenzunehmen. Es waren die einfachsten Instructionen, die mir im ganzen Verlauf meiner Praxis jemals vorgekommen sind.
Sir John schlummerte, als ich zu ihm in’s Zimmer trat. Bei meinem Anblick raffte er sich auf.
»Wie geht’s Ihnen, Herr Bruff?« fragte er. »Ich werde Sie nicht lange aufhalten und werde bald wieder schlafen.«
Er schien sich lebhaft dafür zu interessiren, als ich Tinte, Feder und Papier zurechtlegte.
»Sind Sie fertig?« fragte er. Ich verneigte mich, tauchte die Feder ein und harrte meiner Instructionen.
»Alles meiner Frau,« sagte Sir John. »Mehr habe ich nicht zu sagen,« sank in die Kissen zurück, legte den Kopf auf die andere Seite und schien wieder schlafen zu wollen. Ich war genöthigt, ihn noch einmal zu stören.
»Habe ich Sie dahin zu verstehen,« fragte ich, »daß Sie das ganze Eigenthum, von jeder Art und Beschaffenheit, in dessen Besitz Sie sich bei Ihrem Tode befinden, ausschließlich Lady Verinder hinterlassen?«
»Ja,« sagte Sir John; »nur daß ich es kürzer ausdrücke. Warum können Sie es nicht eben so kurz machen und mich wieder schlafen lassen? Alles meiner Frau! Das ist mein letzter Wille."
Sein Eigenthum stand durchaus zu seiner Verfügung und war von zweierlei Art. Eigenthum in Land —— ich enthalte mich absichtlich technischer Ausdrücke —— und Eigenthum in Geld. In den meisten Fällen würde ich es, fürchte ich, für meine Pflicht gegen meinen Clienten gehalten haben, ihn zu einer nochmaligen Erwägung seines letzten Willens aufzufordern. In Sir John’s Fall wußte ich, daß Lady Verinder nicht nur des rückhaltlosen Vertrauens, das ihr Gatte in sie gesetzt hatte, würdig —— alle guten Frauen sind dessen würdig —— sondern daß sie auch im Stande sei, das ihr anvertraute Gut zweckmäßig zu verwalten —— wozu nach meiner Erfahrung von dem schönen Geschlecht nicht Eine unter Tausenden wirklich befähigt ist. In zehn Minuten war Sir John’s Testament aufgesetzt und vollzogen und der gute Sir John konnte wieder schlafen.
Lady Verinder rechtfertigte das Vertrauen, das ihr Gatte in sie gesetzt hatte, vollkommen. In den ersten Tagen ihrer Wittwenschaft schickte sie nach mir und machte ihr Testament. Die Art, wie sie ihre Lage betrachtete, war so durchaus verständig und gesund, daß ich mich der Nothwendigkeit, ihr Rath zu ertheilen, völlig überhoben fand. Meine Thätigkeit hatte sich lediglich darauf zu beschränken, ihre Instructionen in die gehörige gesetzliche Form zu bringen. Sir John war noch nicht vierzehn Tage zu Grabe getragen, als schon in höchst umsichtiger und ausreichender Weise für seine Tochter gesorgt worden war.
Das Testament blieb, ich weiß kaum mehr wie viele Jahre, in einem feuerfesten Kasten auf meinem Bureau aufbewahrt. Erst im Sommer 1848 fand ich unter sehr traurigen Umständen Veranlassung, das Testament wieder einzusehen, an jenem Tage nämlich, wo die Aerzte ihr Urtheil über Lady Verinder gesprochen hatten, welches in der That ein Todesurtheil war. Ich war der Erste, den sie von ihrem Zustand in Kenntniß setzte. Sie wünschte lebhaft, ihr Testament noch einmal mit mir durchzusehen.
Es war unmöglich an den Verfügungen in Betreff ihrer Tochter noch etwas zu verbessern, aber in Betreff verschiedener kleinerer Vermächtnisse an Verwandte hatten ihre Ansichten im Verlauf der Zeit einige Modifikationen erfahren und es erwies sich als nothwendig, dem Testamente drei bis vier Codicille hinzuzufügen. Nachdem ich aus Furcht vor möglicherweise eintretenden Umständen diese Codicille sofort hinzugefügt hatte, erwirkte ich mir die Erlaubniß von Lady Verinder, das Ganze zu einem neuen Testamente zusammenzufassen. Mein Zweck dabei war, gewisse unausbleibliche Confusionen und Wiederholungen, welche jetzt das Original-Document entstellten und, aufrichtig gestanden, meinem berufsmäßigen Sinn für das Exacte gänzlich widerstrebten, zu vermeiden.
Den Act der Vollziehung des zweiten Testaments hat Miß Clack, welche so gütig war als Zeugin dabei zu fungiren, geschildert So weit Rachel Verinder’s pecuniäres Interesse in Betracht kam, enthielt das zweite Testament nur die wörtliche Wiederholung der Verfügungen des ersten. Die einzigen Veränderungen bezogen sich aus die Ernennung eines Vormunds und gewisse, diese Ernennung betreffende, auf meinen Rath ausgesprochene Vorbehalte. Bei Lady Verinder’s Tode wurde das Testament nach bestehendem Rechtsgebrauch meinem Bevollmächtigten übergeben. Ungefähr drei Wochen später, so weit ich mich erinnern kann, erreichte mich zuerst die Kunde, daß etwas Ungewöhnliches vorgehe. Ich sprach zufällig auf dem Bureau meines Freundes und Bevollmächtigten vor und bemerkte, daß mein Erscheinen ein größeres Interesse bei ihm erwecke als gewöhnlich.
»Ich habe eine Neuigkeit für Sie,« sagte er. »Was meinen Sie was ich heute in Doktors Commons gehört habe? Man hat Lady Verinders Testament verlangt und bereits geprüft.«
Das war allerdings eine Neuigkeit. Das Testament enthielt absolut nichts was bestritten werden konnte, und meines Wissens gab es Niemanden, der auch nur das entfernteste Interesse daran haben konnte, es prüfen zu lassen. (Ich werde vielleicht gut thun zum Verständniß erläuternd zu bemerken, daß das Gesetz einem Jeden gestattet, gegen Erlegung eines Shillings in dem Gerichtshof von Doctors Commons von irgend welchem Testamente Einsicht zu nehmen.)
»Haben Sie gehört, wer nach dem Testament verlangt hat,« fragte ich.
»Ja wohl. Der Schreiber hatte kein Bedenken es mir mitzutheilen. Herr Smalley von der Firma Skipp u. Smalley hat danach verlangt. «Das Testament ist noch nicht in die großen Folio-Register eingetragen. So blieb nichts anderes übrig als ihn, abweichend von dem gewöhnlichen Gebrauch, von dem Original Einsicht nehmen zu lassen. Er hat es sorgfältig durchgelesen und eine Notiz in sein Taschenbuch eingetragen. Haben Sie irgend eine Vermuthung was er damit bezweckte?«
«Meine Antwort bestand in einem verneinenden Kopfschütteln und der Bemerkung: »Ich werde es aber heraus haben ehe ich einen Tag älter geworden bin« Damit ging ich ohne Weiteres nach meinem eigenen Bureau zurück.
Wenn irgend eine andere Advocatenfirma diese unerklärliche Prüfung des Testamentes meiner verstorbenen Clientin vorgenommen hätte, so würde ich vielleicht einige Schwierigkeiten bei meiner Entdeckung gefunden haben. Aber mit Skipp u. Smalley stand ich in einer Verbindung, welche mir die Erreichung meines Zwecks verhältnismäßig leicht machte. Einer meiner Schreiber, ein höchst sachkundiger und vortrefflicher Mensch, war der Bruder des Herrn Smalley; und, Dank dieser Art von indirecter Verbindung mit mir, hatten Skipp u. Smalley vor einigen Jahren die Brosamen von meinem Tische in Gestalt von Fällen aufgelesen, mit welchen ich es aus verschiedenen Gründen nicht der Mühe werth hielt, mich zu befassen. Auf diese Weise war meine professionelle Protection von einiger Wichtigkeit. Ich beschloß, sie bei dieser Gelegenheit, wenn es nothwendig werden sollte, an diese Protection zu erinnern.
Ich sprach sofort bei meiner Rückkehr mit meinem Schreiber und schickte ihn, nachdem ich ihm erzählt hatte was vorgefallen, nach dem Bureau seines Bruders mit meinen Empfehlungen und der Bitte, mich wissen zu lassen, aus welchem Grunde die Herren Skipp u. Smalley es für nothwendig gehalten hätten, Lady Verinder’s Testament zu prüfen.
In Folge dieser Botschaft erschien Herr Smalley in Begleitung seines Bruders auf meinem Bureau. Er theilte mir mit, daß er in Gemäßheit der Instructionen eines Clienten gehandelt habe und gab mir dann anheim, zu entscheiden, ob es nicht seinerseits ein Bruch des ihm in seinem Beruf geschenkten Vertrauens sein würde, mehr zu sagen.
Darüber entspann sich zwischen uns ein heftiger Disput Ohne Zweifel war er im Recht und ich im Unrecht. Um die Wahrheit zu gestehen, ich war zornig und argwöhnisch und bestand darauf, mehr zu wissen. Noch schlimmer, ich lehnte es ab irgend welche weitere mir zu machende Mittheilung als ein mir anvertrautes Geheimniß zu betrachten; ich verlangte, den Gebrauch, den ich von dieser Mittheilung zu machen gedachte, völlig meiner Discretion überlassen zu sehen. Und noch schlimmer, ich machte mir meine Stellung in unverantwortlicher Weise zu Nutze. »Wählen Sie«, sagte ich zu Herrn Smalley, »zwischen der Gefahr des Verlustes der Geschäfte Ihres Clienten und der Gefahr, meine Geschäfte zu verlieren.« Eine durchaus nicht zu rechtfertigende Handlungsweise, wie ich zugebe, —— ein reiner Act der Tyrannei. Wie andere Tyrannen erreichte ich meinen Zweck. Herr Smalley traf seine Wahl ohne einen Augenblick zu zaudern. Mit einem resignirten Lächeln theilte er mir den Namen seines Clienten mit: Herr Godfrey Ablewhite.
Das war mir genug, ich verlangte nicht mehr zu wissen.
An diesem Punkte meiner Erzählung angelangt, erscheint es nothwendig für mich, den Leser dieser Zeilen —— soweit Lady Verinders Testament in Betracht kommt —— über meine Wissenschaft in Betreff desselben vollständig aufzuklären.
Ich will daher in gedrängtester Kürze mittheilen, daß Rachel Verinder nur eine lebenslängliche Nutznießung an dem hinterlassenen Vermögen hatte. Das vortreffliche Urtheil ihrer Mutter und meine lange Erfahrung hatten dahin geführt, sie jeder Verantwortlichkeit zu entheben und sie vor jeder Gefahr zu schützen, künftig einmal das Opfer eines bedürftigen und gewissenlosen Mannes zu werden. Weder sie noch ihr Gatte, falls sie sich verheirathete, würde über einen Schilling, weder von dem Eigenthum in Land noch von dem in Gelde disponiren können. Sie würden die Häuser in London und Yorkshire und ein schönes Einkommen, aber weiter nichts zu ihrer Verfügung haben.
Als ich über meine Entdeckung nachdachte, befand ich mich in großer Verlegenheit in Betreff dessen, was ich zunächst thun sollte.
Kaum eine Woche war verflossen, seit ich zu meiner Ueberraschung und Betrübniß von Fräulein Verinder’s beabsichtigter Verheirathung gehört hatte. Ich empfand die aufrichtigste Bewunderung und Neigung für sie und hatte mit unaussprechlichem Bedauern gehört, daß sie im Begriff stehe sich an Herrn Godfrey wegzuwerfen. Und jetzt enthüllte sich dieser Mensch, den ich allezeit für einen glattzüngigen Betrüger gehalten hatte, vor mir in einer Gestalt, die meine schlechte Meinung von ihm vollkommmen rechtfertigte indem sich deutlich zeigte, daß er bei seinem Heirathsproject lediglich gewinnsüchtige Zwecke im Auge gehabt habe! »Und was weiter?« höre ich manche meiner Leser sagen, »die Sache geschieht tagtäglich.« Zugegeben, mein Verehrter, aber würden Sie die Sache eben so leicht beurtheilen, wenn Sie dieselbe z. B. an Ihrer Schwester erlebten?
Die erste Erwägung, die sich mir jetzt naturgemäß aufdrängte, war diese: Würde Herr Godfrey Ablewhite nach der von seinem Advokaten für ihn gemachten Entdeckung noch an seinem Verlöbniß festhalten?
Das hing lediglich von seinen pecuniären Verhältnissen ab, über welche mir nichts bekannt war. Wenn diese Verhältnisse nicht ganz verzweifelte waren, so würde es sich schon allein um ihres Einkommens willen der Mühe gelohnt haben, Fräulein Verinder zu heirathen. Wenn er andererseits einer bedeutenden Summe in gegebener Zeit dringend bedurfte, so lag hier gerade der in Lady Verinders Testament vorgesehene Fall vor, indem die Verfügung desselben ihre Tochter davor schützen würde, einem Schuft in die Hände zu fallen.
In dem letzteren Fall würde ich nicht genöthigt sein, Fräulein Rachel in den ersten Tagen ihrer Trauer um ihre Mutter durch eine sofortige Enthüllung der Wahrheit zu betrüben. In dem ersteren Fall würde ich mich, wenn ich schwiege, der Connivenz gegen eine Heirath schuldig machen, die Fräulein Verinder für ihr ganzes Leben unglücklich machen müßte.
Meine Bedenken endeten mit meinem Besuch in dem Londoner Hotel, in welchem sich, wie ich wußte, Mrs. Ablewhite und Fräulein Verinder aufhielten Sie theilten mir mit, daß sie am nächsten Tage nach Brighton gehen würden und daß eine unerwartete Abhaltung Herrn Godfrey Ablewhite verhindere, sie zu begleiten. Ich erbot mich, sofort seine Stelle zu übernehmen. So lange ich nur an Rachel Verinder gedacht hatte, waren Zweifel für mich möglich gewesen, sobald ich sie von Angesicht zu Angesicht sah, war ich auf der Stelle entschlossen, ihr, möchte daraus entstehen was wollte, die Wahrheit zu sagen.
Ich fand die Gelegenheit dazu, als ich am Tage nach meiner Ankunft in Brighton mit ihr spazieren ging.
»Darf ich mir,« fragte ich sie, »ein Wort in Betreff Ihrer Verlobung erlauben?«
»Ja,« sagte sie gleichgültig, »wenn Sie über nichts Interessanteres zu reden haben.«
»Wollen Sie einem alten Freund und Diener Ihrer Familie vergeben, Fräulein Rachel, wenn ich die Frage wage, ob Ihr Herz an dieser Heirath hängt?«
»Ich heirathe aus Verzweiflung, Herr Bruff, auf die Möglichkeit hin, in eine Art glücklichen Vegetirens zu verfallen, das mich vielleicht mit meinem Leben wieder aussöhnen wird.«
Eine starke Ausdrucksweise, die auf einen Liebesroman, der unter der Oberfläche schlummern mochte, schließen ließ. Aber ich ging gerade auf mein Ziel los und versagte es mir, wie wir Advokaten sagen, die Seitenwege der Frage zu verfolgen.
»Herr Godfrey Ablewhite wird schwerlich Ihre Anschauungsweise theilen,« sagte ich. »Sein Herz muß sehr entschieden an dieser Heirath hängen.«
»So sagt er, und ich muß ihm wohl glauben. Er würde mich nach dem, was ich ihm gestanden habe, wohl kaum heirathen, wenn er mich nicht gern hätte.«
Das arme Kind! Die Idee, daß ein Mann sie lediglich um seiner eigennützigen und, gewinnsüchtigen Zwecke willen heirathen könne, war ihr nie in den Sinn gekommen. Die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, fing an, mir schwerer zu erscheinen, als ich mir gedacht hatte.
»Es klingt,« fuhr ich fort, »sonderbar für meine altmodischen Ohren ——«
»Was klingt sonderbar?« fragte sie.
»Sie von Ihrem künftigen Gatten reden zu hören, als ob Sie der Aufrichtigkeit seiner Neigung nicht völlig gewiß wären. Sind Sie sich irgend eines Grundes bewußt, daran zu zweifeln?«
Ihre wunderbare rasche Auffassungsgabe entdeckte sofort eine Veränderung in meiner Stimme oder in meinem Wesen, als ich diese Frage that, welche sie ahnen ließ, daß ich die ganze Zeit mit einem Hintergedanken zu ihr gesprochen hatte. Sie stand still, nahm ihren Arm aus dem meinigen und blickte mir forschend in’s Auge.
»Herr Bruff,« sagte sie, »Sie haben mir etwas über Godfrey Ablewhite mitzutheilen. Sagen Sie es mir!«
Ich kannte sie gut genug, um sie beim Worte nehmen zu dürfen. Ich sagte es ihr.
Sie legte ihren Arm wieder in den meinigen und ging langsam mit mir weiter. Ich fühlte, wie sich ihre Hand auf meinem Arm krampfhaft zusammenballte, und ich sah sie auf unserem Wege blasser und blasser werden, aber nicht ein Wort kam über ihre Lippen, so lange ich sprach. Als ich geendet hatte, schwieg sie noch immer.
Sie ließ ihren Kopf etwas sinken, sie ging neben mir her, als ob sie meine Gegenwart, als ob sie Alles um sich her vergessen habe; in ihre eigenen Gedanken versenkt —— ich möchte fast sagen —— begraben.
Ich machte keinen Versuch, sie ihrer Betäubung zu entreißen. Meine Kenntniß ihres Wesens lehrte mich, ihr bei dieser wie bei früheren Gelegenheiten Zeit zu lassen.
Die meisten jungen Mädchen pflegen, sobald ihnen etwas sie Interessirendes mitgetheilt wird, eine Masse von Fragen zu thun und dann davon zu laufen und Alles mit einer vertrauten Freundin durchzusprechen. Rachel Verinder dagegen verschloß sich bei ähnlichen Gelegenheiten in sich selbst und ging mit sich allein über die Sache zu Rath. Diese absolute Selbstständigkeit ist eine große Tugend bei Männern. Bei Frauen hat dieselbe die sehr ernste Schattenseite, sie von der überwiegenden Mehrzahl ihres Geschlechts moralisch zu trennen und sie auf diese Weise Mißdeutungen des allgemeinen Urtheils auszusetzen. Ich habe mich selbst sehr stark in Verdacht, über diesen Punkt, außer in dem Falle von Rachel Verinder, ganz wie die übrige Welt zu denken. Die Selbstständigkeit ihres Charakters war nach meinem Urtheil einer ihrer Vorzüge, zum Theil ohne Zweifel, weil ich sie aufrichtig bewunderte und liebte, zum Theil weil die Ansicht, die ich mir von ihrem Antheil an dem Verlust des Mondsteins gebildet hatte, aus meine besondere Kenntniß ihres Wesens gegründet war. Wie sehr auch in der Angelegenheit des Mondsteins der Schein gegen sie sein mochte, so anstößig es ohne Zweifel erscheinen mußte, sie in irgend einem Zusammenhang mit dem Geheimniß eines unentdeckten Diebstahls zu wissen, war ich doch nichtsdestoweniger überzeugt, daß sie nichts ihrer Unwürdiges gethan haben könne, weil ich eben so fest überzeugt war, daß sie keinen Schritt in dieser Angelegenheit gethan haben werde, ohne sich vorher in sich selbst zu verschließen und die Sache auf’s Reiflichste zu erwägen.
Wir mochten wohl eine Viertelstunde weit gegangen sein, bevor Rachel sich wieder aufraffte Sie blickte mich plötzlich mit einem schwachen Wiederschein ihres Lächelns glücklicherer Tage an —— des unwiderstehlichsten Lächelns, das ich jemals auf einem weiblichen Antlitz gesehen habe.
»Ich verdanke Ihrer Güte schon Vieles,« sagte sie, »und ich bin Ihnen dafür in diesem Augenblick tiefer verpf1ichtet, denn jemals. Wenn Sie bei Ihrer Rückkehr nach London irgend welche Gerüchte über meine Heirath hören, widersprechen Sie denselben auf der Stelle und berufen Sie sich getrost auf mein eigenes Zeugniß.«
»Sind Sie entschlossen, Ihre Verlobung aufzuheben?« fragte ich.
»Können Sie zweifeln?« erwiderte sie stolz, »nach dem, was Sie mir gesagt haben!«
»Mein liebes Fräulein Rachel, Sie sind sehr jung —— und Sie werden es vielleicht schwieriger finden, Ihr jetziges Verhältniß aufzulösen als Sie denken. Haben Sie Niemanden —— ich meine natürlich eine Dame —— mit der Sie über die Sache zu Rathe gehen könnten?«
»Niemanden!« antwortete sie.
Es betrübte mich aufrichtig, sie so reden zu hören. Sie war so jung und stand so allein in der Welt und trug ihr Schicksal so würdig! Der Drang, ihr zu helfen, überwand bei mir alle Bedenken, die mir unter den obwaltenden Umständen sonst wohl meine Person als ungeeignet würden haben erscheinen lassen; und ich sprach meine Gedanken über den Gegenstand aus, wie sie mir der Augenblick eben eingab. Ich habe in meinem Leben einer ungeheuren Anzahl von Clienten Rath ertheilt und habe mit einigen äußerst verwickelten Angelegenheiten zu thun gehabt, aber dies war das erste Mal, daß ich einer jungen Dame Rath darüber zu ertheilen hatte, wie sie es anzufangen habe, sich von einem gegebenen Heirathsversprechen loszumachen.
Mein Vorschlag war kurz folgender: Ich empfahl ihr, Herrn Godfrey Ablewhite, natürlich in einer vertraulichen Besprechung, zu erklären, daß er, wie sie sicher wisse, seine gewinnsüchtigen Absichten errathen habe. Sie sollte dann hinzufügen, daß ihre Heirath mit ihm nach dieser Entdeckung zur Unmöglichkeit geworden sei und solle es ihm anheimstellen, ob er es für gerathener halte, sich ihrer Verschwiegenheit durch Zustimmung zu ihrem Entschluß zu versichern oder sie durch seine Weigerung zu zwingen, das Motiv ihrer Handlungsweise bekannt zu machen. Wenn er den Versuch machen sollte, sich zu vertheidigen oder die Thatsachen zu leugnen, so sollte sie ihn an mich beweisen.
Fräulein Verinder hörte mir aufmerksam zu, bis ich ausgeredet hatte. Dann dankte sie mir sehr freundlich für meinen Rath, erklärte mir aber zugleich, daß es ihr unmöglich sei, denselben zu befolgen.
»Darf ich fragen,« sagte ich, »was Sie gegen die Befolgung meines Raths einzuwenden haben?«
Sie zögerte — und erwiderte dann meine Frage mit einer andern.
»Angenommen,« fing sie an, »Sie würden aufgefordert, Ihre Ansicht über Herrn Ablewhites Benehmen auszusprechen.«
»Ja —— und?«
»Wie würden Sie dasselbe bezeichnen?«
»Ich würde es als das Benehmen eines niedrig gesinnten und falschen Menschen bezeichnen.«
»Herr Bruff! Ich habe an diesen Mann geglaubt. Ich habe diesem Manne das Versprechen gegeben, ihn zu heirathen. Wie kann ich ihm darnach sagen, daß er niedrig gesinnt ist, daß er mich getäuscht hat, wie kann ich ihn darnach in den Augen der Welt herabsetzen. Ich habe mich selbst herabgewürdigt, indem ich dem Gedanken Raum gab, ihn zu meinem Gatten zu machen. Wenn ich ihm das sage, was Sie mir vorschlagen, so muß ich ihm in’s Gesicht bekennen, daß ich mich herabgewürdigt habe. Das kann ich nicht, nach dem, was zwischen uns vorgegangen ist, das kann ich nicht! Die Schande würde ihm nichts ausmachen, mir aber völlig unerträglich sein.«
Hier enthüllte sich mir eine andere hervorragende Eigenthümlichkeit ihres Charakters. Es war ihr feinfühliger Schauder vor der bloßen Berührung mit Allem, was gemein war, der sie gegen jede Rücksicht auf das, was sie sich selbst schuldig war, blind machte, und sie in eine schiefe Position drängte, die sie in der Schätzung aller ihrer Freunde compromittiren konnte. Bis zu diesem Augenblicke war ich selbst gegen die Angemessenheit meines Raths etwas mißtrauisch gewesen. Aber nach dem, was sie mir eben gesagt hatte, konnte ich nicht mehr den geringsten Zweifel haben, daß es der beste Rath war, den man ihr hätte geben können, und ich stand keinen Augenblick an, ihr die Befolgung desselben nochmals dringend an’s Herz zu legen.
Sie schüttelte mit dem Kopfe und wiederholte nur in andern Worten ihre Einwände.
»Er stand auf so vertrautem Fuße mit mir, daß er mich um meine Hand bitten konnte. Er stand hoch genug in meiner Achtung, um mein Jawort zu erhalten, und nach allem diesen kann ich ihm nicht in’s Gesicht sagen, daß er das verächtlichste Geschöpf auf Erden ist.«
»Aber mein liebes Fräulein Rachel,« wandte ich ein, »es ist doch ebenso unmöglich für Sie, ihm ohne jede Angabe von Gründen zu erklären, daß Sie ihr einmal gegebenes Wort zurücknehmen.«
»Ich werde ihm sagen, daß ich mir die Sache überlegt habe und zu der Ueberzeugung gelangt sei, daß es für uns Beide das Beste sei, unsere Verbindung wieder aufzugeben.«
»Weiter nichts?«
»Weiter nichts!«
»Haben Sie auch bedacht, was er Ihnen vielleicht erwidern wird?«
»Er kann sagen, was er will.«
Es war unmöglich, der Delicatesse ihres Entschlusses die Anerkennung zu versagen, und es war ebenso unmöglich, nicht zu sehen, daß sie sich selbst damit zu nahe trat. Ich bat inständigst, ihre eigene Stellung nicht außer Augen zu lassen, ich machte sie darauf aufmerksam, daß sie sich den gehässigsten Mißdeutungen ihrer Motive aussetzen würde.
»Sie können mit den Gefühlen Ihres Herzens nicht dem allgemeinen Urtheil Trotz bieten.«
»Das kann ich doch,« antwortete sie, »und ich habe es bereits gethan.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
»Sie haben den Mondstein vergessen, Herr Bruff, Habe ich nicht in dieser Angelegenheit, auf meine Niemandem außer mir bekannten Gründe gestützt, dem allgemeinen Urtheil Trotz geboten?«
Ihre Antwort brachte mich für den Augenblick zum Schweigen. Es reizte mich, eine Erklärung ihres Benehmens zur Zeit des Verlustes des Mondsteins auf der Spur des sonderbaren Bekenntnisses zu suchen, welches ihr soeben entschlüpft war. Wäre ich jünger gewesen, hätte ich dieser Versuchung vielleicht nachgegeben, jetzt aber war es mir unmöglich.
Ich versuchte es mit einem letzten Einwand, bevor wir nach Hause zurückgekehrt. Sie ließ sich aber auch dadurch von ihrem Entschluß nicht abbringen. Mein Gemüth befand sich in einem sonderbaren Conflict von Gefühlen, als ich sie an jenem Tage verließ. Sie war eigensinnig, sie war im Unrecht, sie war interessant, sie war bewunderungswürdig, sie verdiente das tiefste Mitleid. Ich ließ mir von ihr das Versprechen geben, mir zu schreiben, sobald sie mir etwas Neues mitzutheilen haben werde, und ich kehrte zu meinen Geschäften nach London in einer sehr unbehaglichen Stimmung zurück.
An dem Abend nach meiner Rückkehr, noch bevor ich den versprochenen Brief möglicher Weise hätte erhalten können, wurde ich durch einen Besuch des älteren Herrn Ablewhite überrascht, der mir mittheilte, daß Herr Godfrey an eben diesem Tage seine Entlassung erhalten und angenommen habe.
Bei der Ansicht, die ich mir bereits von dem Fall gebildet hatte, offenbarte die bloße Thatsache der Annahme die Motive, welche Herrn Godfrey Ablewhite bei seiner Ergebung leiteten, so klar, als ob er sie ausgesprochen hätte. Er bedurfte einer großen Summe Geldes und zwar in einer gegebenen Zeit. Rachel’s Einkommen, das ihm in jeder andern Beziehung genügt haben würde, war dazu nicht ausreichend und Rachel hatte deshalb ihr Wort zurücknehmen können, ohne auf den mindesten ernsthaften Widerstand von seiner Seite zu stoßen. Wenn man mir darauf entgegnet, daß dies eine reine Hypothese sei, so frage ich dagegen, auf welche andere Weise man das Aufgeben einer Heirath von seiner Seite erklären will, welche ihm für den Rest seiner Tage eine glänzende Lebensstellung gegeben haben würde.
Jede freudige Aufwallung, welche diese glückliche Wendung der Dinge vielleicht in mir erregt haben würde, wurde durch den Fortgang meiner Unterhaltung mit dem alten Herrn Ablewhite sofort wieder zurückgedrängt.
Er war, wie er mir sagte, gekommen, um von mir zu erfahren, ob ich im Stande sei, ihm eine Erklärung über das auffallende Benehmen Fräulein Verinders zu geben. Ich brauche wohl kaum zu sagen, daß ich mich völlig außer Stande erklärte, ihm den gewünschten Aufschluß zu geben. Die unangenehmen Empfindungen, die ich dadurch bei Herrn Ablewhite erregte und die ihn in einer durch die Unterhaltung mit seinem Sohne schon sehr gereizten Stimmung fanden, brachten ihn völlig außer Fassung. Seine Blicke und sein Benehmen ließen gleich deutlich erkennen, daß Fräulein Verinder am nächsten Tage, wo er zu den Damen nach Brighton gehen wollte, einen erbarmungslosen Mann an ihm finden würde.
Ich verbrachte eine schlaflose Nacht damit, mir zu überlegen, was ich demnächst zu thun haben werde. Zu welchem Resultat mein Nachdenken führte und wie wohlbegründet mein Mißtrauen gegen den alten Herrn Ablewhite sich erwies, das sind Momente, die, wie ich erfahre, bereits genau und an der richtigen Stelle von der vortrefflichen Miß Clack mitgetheilt worden sind. Zur Vervollständigung ihres Berichts habe ich nur noch hinzuzufügen, daß Fräulein Verinder die Ruhe und Erholung, deren das arme Kind so sehr bedürftig war, in meinem Hause in Hampstead fand. Sie erfreute uns durch einen langen Besuch. Meine Frau und meine Töchter befreundeten sich sehr mit ihr, und als die Executoren ihren Entschluß in Betreff der Ernennung eines neuen Vormunds gefaßt hatten, trennten sich, wie ich mit Stolz und Freude berichten kann, mein Gast und meine Familie wie alte Freunde.

Zweites Capitel.
Das Nächste, was ich mitzutheilen habe, ist die genauere Kunde, welche ich in Betreff der Mondstein-Angelegenheit, oder correcter ausgedrückt in Betreff des indischen Complotts den Diamanten zu stehlen, besitze. Das Wenige, was ich zu sagen habe, ist gleichwohl, wie ich schon bemerkt zu haben glaube, in Betracht seines merkwürdigen Zusammenhangs mit späteren Ereignissen von einiger Wichtigkeit.
Etwa eine Woche oder zehn Tage später, nachdem Fräulein Verinder uns verlassen hatte, trat einer meiner Schreiber in mein Privat-Cabinet auf meinem Bureau mit einer Karte in der Hand und theilte mir mit, daß unten ein Herr sei, der mich zu sprechen wünsche.
Ich warf einen Blick auf die Karte, auf welcher sich ein ausländischer Name befand, der mir entfallen ist. Am Fuße der Karte aber befand sich eine geschriebene Zeile, deren Wortlaut ich mich sehr erinnere: »Empfohlen durch Herrn Septimus Luker.«
Die Frechheit eines Mannes in der Stellung des Herrn Luker, der sich herausnahm mir Jemanden zu empfehlen, brachte mich so völlig außer Fassung, daß ich einen Augenblick schweigend dasaß und mich fragte, ob ich meinen Augen trauen dürfe. Der Schreiber, der meine Ueberraschung bemerkte, kam mir mit dem Ergebniß seiner eigenen Beobachtung des Fremden, der unten wartete, zu Hilfe.
»Es ist ein sonderbar aussehender Mann, Herr Bruff, von so dunkler Hautfarbe, daß wir ihn aus dem Bureau Alle für einen Indier oder etwas Aehnliches halten.«
Indem ich die Schilderung des Schreibers mit der impertinenten Zeile auf der Karte combinirte, erkannte ich auf der Stelle, daß der Mondstein der Schlüssel zu der Empfehlung des Herrn Luker und zu dem Besuch des Fremden auf meinem Bureau sei. Zum Erstaunen meines Schreibers entschloß ich mich sofort, dem unten wartenden Herrn eine Audienz zu gewähren.
Zur Rechtfertigung des höchst unberufsmäßigen Opfers, welches ich aus diese Weise der reinen Neugierde brachte, sei es mir gestattet, jeden Leser dieser Zeilen daran zu erinnern, daß keine, wenigstens gewiß keine in England lebende Person den Anspruch erheben kann, in so genauer Beziehung zu der romantischen Geschichte’ des indischen Diamanten gestanden zu haben, wie ich. Mir waren die Veranstaltungen des Obersten Herncastle, um der Ermordung zu entgehen, anvertraut gewesen. Ich war es, der die Briefe des Obersten empfing, in welchen er in regelmäßig wiederkehrenden Perioden meldete, daß er noch am Leben sei. Ich war es, der sein Testament abfaßte, in welchem er den Mondstein Fräulein Verinder vermachte. Ich war es, der den von ihm ernannten Executor durch die Vorstellung, daß der Edelstein sich vielleicht als eine kostbare Erwerbung für die Familie erweisen werde, zur Uebernahme der Executorschaft vermochte. Und ich war es endlich, welcher Herrn Franklin Blake’s Skrupel bekämpfte und ihn dazu veranlaßte, die Uebermittelung des Diamanten nach Lady Verinder’s Hause auf sich zu nehmen. Wenn irgend Jemand ein unveräußerliches Recht des Interesses an der Mondstein-Angelegenheit und an Allem, was damit zusammenhängt, in Anspruch nehmen kann, so bin ich es unleugbar.
In dem Augenblick, wo mein mysteriöser Client in mein Cabinet geführt wurde, drang sich mir die Ueberzeugung auf, daß einer der drei Indier, wahrscheinlich ihr Anführer, vor mir stehe. Er war sorgfältig in europäische Tracht gekleidet. Aber seine dunkle Hautfarbe, seine lange geschmeidige Gestalt und seine feierliche und gefällige Höflichkeit wäre für jedes kundige Auge hinreichend, um seinen orientalischen Ursprung zu erkennen.
Ich wies ihm einen Stuhl an und bat um die Mitheilung der Veranlassung seines Besuches.
Nachdem er sich zuerst in sehr gewähltem Englisch wegen der Freiheit, die er sich genommen, mich zu stören, entschuldigt hatte, holte der Indier ein kleines Packet hervor, dessen äußere Umhüllung in einem Stück Goldstoff bestand. Nachdem er dasselbe, sowie eine zweite Umhüllung von Seidenstoff entfernt hatte, stellte er einen kleinen mit kostbaren Edelsteinen besetzten, aus Ebenholz gefertigten Kasten auf meinen Tisch.
»Ich bin zu Ihnen gekommen, Herr Bruff,« sagte er, »Sie zu bitten, mir etwas Geld zu leihen, und biete Ihnen dieses Kästchen als Pfand an.«
Ich wies auf seine Karte. »Und Sie wenden sich an mich,« sagte ich, »auf Herrn Luker’s Empfehlung?«
Der Indier verneigte sich.
»Darf ich fragen, wie es kommt, daß Herr Luker Ihnen nicht selbst das von Ihnen gewünschte Geld vorgeschossen hat?«
»Herr Luker hat mir erklärt, Herr Bruff, daß er kein Geld zu verleihen habe.«
»Und hat Ihnen gerathen, sich an mich zu wenden?«
Der Indier wies nun seinerseits auf die Karte und sagte: »Da steht es geschrieben.«
Eine kurze und durchaus bündige Antwort! Wenn der Mondstein sich in meinem Besitz befunden hätte, so würde mich dieser orientalische Herr, wie mir wohl bekannt war, ohne das geringste Bedenken ermordet haben. Dabei aber muß ich anerkennen, daß er, abgesehen von dieser kleinen Unannehmlichkeit, das vollkommene Muster eines Clienten war. Mein Leben würde er nicht respectirt haben, aber er that, was keiner meiner Landsleute, so lange ich in geschäftlicher Beziehung mit ihnen gestanden, jemals gethan hatte —— er respectirte meine Zeit.
»Ich bedauern« sagte ich, »daß Sie sich zu mir bemüht haben. Herr Luker hat Sie durchaus an die falsche Adresse verwiesen. Wie andere Männer meines Berufs befinde ich mich in Besitz von Geldern, die mir zum Zweck der Verleihung anvertraut sind. Aber ich verleihe es niemals an Fremde und niemals auf ein Pfand, wie das von Ihnen angebotene.«
Weit entfernt, wie andere Leute es gethan haben würden, den Versuch zu machen, mich zu einer Abweichung von meinen Grundsätzen zu bewegen, beschränkte sich der Indier darauf, sich zum zweiten Mal zu verneigen und seinen Kasten, ohne mit einem Wort weiter zu insistiren, wieder in seine beiden Umhüllungen zu wickeln. Dieser merkwürdige Mörder erhob sich in demselben Augenblick von seinem Sitz, wo ich ihm meine Antwort gegeben hatte.
»Wollen Sie mir,« sagte er, »bevor ich fortgehe, aus freundlicher Rücksicht für einen Fremde eine Frage erlauben?«
Ich verneigte mich meinerseits. Nur eine Frage beim Abschied! Nach meiner Erfahrung betrug die Durchschnittszahl solcher Fragen sonst fünfzig.
»Angenommen, Herr Bruff,« sagte er, »es wäre für Sie möglich und nützlich gewesen, mir das Geld zu leihen in welchem Zeitraum wäre es für mich möglich und üblich gewesen, es zurückzuzahlen?«
»Nach dem landesüblichen Gebrauch,« antwortete ich, würden Sie berechtigt gewesen sein, das Geld ein Jahr nach dem Tage, wo es Ihnen vorgeschossen wurde, zurückzuzahlen.«
Der Indier verneigte sich zum letzten Mal, Dieses Mal am tiefsten, und ging plötzlich und leise aus dem Zimmer.
Im Nu war er geräuschlos, schleichend, katzenartig zum Zimmer hinaus, was mich, wie ich bekennen muß, etwas betroffen machte. Sobald ich meine Fassung wieder gewonnen hatte, um nachdenken zu können, gelangte ich zu einem ganz bestimmten Schluß in Betreff des sonst unbegreiflichen Fremden, der mich mit seinem Besuch beehrt hatte.
Sein Gesicht, seine Stimme und seine Bewegungen hatte er, so lange er sich in meiner Gesellschaft befand, so vollständig zu beherrschen gewußt, daß sie jeder Erforschung seiner Absichten Hohn sprachen. Aber trotz alledem hatte er mir eine Möglichkeit geboten, durch seine glatte Außenseite hindurch einen Blick in sein Inneres zu thun. Er hatte, bis ich die Zeit nannte, in welcher es üblich sei, einem Schuldner frühestens die Rückzahlung eines Darlehns zu gestatten, nicht den geringsten erkennbaren Versuch gemacht, sich irgend etwas von dem, was ich ihm sagte, einzuprägen. Erst als ich ihm diese Zeit nannte, blickte er mir gerade in’s Gesicht Der Schluß, den ich daraus zog, war, daß er bei dieser Frage einen besonderen Zweck im Auge gehabt habe. Je reiflicher ich das zwischen uns Vorgefallene überdachte, um so stärker drängte sich mir der Verdacht auf, daß dies Angebot des Kästchens und das Gesuch um ein Darlehen ein reiner Vorwand zu dem Zweck gewesen sei, ihm den Weg zu seiner beim Abschied an mich gerichteten Frage zu bahnen.
Ich hielt mich eben von der Richtigkeit dieses Schlusses vollkommen überzeugt und war im Begriff, einen Schritt weiter zu thun und den Motiven des Indiers nachzuforschen, als mir ein Brief überbracht wurde, als dessen Schreiber sich kein Geringerer als Herr Septimus Luker selbst erwies. Er bat mich in Ausdrücken einer widerwärtigen Unterwürfigkeit um Verzeihung und versicherte mich, daß er mir über die fragliche Angelegenheit eine befriedigende Erklärung werde geben können, wenn ich ihm die Ehre einer persönlichen Besprechung erweisen wolle.
Abermals beschloß ich meiner Neugierde zu Liebe etwas von meiner berufsmäßigen Würde zu opfern. Ich erwiderte das Schreiben mit der Anberaumung einer Conferenz auf meinem Bureau für den nächsten Tag.
Herr Luker war ein dem Indier so weit untergeordnetes Wesen, er war so ordinair, so häßlich, so kriechend und so geschwätzig, daß er jeder weiteren Besprechung in diesen Blättern völlig unwürdig ist. Das Wesentliche von dem, was er mir mitzutheilen hatte, kann ich kurz dahin Zusammenfassen:
Einen Tag bevor der Indier mich mit seinem Besuche beehrt hatte, war dieser vollendete Gentleman bei Herrn Luker gewesen. Trotz seiner europäischen Kleidung hatte Herr Luker sofort in ihm den Anführer der drei Indier erkannt, die ihn früher durch ihr Herumlungern vor seinem Hause belästigt und endlich in die Nothwendigkeit versetzt hatten, sich an die Behörde zu wenden.
Diese erschreckende Entdeckung hatte bei ihm sofort zu dem sehr natürlichen Schluß geführt, daß der vor ihm Stehende einer von den drei Männern sein müsse, die ihm die Augen verbunden, ihn geknebelt und ihn des Empfangscheins seines Banquiers beraubt hatten. Die Folge dieses Schlusses war, daß ihn der Schreck völlig lähmte, und daß er sein letztes Stündlein gekommen glaubte.
Der Indier seinerseits benahm sich wie ein vollkommen Fremder. Er producirte das Kästchen mit demselben Anliegen, das er nachher bei mir vorgebracht hatte.
Als das geeignetste Mittel, ihn rasch los zu werden, hatte Herr Luker ohne Weiteres erklärt, er habe kein Geld. Darauf hatte der Indier ihn gebeten, ihm die geeignetste und sicherste Person zu nennen, von der er das gewünschte Darlehn werde erhalten können. Herr Luker hatte geantwortet, daß als die geeignetste und sicherste Person in der Regel ein Solicitor betrachtet werde. Nach einem bestimmten Solicitor gefragt, hatte Herr Luker mich einfach deshalb genannt, weil mein Name der erste war, der ihm in seiner Bestürzung einfiel.
»Die Schweißtropfen flossen mir in Strömen von der Stirn, Herr Bruff,« schloß der widerwärtige Kerl, »ich wußte nicht mehr, was ich sagte und ich hoffe, lieber Herr Bruff, Sie werden es mir verzeihen und Rücksicht nehmen, daß ich wirklich und wahrhaftig vor Angst die Besinnung verloren hatte.«
Ich war bereit genug, dem Patron die erbetene Entschuldigung angedeihen zu lassen. Das war die beste Art, seinen Anblick rasch los zu werden. Ehe ich ihn fortgehen ließ, hielt ich ihn noch einen Augenblick zurück, um noch eine Frage zu thun, nämlich ob der Indier in dem Moment, wo er Herrn Luker’s Haus verlassen, irgend etwas Bemerkenswerthes gesagt habe.
»Ja, der Indier hatte genau dieselbe Frage wie an mich, an Herrn Luker gerichtet, und hatte natürlich auch von ihm dieselbe Antwort erhalten wie von mir.
Was hatte das zu bedeuten?
Herrn Lukers Erklärung förderte mich durchaus nicht in der Lösung des Problems. Ebenso unfähig, über diese Schwierigkeit hinwegzukommen, erwies sich demnächst mein eigener Scharfsinn.
Ich hatte für den Abend eine Einladung zum Diner und ging in einer nicht sehr heitern Stimmung hinauf, ohne zu ahnen, daß der Weg zu meinem Ankleidezimmer auch der erste Schritt zu meiner Entdeckung sein sollte.

Drittes Capitel.
Die hervorragendste Persönlichkeit unter den Gästen der Tischgesellschaft war Herr Murthwaite.
Bei seinem Wiedererscheinen in England nach seinen Erforschungsreisen hatte die Gesellschaft sich lebhaft für ihn als einen Mann interessirt, der viele gefährliche Abenteuer bestanden hatte und von denselben erzählen konnte. Er stand im Begriff auf den Schauplatz seiner Erlebnisse zurückzukehren und in unerforschte Gegenden vorzudringen. Sein großartig gleichmüthiges Vertrauen auf sein bisheriges Glück und sein Entschluß, dasselbe in neuen Gefahren zu erproben, hatte das erlöschende Interesse seiner Verehrer an ihrem Helden neu belebt. Nach aller Erfahrung mußte er dieses Mal seinen Gefahren erliegen. Man trifft nicht alle Tage einen merkwürdigen Mann bei Tische, mit der Aussicht demnächst von seiner Ermordung zu hören.
Als die Herren im Eßzimmer allein zurückblieben, saß ich neben Herrn Murthwaite. Da die anwesenden Gäste Alle Engländer waren, so brauche ich wohl kaum zu sagen, daß sobald die heilsam, durch die Anwesenheit der Damen gebildete Schranke entfernt war, die Unterhaltung sich nothwendiger Weise um Politik drehte.
In Betreff dieses Alles absorbierenden nationalen Themas bin ich zufällig einer der unpatriotischsten Engländer. Im Allgemeinen kenne ich nichts Trübseligeres und Nutzloseres als eine politische Conversation Als ich einen Blick auf Herrn Murthwaite warf, nachdem die Flaschen zum ersten Mal ihren Rundgang um den Tisch gemacht hatten, fand ich, daß er augenscheinlich meiner Ansicht sei. Sehr geschickt und mit aller schuldigen Rücksicht für seinen Wirth richtete er sich auf ein Mittagschläfchen ein. Es reizte mich, den Versuch zu wagen, ob eine geschickte Anspielung auf den Mondstein ihn wach halten werde, und falls dieser Versuch erfolgreich wäre, zu sehen, was er über die neueste Verwicklung der indischen Verschwörung, wie sie sich in den nüchternen Räumen meines Bureaus enthüllt hatte, dachte.
»Wenn ich mich nicht irre, Herr Murthwaite«, fing ich an, »waren Sie mit der verstorbenen Lady Verinder bekannt und Sie haben sich für die sonderbare Kette von Begebenheiten interessirt, welche zu dem Verlust des Mondsteins führten.«
Der berühmte Reisende erwies mir die Ehre sich sofort zu ermuntern und mich zu fragen, wer ich sei.
Ich setzte ihn von meinen geschäftlichen Beziehungen zu der Herncastle’schen Familie in Kenntniß und vergaß dabei nicht der merkwürdigen Stellung Erwähnung zu thun, die ich dem Obersten und seinem Diamanten gegenüber in früherer Zeit eingenommen hatte.
Herr Murthwaite drehte sich in seinem Stuhle um, so daß er der übrigen Gesellschaft, conservativen wie liberalen, den Rücken kehrte und concentrirte seine ganze Aufmerksamkeit auf mich, den einfachen Advocaten Bruff.
»Haben Sie kürzlich etwas von den Indiern gehört?« fragte er.
»Ich habe allen Grund zu glauben,« antwortete ich, »daß ich Einen von ihnen gestern auf meinem Bureau gesprochen habe.«
Herr Murthwaite war nicht der Mann, sich leicht über etwas zu wundern; aber diese meine Antwort machte ihn augenscheinlich betroffen. Ich erzählte ihm, was Herrn Luker und was mir selbst begegnet war, wie ich es oben geschildert habe.
»Offenbar,« fügte ich hinzu, »hatte der Indier bei seiner Abschiedsfrage einen besonderen Zweck im Auge. Denn was konnte er sonst für ein Interesse daran haben, die Zeit zu kennen, innerhalb deren ein Darlehn nach Landesgebrauch zurückerstattet werden kann?«
»Ist Ihnen wirklich seine Absicht dabei nicht klar, Herr Bruff?«
»Ich muß zu meiner Schande bekennen, daß ich dieselbe wirklich nicht zu durchschauen vermag, Herr Murthwaite.«
Den großen Reisenden schien es zu ergötzen, den Abgrund meiner Dummheit bis in seine tiefsten Tiefen zu sondiren.
»Erlauben Sie mir eine Frage« sagte er. »In welchem Stadium befindet sich augenblicklich die Verschwörung zur Entwendung des Mondsteins?«
»Das vermag ich nicht zu sagen,« erwiderte ich. »Die indische Verschwörung ist mir ein Räthsel.«
»Mein lieber Herr Bruff, die indische Verschwörung kann nur deshalb für Sie ein Räthsel sein, weil Sie sich niemals wirklich bemüht haben, dasselbe zu ergründen. Wollen wir uns die verschiedenen Stadien, welche die Verschwörung von der Zeit an, wo Sie Oberst Herncastles Testament aufsetzten, bis zu dem Moment, wo der Indier aus Ihrem Bureau erschien, durchlaufen hat, einen Augenblick Vergegenwärtigen? In Ihrer Stellung kann es für die Interessen Fräulein Verinder’s von großer Wichtigkeit sein, daß Sie nöthigenfalls einen klaren Ueberblick über diese Angelegenheit haben. Bitte, sagen Sie mir, ob Sie es unter diesen Umständen vorziehen, den Schlüssel zu den Motiven des Indiers selbst zu suchen, oder ob ich Ihnen jedes weitere Nachdenken über die Sache ersparen soll?«
Ich brauche wohl kaum zu sagen, daß ich den praktischen Zweck, den er in diesem Moment im Auge hatte, vollkommen zu würdigen wußte und daß ich aus den ersten der beiden mir gemachten Vorschläge einging.
»Nun wohl,« sagte Herr Murthwaite »Fragen wir zuerst nach dem Alter der drei Indier. Ich kann bezeugen, daß sie nach ihrem Aussehen alle Drei von ungefähr gleichem Alter zu sein scheinen, und Sie können selbst darüber urtheilen, ob der Mann, der bei Ihnen war, in der Blüthe der Jahre stand oder nicht. Noch nicht vierzig, nicht wahr? Das glaube ich auch. Also noch nicht vierzig. Nun versetzen Sie sich gefälligst in die Zeit, wo Oberst Herncastle nach England zurückkehrte und wo Sie in das Geheimniß seiner Veranstaltungen zum Schutz seines Lebens gezogen wurden. Sie brauchen die Jahre nicht zu zählen. Ich will nur constatiren, daß diese gegenwärtigen Indier nach ihrem Alter die Nachfolger von drei Indiern sein müssen, welche, — (Alle aus der hohen Kaste der Brahminen, Herr Bruff) seiner Zeit den Obersten hierher verfolgten. Nun wohl. Unsere jetzigen Indier sind ihren Vorgängern gefolgt. Wenn sie sich darauf beschränkt hätten, so würde die Sache keine weitere Nachforschung verdient haben. Aber sie haben mehr gethan. Sie sind in das Complott eingetreten, welches ihre Vorgänger hier in England organisirt hatten. Erschrecken Sie nicht. Das Gewebe des Complotts ist, wie ich fest überzeugt bin, nach unsern Begriffen ein sehr loses. Dasselbe beschränkt sich meiner Meinung nach auf die Mitwissenschaft und die eventuellen Hilfsleistungen jener obscuren Art unserer Landsleute, die in den überwiegend von Ausländern bewohnten Nebengäßchen Londons ihr Quartier aufgeschlagen haben, und auf die geheime Sympathie jener Wenigen ihrer Landsleute und ehemaligen Glaubensgenossen, die ihr Brot in der Befriedigung eines der unzähligen Bedürfnisse der hauptstädtischen Bevölkerung verdienen. Kein sehr furchtbares Comploth wie Sie sehen. Aber immerhin als Ausgangspunkt unserer Betrachtung der Berücksichtigung werth, weil wir im Fortgang derselben vielleicht Veranlassung finden werden, auf diese bescheidene kleine Verschwörung zurückzukommen. Nachdem ich uns so den Weg gebahnt habe, will ich eine Frage an Sie richten, die Sie mir nach Ihren Erfahrungen gewiß werden beantworten können. Welches Ereigniß gab den Indiern die erste Chance, sich des Diamanten zu bemächtigen?«
Ich verstand die Anspielung auf meine Erfahrungen.
»Ihre erste bestimmte Chance,« erwiderte ich, »wurde ihnen durch Oberst Herncastle’s Tod geboten. Ich nehme als selbstverständlich an, daß sie von seinem Tode sofort Kunde erhielten.«
»Ganz gewiß. Und sein Tod bot ihnen, wie Sie sagen, die erste Chance Bis zu jenem Zeitpunkte hatte der Diamant sicher in dem Gewölbe der Bank gelegen. Sie haben das Testament des Obersten verfaßt, in welchem er seiner Nichte den Edelstein vermacht, und die Rechtsgültigkeit des Testaments wurde in gewohnter Weise festgestellt. Als Jurist können Sie keinen Augenblick zweifelhaft über Das sein, was die Indier nach Einholung englischen Raths danach gethan haben werden.«
»Sie werden sich mit einer Copie des Testaments in Doctors Commons versehen haben. sagte ich.
»So ist es. Einer oder der Andere jener obscuren Engländer, von denen ich vorhin sprach, wird ihnen eine solche Copie verschafft haben. Aus dieser Copie ersahen sie, daß der Mondstein der Tochter Lady Verinder’s vermacht sei und daß der ältere Herr Blake oder eine von ihm ernannte Person bestimmt sei, ihn derselben zu überbringen. Sie werden mir zugeben, daß die nöthige Information über Personen in der Stellung Lady Verinder’s und Herrn Blake’s sehr leicht zu erlangen sein mußte. Die einzige Schwierigkeit der Indier konnte nur darin bestehen, daß sie sich zu entscheiden hatten, ob sie den Versuch, sich des Diamanten auf seinem Wege aus dem Gewahrsam der Bank zu bemächtigen, machen, oder ob sie damit warten sollten, bis derselbe nach Lady Verinder’s Hause nach Yorkshire gebracht sein würde. Der zweite Weg mußte offenbar als der sicherere erscheinen und damit haben Sie die Erklärung der Erscheinung der Indier in Frizinghall, wo sie als Jongleurs auftraten und ihre Zeit abwarteten. In London hatten sie selbstverständlich ihre Einrichtungen derart getroffen, daß sie von den sie interessirenden Ereignissen au fait gehalten wurden. Zwei Männer waren beauftragt, der eine, Jedem, der von dem Hause des Herrn Blake nach der Bank ging, zu folgen, und der andere, die niederen männlichen Dienstboten des Hauses mit Bier zu regaliren und sich die Neuigkeiten des Hauses von denselben berichten zu lassen. In Folge dieser sehr einfachen Vorsichtsmaßregeln mußten sie alsbald davon in Kenntniß gesetzt werden, daß Herr Franklin Blake auf der Bank gewesen und daß derselbe die einzige Person im Hause sei, welche Lady Verinder besuchen werde. Was dieser Entdeckung folgte, ist Ihnen ohne Zweifel so gegenwärtig wie mir.«
Ich erinnerte mich, daß Franklin Blake einen der Spione auf der Straße als solchen erkannt, —— daß er in Folge dessen seine Ankunft in Yorkshire um einige Stunden verstirbt, und daß er (Dank dem vortrefflichen Rath des alten Betteredge) den Diamanten in der Bank in Frizinghall niedergelegt hatte, noch ehe die Indier ihn auch nur in der Gegend vermuthet hatten. Alles vollkommen klar bis soweit. Aber wie kam es, daß die Indier, ohne von der letztgedachten Vorsichtsmaßregel Franklin Blake’s unterrichtet zu sein, in dem ganzen Zeitraum bis zu Rachel’s Geburtstag keinen Einbruch in das Haus, von dem sie glauben mußten, daß der Diamant sich darin befinde, versuchten?
Indem ich Herrn Murthwaite diese schwierige Frage vorlegte, fügte ich hinzu, daß ich allerdings von dem kleinen Jungen und der tintenartigen Flüssigkeit und dem übrigen Hokuspokus gehört habe, daß aber eine auf die Annahme eines clairvoyanten Zustandes bei dem Jungen gegründete Erklärung für mich durchaus nichts Ueberzeugendes habe.
»Für mich auch nichts« sagte Herr Murthwaite »Die Clairvoyance ist in diesem Fall nichts als die Entfaltung der Liebhaberei der Indier an übernatürlichen Dingen. Für diese Leute war es eine für uns Engländer völlig unverständliche Belebung und Ermuthigung, ihre mühsamen und gefahrvollen Wanderungen durch dieses Land mit einem gewissen Schimmer des Außerordentlichen und Wunderbaren zu umgeben. Ihr Junge ist unzweifelhaft ein für magnetische Einflüsse empfängliches Subject, und unter diesem Einfluß hat er eben so unzweifelhaft das in dem Geiste der ihn magnetisirenden Person Vorhandene wieder ausgestrahlt. Ich habe die Theorie des Magnetismus geprüft und habe gefunden, daß die Aeußerungen der Magnetisirten niemals die eben angegebene Grenze überschreiten. Die Indier fassen die Sache anders auf; sie glauben ihren Jungen mit der Kraft begabt, Dinge zu sehen, die für ihre Augen unsichtbar sind und, ich wiederhole es, in diesem Wunder finden sie die Quelle eines neuen Interesses an der Verfolgung des Zwecks, der sie vereinigt. Ich erwähne das nur als eine Probe einer merkwürdigen Seite des menschlichen Charakters, die Ihnen völlig neu sein muß. Wir haben bei der uns vor liegenden Untersuchung nichts mit Clairvoyance, Magnetismus oder mit irgend etwas Aehnlichem, an das zu glauben einem praktischen Mann schwer wird, zu thun. Mein Zweck bei der schrittweisen Verfolgung der indischen Verschwörung ist, auf rationellem Wege gewisse Thatsachen auf ganz natürliche Ursachen zurückzuführen. Ist mir das bis jetzt in Ihren Augen gelungen?«
»Vollkommen, Herr Murthwaite! Ich gestehe jedoch, daß ich der rationellen Erklärung der Schwierigkeit, welche ich vorhin die Ehre hatte, Ihnen vorzulegen, mit einiger Ungeduld entgegensehe.«
Herr Murthwaite lächelte. »Das ist,« sagte er, »die von allen Schwierigkeiten am leichtesten zu überwindende. Erlauben Sie mir damit zu beginnen, Ihre Darlegung des Falles als eine vollkommen correcte zu bezeichnen. Die Indier wußten unzweifelhaft nicht, was Herr Franklin mit dem Diamanten gethan hatte, denn wir finden, daß sie den ersten Fehler in der ersten Nacht nach Herrn Blake’s Ankunft in dem Hause seiner Tante begehen.«
»Ihren ersten Fehler?« wiederholte ich.
»Gewiß! Den Fehler, sich bei ihrem Herumlungern vor der Terrasse von Gabriel Betteredge überraschen zu lassen. Indessen hatten sie das Verdienst, ihren Fehler einzusehen, denn, wie Sie wieder richtig bemerken, kamen sie, obgleich sie volle Zeit dazu gehabt hätten, wochenlang nachher nicht wieder nach dem Hause.«
»Und warum, Herr Murthwaite? Das möcht ich eben wissen! Warum?«
»Weil kein Indier sich jemals einer unnöthigen Gefahr aussetzt. Die von Ihnen selbst in Oberst Herncastle’s Testament aufgenommene Clausel belehrte sie, daß der Mondstein an Fräulein Verinder’s Geburtstag in ihr unbeschränktes Eigenthum übergehen solle; nicht wahr? Nun wohl. Sagen Sie selbst, was war der sicherste Weg für Leute in der Lage der Indier? Sollten sie sich des Diamanten zu bemächtigen suchen, so lange sich derselbe unter der Obhut des Herrn Franklin Blake befand, der bereits gezeigt hatte, daß er ihnen auf die Spur zu kommen und sie zu überlisten wußte? Oder sollten sie nicht lieber warten, bis sich der Diamant in den Händen eines jungen Mädchens befände, die ihre unschuldige Freude daran haben würde, den kostbaren Edelstein bei jeder möglichen Gelegenheit zu tragen? Vielleicht verlangen sie einen Beweis der Richtigkeit meiner Behauptung. In dem Benehmen der Indier selbst müssen Sie diesen Beweis finden. Nachdem sie wochenlang gewartet hatten, erschienen sie an Fräulein Verinder’s Geburtstag wieder vor dem Hause, und sie fanden sich für die Präcision ihrer geduldigen Berechnung durch den Anblick des Mondsteins an der Brust von Fräulein Verinder belohnt. Als ich später an jenem Abend die Geschichte des Obersten und des Diamanten erfuhr, war ich so durchdrungen von den Gefahren, in denen Herr Franklin Blake geschwebt hatte —— sie hätten ihn ohne Zweifel angegriffen, wenn er nicht zufälligerweise in Begleitung anderer Leute nach Lady Verinders Hause zurückgeritten wäre —— und so fest überzeugt, daß noch schlimmere Gefahren Fräulein Verinder’s harrten, daß ich den Rath gab, den Plan des Obersten zur Ausführung zu bringen und die Identität des Edelsteins durch Zerschneiden in verschiedene kleine Theile zu vernichten. Wie das merkwürdige Verschwinden desselben in jener Nacht meinen Rath unnütz machte und die indische Verschwörung entscheidend durchkreuzte und wie jede fernere Thätigkeit der Indier am nächsten Tage durch ihre Verhaftung als Vagabunden gelähmt wurde, das Alles wissen sie so gut wie ich. Hier schließt der erste Art der Verschwörung. Bevor wir zu dem zweiten Art übergehen, erlaube ich mir die Frage, ob ich Ihre Schwierigkeit in einer für einen practischen Mann befriedigenden Weise gelöst habe?«
Es war unmöglich zu bestreiten, daß ihm das, Dank seiner überlegenen Kenntniß des indischen Charakters und Dank der Möglichkeit, in der er sich befunden hatte, seit Herncastle’s Tod nicht an hundert andere Testamente denken zu müssen, vollkommen gelungen war.
»So weit wäre also die Sache klar,« fing Herr Murthwaite wieder an. »Die erste Chance, die sich den Indiern dargeboten hatte, sich. des Diamanten zu bemächtigen, war an dem Tage für sie verloren, wo sie in Frizinghall ins Gefängniß gebracht wurden. Wann bot sich ihnen nun eine zweite Chance? Die zweite Chance bot sich ihnen, wie ich zu beweisen im Stande bin, während sie noch im Gefängniß saßen.«
Er zog seine Brieftasche hervor und öffnete dieselbe an einer bestimmten Stelle, bevor er fortfuhr.
»Ich hielt mich zu jener Zeit bei Freunden in Frizinghall auf. Einen oder zwei Tage bevor die Indier ihrer Haft entlassen wurden (ich glaube, es war an einem Montag), kam der Director des Gefängnisses mit einem Briefe zu mir. Derselbe war für die Indier von einer Mrs. Macann abgegeben, bei welcher sie logirt hatten, und war Tags zuvor auf gewöhnlichem Wege durch die Post nach Mrs. Macann Hause befördert worden. Die Gefängnißbeamten hatten bemerkt, daß der Poststempel »Lambeth« lautete und daß die äußere Adresse, wiewohl in correctem Englisch geschrieben, doch eine von der gewöhnlichen Art zu adressiren sonderbar abweichende Gestalt hatte. Beim Eröffnen hatten sie den Brief in einer fremden Sprache geschrieben gefunden, welche sie mit Recht für hindostanisch hielten. An mich wandten sie sich natürlich, um eine Uebersetzung des Briefes von mir zu erbitten. Ich trug eine Abschrift des Originals und meiner Uebersetzung in meine Brieftasche ein und hier haben Sie sie beide.«
Er überreichte mir die offene Brieftasche. Die Copie begann mit der Adresse des Briefes. Sie war in einem fortlaufenden Satze ohne jede Interpunktion geschrieben, wie folgt: »An die drei indischen Männer welche bei der Dame mit Namen Macann in Frizinghall in Yorkshire wohnen.« Darauf folgten indische Lettern und endlich die englische Uebersetzung in folgenden mysteriösen Worten:
»Im Namen des Beherrschers der Nacht, dessen Sitz auf der Antilope ist, dessen Arme die vier Enden der Welt umschlingen.
»Brüder, wendet Euer Antlitz nach Süden und kommt zu mir nach der Straße vielen Geräusches, welche hinabführt zu dem schlammigen Fluß.
»Die Ursache ist folgende:
»Meine eigenen Augen haben ihn
gesehen.«
Damit schloß der Brief, ohne Datum oder Unterzeichnung. Ich gab ihn Herrn Murthwaite zurück und gestand, daß dieses sonderbare Specimen indischer Correspondenz mir einigermaßen unverständlich sei.
»Den ersten Satz kann ich Ihnen erklären,« sagte er; »und die Erklärung des Uebrigen finden Sie in dem weiteren Verhalten der Indier. Der Gott des Monds wird in der indischen Mythologie als eine vierarmige auf einer Antilope sitzende Gottheit dargestellt und einer seiner Titel ist: Beherrscher der Nacht. Hier haben wir also schon etwas, das einer indirecten Bezugnahme auf den Mondstein nicht übel ähnlich sieht. Sehen wir nun zu, was die Indier thaten, nachdem die Gefängnißbeamten ihnen den Brief übergeben hatten. An demselben Tage wo sie freigelassen wurden, gingen sie ohne Weiteres nach der Eisenbahnstation und nahmen dort Plätze für den ersten Zug, der nach London ging. Wir bedauerten es in Frizinghall Alle, daß ihre Schritte nicht im Geheimen beobachtet würden. Aber nachdem Lady Verinder den Beamten, der geheimen Polizei entlassen und jeder ferneren Untersuchung über die Ursache des Verlustes des Diamanten Einhalt gethan hatte, durfte sich Niemand anders anmaßen, in der Sache zu handeln. Den Indiern stand bei ihrer Absicht, nach London zu gehen, nichts im Wege, und so reisten sie dahin. Was war die nächste Nachricht, die wir von ihnen erhielten, Herr Bruff?«
»Sie belästigten Herrn Luker,« erwiderte ich, »durch Herumlungern vor seinem Hause in Lambeth.«
»Haben Sie den Bericht über Herrn Luker’s Erscheinen vor dem Polizeirichter gelesen?«
»Ja.«
»Im Laufe seiner Angaben nahm er, wie Sie sich erinnern werden, auf einen fremden von ihm engagirten Arbeiter Bezug, den er eben auf den Verdacht eines versuchten Diebstahls hin entlassen habe, und von dem er gleichfalls argwöhnte, daß er möglicherweise mit den Indiern, welche ihn belästigt hatten, Unter einer Decke stecke. Der Schluß von diesen Angaben auf den Schreiber des Briefes, der sie eben beschäftigt hat, und auf den Schatz in Herrn Lukers Besitz welchen der Arbeiter zu stehlen versucht hatte, ist leicht genug.«
Der Schluß war, wie ich mich anzuerkennen beeilte, zu klar, um besonders hervorgehoben werden zu müssen. Ich hatte niemals daran gezweifelt, daß der Mondstein zu der Zeit, von welcher Herr Murthwaite sprach, seinen Weg in Herrn Luker’s Hände gefunden habe. Das Einzige, was mir dabei unklar geblieben, war, wie die Indier diesen Umstand erfahren hatten? Auch diese Frage, nach meiner Meinung die schwerst zu beantwortende, hatte jetzt, wie alle übrigen, ihre befriedigende Antwort gefunden. Obgleich Jurist, fing ich an einzusehen, daß ich mich blindlings der Führung des Herrn Murthwaite durch das Labyrinth anvertrauen könne, durch das er mich schon bis hierher geleitet hatte. Ich machte ihm darüber mein Compliment, das er seinerseits sehr graziös aufnahm.
»Sie müssen mir aber auch Ihrerseits mit einer Mittheilung an die Hand gehen, bevor wir fortfahren,« sagte er. Irgend Jemand muß den Mondstein von Yorkshire nach London gebracht haben und Jemand muß Geld darauf geborgt haben oder er würde nie in Herrn Luker’s Besitz gelangt sein. Ist in Betreff dieser Person irgend etwas entdeckt worden.«
»Nichts, daß ich wüßte!«
»Ein Gerücht wollte, wenn ich nicht irre, Herrn Godfrey Ablewhite mit der Sache in Verbindung bringen. Wie ich höre, ist er ein renommierter Philantrop, was zu nächst einmal gegen ihn spricht.«
Ich stimmte Herrn Murthwaite darin von ganzem Herzen bei. Gleichzeitig aber fühlte ich mich verpflichtet, ihm —— ohne wie ich wohl kaum zu sagen brauche, Fräulein Verinder’s Namen zu nennen —— mitzutheilen, daß Herr Godfrey Ablewhite in einer über jeden Zweifel erhabenen Weise von allem Verdacht gereinigt sei.
»Nun wohl,« sagte Herr Murthwaite ruhig, »überlassen wir es der Zeit, die Sache aufzuklären. Indessen müssen wir wieder zu den Indiern zurückkehren. Ihre Reise nach London schloß einfach damit, daß sie abermals eine Niederlage erlitten, die Vereitelung ihrer zweiten Chance, sich des Diamanten zu bemächtigen, verdankt man, glaub’ ich, vor Allem der schlauen Umsicht des Herrn Luker, —— der nicht umsonst eine hervorragende Persönlichkeit in dem uralten und gedeihlichen Stande der Wucherer ist! Durch die prompte Entlassung des fraglichen Arbeiters beraubte er die Indier des Beistands, welchen ihr Verbündeter ihnen dadurch geleistet hätte, daß er ihnen den Eintritt in’s Haus verschafft haben würde. Durch den raschen Transport des Mondsteins nach dem Gewölbe seines Banquiers überraschte er die Verschwörer, bevor sie sich aus einen neuen Plan zu seiner Beraubung hätten vorbereiten können. Wie die Indier dann zu einer Kunde von diesem Transport gelangten, und was sie unternahmen, um in den Besitz des Empfangscheins des Banquiers zu gelangen, das sind zu kürzlich geschehene Dinge, als daß es nöthig wäre, dabei länger zu verweilen. Es genüge uns, zu constatiren, daß sie jetzt wissen, daß der Mondstein sich, in dem Gewölbe eines Banquiers unter der allgemeinen Bezeichnung eines kostbaren Juwels deponirt, zum zweiten Mal an einer für sie unerreichbaren Stelle befinde. Und jetzt, Herr Bruff, wo ist die dritte Chance der Indien sich des Diamanten zu bemächtigen, und wann wird dieselbe eintreten?«
In dem Augenblick, wo er diese Frage aussprach, ward mir endlich der Zweck des Besuchs des Indiers auf meinem Bureau klar!
»Ich habe es!« rief ich aus, »die Indier nehmen es für ausgemacht an, wie wir es auch thun, daß der Mondstein verpfändet ist, und suchen nun ohne Zweifel zu erfahren, wann das Pfand frühestens wieder ausgelöst werden kann, weil dieser Zeitpunkt auch der früheste ist, in welchem der Diamant aus dem sichern Gewahrsam der Bank wieder entfernt werden kann.«
»Ich habe Ihnen ja gesagt, Herr Bruff, daß Sie es selbst herausfinden würden, wenn ich Sie auf die rechte Spur führte. In einem Jahre, von dem Tage an, wo der Mondstein verpfändet worden ist, werden die Indier ihre dritte Chance auszubeuten versuchen. Aus Herrn Luker’s eigenem Munde haben sie erfahren, wie lange sie noch warten müssen, und Ihre Autorität ist ihnen Gewähr dafür, daß Herr Luker ihnen die Wahrheit gesagt hat. Wie sollen wir, nach einer wahren Annahme, die ungefähre Zeit bestimmen, wo der Diamant seinen Weg in die Hände des Geldverleihers fand?«
»Soweit ich sehe, gegen Ende des verflossenen Juni,« antwortete ich.
»Und jetzt schreiben wir 1848. Nun wohl. Wenn die unbekannte Person, welche den Mondstein verpfändet hat, ihn nach Verlauf eines Jahres wieder auslösen kann, so wird der Edelstein gegen Ende Juni 1849 sich wieder im Besitz dieser Person befinden. Ich werde um jene Zeit Tausende von Meilen von England und englischen Nachrichten entfernt sein. Aber für Sie möchte es sich der Mühe lohnen, sich dieses Datum zu merken und sich so einzurichten, daß Sie um jene Zeit in London sind.«
»Glauben Sie denn, daß sich dann etwas Entscheidendes ereignen wird?« sagte ich.
»Ich kann Ihnen nur sagen,« antwortete er, »daß ich mich unter den wildesten Fanatikern Central-Asiens für sicherer halten werde, als ich es nach meiner Ueberzeugung wäre, wenn ich mit dem Mondstein in der Tasche aus der Bank träte. Die Indier sind zweimal überlistet worden, Herr Bruff Ich glaube ganz gewiß, daß sie sich nicht zum dritten Mal werden überlisten lassen.«
Das waren die letzten Worte, die er über diesen Gegenstand sprach. Der Kaffee wurde serviert und die Tafel aufgehoben, die Gäste zerstreuten sich im Zimmer und wir Beiden gingen zu den Damen hinauf.
Ich notierte mir das Datum und es ist vielleicht nicht überflüssig meine Erzählung hier mit der Wiederholung dieser Notiz zu schließen:
»Juni 1849. Gegen Ende des Monats Nachrichten von den Indiern erwarten.«
Nachdem ich das gethan habe, überreiche ich die Feder, welche ich zu führen keinen weiteren Anspruch habe, dem mir zunächst folgenden Berichterstatter.

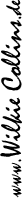
 Startseite
Startseite
 Neuigkeiten
Neuigkeiten Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung
Inhaltsverzeichnis aktuelle
Übersetzung